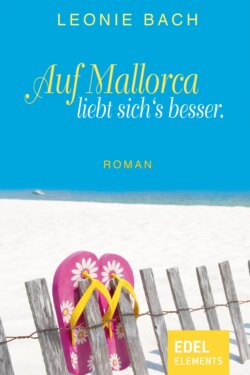Читать книгу Auf Mallorca liebt sich's besser - Leonie Bach - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel
ОглавлениеEs war am Abend vor dem ersten Klassentreffen. Siebzehn Jahre nach dem Abitur und ein Monat vor meinem fünfunddreißigsten Geburtstag. Zeit für Rückblicke. Neben mir auf dem Schlafzimmerparkett standen eine Flasche Rotwein, ein Glas und eine riesige alte Villosa-Bonbon-Büchse: rotblaues Blech mit weißen Schneetupfern und erkältetem Schneemann darauf. Sie stammte noch aus meiner Studentenzeit. Damals hatte ich darin Wollknäuel und Stricknadeln verwahrt. Damals war 1981, also Hochsaison für strickende Studentinnen.
Ich mußte lächeln, als ich an die Kreationen Marke »Schlabberschick« dachte, die zu jener Zeit unter meinen Händen entstanden waren. Vor allem während des Seminars »Spanische Gotik und maurische Inspiration« von Dr. Karsten Schaleen, Dozent für Architekturgeschichte an der Fachhochschule Köln. Dann hatte ich nur Augen für ihn gehabt, der ein bißchen aussah wie Harrison Ford. Um mein jugendliches Herzklopfen im Rahmen zu halten, hatte ich jedesmal zu den Stricknadeln gegriffen und Pulloverärmel heruntergeklappert, die mir bis in die Kniekehlen reichten. Dr. Karsten Schaleen hatte über diese Pullover gelächelt. Und was für ein Lächeln! Ein Clark Gable wäre darüber neidischgrün geworden.
Mein Herz tat bei dieser Rückblende einen ungelenken, etwas müden Hopser. Ich seufzte. Wie lange das alles schon her war! Ein ganz leichtes Ziehen in der Herzgegend hätte mich warnen sollen: Rückblicke können gefährlich sein.
Trotzdem. An diesem Abend wollte ich in der Bonbon-Büchse nach alten Schulfotos und sentimentalen Erinnerungen kramen, wegen des Klassentreffens. Ich war allein, trug meinen allerliebsten Flauschpyjama und konnte mich ausschließlich mit mir und meiner Vergangenheit befassen. Als Familienmutter hat man solche Gelegenheiten nicht oft. Irgendwer muß immer zum Sportverein gefahren, von der Disco abgeholt, bei den Schularbeiten betreut, außer der Reihe bekocht oder ordnungsgemäß beschimpft werden – und sei es nur unser darmsensibler Hundewelpe Brownie. Dann die Großeinkäufe bei Aldi, die Wäsche, die Bügelei, der Hausputz. Nebenher arbeitete ich ab und an als Grafikerin und Texterin für verschiedene Werbeagenturen und Zeitschriften. Bevor da Mißverständnisse aufkommen: Werbung klingt bei weitem zu aufregend. Ich gestaltete und textete die Wurfsendungen einer örtlichen Baumarktkette oder schrieb und zeichnete für Fachzeitschriften wie »Der Badprofi – Verbandsnachrichten für den Sanitärgroßhandel« und «Der Fliesenleger«. Im Klartext: Ich befaßte mich mit Kloschüsseln und Badewannen, und das meistens im Namen meines Mannes, weil er aus der Branche war und sich gern mit journalistischen Federn schmückte. Immerhin finanzierte ich mit dieser Tätigkeit meine Haushaltshilfe, ohne die mir Haus und Kinder und das andere Chaos über den Kopf gewachsen wären.
Ich war und bin KEIN Superweib im Sinne der Jacobs-Werbung für »Krönung light«, wo eine megasexy Blondine durch den Tag joggt, nebenher noch wichtige Politgrößen kritisch interviewt oder aussichtslose Gerichtsprozesse gewinnt, um abends ihren Lover bei Candlelight zu verführen. Von wegen »Ich bin aktiv den ganzen Tag, mir geht es gut.« Nee, so eine war ich nicht.
Gut ging es mir an diesem Abend trotzdem. Mein Mann war bei einem Meeting mit spanischen Geschäftsfreunden, um über die Lieferung von 500 Waschbecken und die Gestaltung der Badezimmer für eine Luxushotelkette auf Mallorca zu verhandeln. Meine Tochter Zoey blockierte – typisch fünfzehn, typisch Teenie – bereits seit zwei Stunden unsere Haustelefonanlage. Von Janosch, meinem zehn Jahre alten Quengel-Bengel, war nichts zu hören und zu sehen. Sogar unser drei Monate alter Hund Brownie tat keinen Wuff. Ich öffnete also mit großen Erwartungen die Villosa-Dose, nicht ahnend, daß sie sich als eine Art Büchse der Pandora erweisen sollte. Eine Büchse, die jede Menge Übel enthielt.
Zunächst fiel mir ein inzwischen sepiafarbenes Polaroidporträt von mir in die Hände: Ich stehe auf dem Plaça Olivar in Palma, vor einem Marktstand mit beleuchteten Madonnenfiguren aus buntem Gips. Ich liebe Madonnen und Sakralkitsch. Schon damals bei der Studienfahrt »Spanische Gotik« im Frühsommer 1982. Unter einem blumengeschmückten Strohhut quillt mein langes Haar hervor. Ich hoffe, wie ein sanfter Botticelli-Engel auszusehen, indem ich von innen die Haut meiner Backen einsauge, was mein Gesicht schmaler erscheinen lassen soll. Umsonst. Schon meine Stupsnase ist einem Botticelli-Gesicht im Weg. Leider, denn der Fotograf war Dr. Karsten Schaleen. Ach Karsten!
Er wußte so wunderbar über das Raumgefühl der gotischen Kathedrale von Palma zu erzählen, über die Lichtarchitektur der Mauren oder die klimatische Funktion der spanischen Innenhöfe. Und als feinfühliger Romantiker unter dem nächtlichem Sternenhimmel in Palmas Gassen war er... einfach unbeschreiblich gewesen.Und ich war verliebt – und wie!
Einen Moment lang kreisten meine wehmütigen Gedanken noch über der Baleareninsel, landen ließ ich sie nicht. Diese Mallorca-Erinnerungen gingen mir zu nah. Nicht, weil ich nicht gerne tagträumte – im Gegenteil –, aber Mallorca und mein Liebestraum waren einmal Wirklichkeit gewesen, und nun war meine Wirklichkeit von diesem Mallorca und dem Liebestraum Lichtjahre entfernt. Nicht etwa nur zwei Flugstunden.
Das Ziehen in der Herzgegend wurde zu einem kurzen wehen Reißen. Ich griff nach der Rotweinflasche, schenkte ein und nahm einen tiefen Schluck. Seit mein fünfunddreißigster Geburtstag näherrückte, war ich unruhig geworden. Ich hatte das akute Gefühl, mein Leben wie einen Bus einfach verpaßt zu haben.
Ich stellte mir beim Bodenwischen plötzlich Fragen nach dem Sinn meines Lebens – was mit einem Wischmop in der Hand und einem Putzeimer voll Schmuddelwasser vor Augen automatisch zu trübsinnigen Antworten führen mußte. Ich ertappte mich immer häufiger bei erotisch eingefärbten Tagträumen, in denen ich mich an der Seite von Joschka Fischer im Weißen Haus sah, wo ich Bill und Hillary gerade eine sensationelle Idee zur Sanierung der Slums von Rio de Janeiro erläuterte. Das kommt davon, wenn man seine Pubertät nicht zu Zeiten von Boygroups und Girliefieber, sondern zu denen von Friedens- und Frauenbewegung und Sting, dem singenden Robin Hood des Regenwaldes, verbracht hatte. Damals, als Schafwollstrümpfe trendy waren und Weltverbesserer und Woody Allen als echt sexy galten.
In meinen weniger ehrgeizigen und weit weniger peinlichen Traum-Versionen war ich Hollywoodstar Demi Moore, die Leonardo di Caprio zum nächtlichen Kaffee »danach« einlud. Mit anderen Worten: Ich war ein Tagtraum-Junkie geworden, süchtig nach Kino im Kopf. Beim Friseur ertappte ich mich außerdem dabei, daß ich Artikel über die Fortschritte der Schönheitschirurgie verschlang: »Für immer jung – ein winziger Schnitt in die richtige Richtung«. Das Mädchen auf dem Polaroidfoto aus Palma hätte über solche Anwandlungen nur den Kopf geschüttelt.
Ich trank einen weiteren Schluck Rotwein. Dann wagte ich es, meinen Blick von dem Foto der knapp Neunzehnjährigen zu dem Spiegelbild der fast Fünfunddreißigjährigen schweifen zu lassen. Wegen des Klassentreffens. Würde man mich überhaupt noch erkennen? Okay, die unvermeidlichen Falten waren hinzugekommen. Trotzdem, dachte, ich, sie werden mich wiedererkennen. Schon der Haare wegen. Die waren seit dem Abitur keinen Zentimeter kürzer geworden, die Stupsnase nicht gerader und ich insgesamt nicht auffälliger, aber immerhin auch nicht fülliger. Ich hatte mich nicht groß verändert, dachte ich, und dieser Satz machte mich seltsamerweise sehr traurig.
Die ersten paar Takte von Beethovens »Hymne an die Freude« rissen mich aus meinen Erinnerungen. So meldete sich unser schnurloses Schlafzimmertelefon. Auf allen vieren machte ich mich auf die Suche nach dem verflixten Teil, malträtiert von Beethoven, fluchend über meine eigene Vergeßlichkeit. Wo, zum Teufel, lag das Ding nur wieder? Ich fand es unter dem Bett neben einem sorgfältig zerkauten Lederpantoffel meines Mannes – ein Werk von unserem Welpen Brownie. Genervt riß ich den Hörer, der merkwürdig klebte, an mein Ohr und drückte die Sprechtaste.
»Für dich, Mom«, maulte meine Tochter Zoey streng. »Aber beeil dich, auf der anderen Leitung wartet Lara mit ziemlich dringenden News über ihre Ätz-Mutter.«
»Nun aber mal langsam«, warf ich ein. »Du blockierst die Anlage schon seit mehr als zwei Stunden und …« Meine Tochter hatte sich längst wieder aus der Leitung geklinkt. Wir hatten eines dieser modernen Telefonsysteme, bei denen man in einem Gespräch »anklopfen« kann. Es war meine Freundin Cordula, die Zoey unterbrochen hatte.
»Hallo Carolin, was machst du?«
»Alte Klassenfotos anschauen.« Ich nahm einen großen Schluck Rotwein.
»Und Trinken!«
»Nur einen wönzigen Schlock«, ahmte ich das Walroß aus der Augsburger Puppenkiste nach.
»Vorsicht!« warnte Cordula mit eindringlich-salbungsvoller Stimme – so, wie der Sprecher von der Autofahrer-Aufklärungsserie »Der siebte Sinn«. »Wein, vermischt mit Jugenderinnerungen, kann gefährlicher sein als überhöhte Geschwindigkeit bei Nässe. Ein paar Stundenkilometer zuviel beim Ausflug in die dunkle, vergessene Vergangenheit, und man gerät leicht ins Schlingern.«
»Bis jetzt hat’s mich noch nicht aus der Bahn geworfen«, log ich. »Ich habe gerade ein altes Foto von mir in Palma gefunden. Macht Laune.«
Cordula seufzte zustimmend. »Dir schon. Du hast dich schließlich kaum verändert. Von Gott mit einem ewigen Mädchengesicht bedacht. Wahrscheinlich, weil du immer ein braves Mädchen warst. Die gute alte sanfte Carolin. Die beneidenswerteste Frau, die ich kenne.«
Ich wußte, daß Cordula das alles ehrlich und als Kompliment meinte, aber irgendwie ärgerten mich diese Sätze aus ihrem Munde gewaltig. Schließlich hatte ich mich gerade so richtig schön in meine Geburtstags-Sinnkrise hineingearbeitet und wollte nicht hören, daß ich immer ein »braves Mädchen« gewesen war. Schon gar nicht von Cordula, die so ziemlich die mondänste, aufmüpfigste und beneidenswerteste Frau, die ich kenne. Eine von denen, die Männerköpfe zum Rotieren bringen, wenn sie ein Restaurant betritt. Und zwar nicht, weil sie etwa auffällig schön ist – sie ist mehr der mittelmäßige Barbra-Streisand-Typ mit Silberblick und krummer Nase – dafür besitzt sie das einmalige Talent, sich wie eine ausgemachte Schönheit zu benehmen, und das WIRKT. Cordula kennt alle Tricks. Kein Wunder, denn sie schreibt als freie Autorin und gegen unanständig hohe Honorare für alle möglichen hochglanzlackierten Frauenmagazine. Als studierte Psychologin ist sie für Tests und weibliche Seelenkrankheiten zuständig, von A wie Angstneurose bis Z wie Zellulitisphobie oder was auch immer. Sie hat jedenfalls ordentlich zu tun und ist nie um einen Ratschlag verlegen.
Außerdem jettet sie ab und an um den halben Erdball, um ein psychologisch einfühlsames Starporträt zu schreiben. Etwa:»Brad Pitt liebt unscheinbare Hausfrauen«, also Frauen nach Art der »Für Sie«-Leserin, Frauen wie mich. HAHA! An Zeitschriften wie »Vogue« verkaufte Cordula das Porträt dann unter der Überschrift »Brad Pitt liebt modisch interessierte, ausgereifte Frauen mit Kunstverstand« oder so. Mit anderen Worten, Cordula ist eine Art Superweib, eines, das jeden wichtigen Trend kennt und mitmacht. Keine wie ich, die brav ist und sich nie verändert.
Spitz fragte ich deshalb nach. »Was meinst du mit ›ich habe mich nie verändert’? Hältst du mich für eine öde Landpomeranze, nur weil ich immer noch in Neuss lebe und nicht in Düsseldorf wie du? Oder siehst du mich als letzte Überlebende der Friedensbewegung, eine ewige Öko-Strickliesel?« Mein Blick streifte die Villosa-Bonbon-Dose.
»Hey, hey, steckst du schon wieder in deiner Sinnkrise? Das war kein Angriff. Nur eine Generalprobe. Ich wette zehn zu eins, daß sie dir diesen Satz morgen tausendfach um die Ohren hauen. Was auch der Grund für meinen Anruf ist. Es geht um die beiden überlebenswichtigen Fragen vor jedem Klassentreffen: Was ziehst du an? Und schminkst du dich endlich mal auf strahlend schöne, erwachsene Frau?«
Ich schüttelte den Kopf und sagte gelassen: »Über die Klamotten mache ich mir frühestens morgen um sechs Uhr Gedanken. Also kurz bevor du mich abholst.« Ein spitzer Schrei stach mir ins Ohr.
»Bist du des Wahnsinns! Ich sehe dich schon in deinen ewigen Jeans und im Sweatshirt vor mir stehen, ungeschminkt und fern der Heimat.«
»Na und?« gab ich entnervt zurück. »Ich habe mich eben wirklich nicht groß verändert.«
»Na und, na und?« äffte Cordula mich nach. »Hey, das morgen wird kein gemütlicher Kameradschaftsabend unter Männern. Das morgen wird ein gnadenloser Weiberkrieg. Nur Frauen, dazu 80 an der Zahl, die sich entscheidende 17 Jahre nicht gesehen haben. Was meinst du, warum die morgen zusammenkommen?«
Ich zuckte die Achseln und bemühte mich, den klebrigen Hörer aus meiner Hand zu lösen. Ziemlich schwierige Angelegenheit. Ich kam nicht umhin, darin ein Werk meines Sprößlings Janosch zu vermuten. Zerstreut antwortete ich gleichzeitig Cordula. »Na, die kommen, um Erinnerungen auszutauschen, um zu lachen, um Spaß …«
»Carolin!« Cordula imitierte die strenge Gouvernante, die zum hundertfünften Mal eine Algebraformel erklären muß. »Wo lebst du eigentlich? Die meisten kommen morgen, um mit ihren schlanken Taillen, ihren teuren Klamotten, ihren Männern, ihren Jobs, ihren Häusern, ihren Kindern, ihren Ausbildungen oder ihren Einbildungen anzugeben. 80 Frauen, von denen sich die Mehrzahl aus gegebenem Anlaß mörderisch in Schale geworfen hat und bis unter die gezupften Augenbrauen kosmetisch bewaffnet, warten nur darauf, über einen ungeschminkten Unschuldengel wie dich herzufallen.«
Mein Mund begann zu schmollen, ich schmollte mit. »Du tust geradezu so, als sähe ich aus wie eine Mischung aus Schlampe oder Pippi Langstrumpf.«
Cordula stöhnte. »Ich weiß nur, daß du zur Zeit in einer hochsensiblen Phase steckst. Ein bißchen Maske täte dir gut. Das schützt nicht nur den Teint, sondern manchmal auch die Seele.«
Ich schwieg sehr laut und sehr beleidigt in den Hörer, der sich in meinen warmen Händen wie eine geplatzte Patextube anfühlte.
»Carolin, ich will dir doch nur sagen, daß das morgen ein Haifischbecken ist, und du bist ein naives Seelchen. Du bringst es auch fertig, deine Version der ungeschminkten Wahrheit und nichts als die Wahrheit über dich, deinen Ehemann, deine Kinder und deine verlorenen Träume preiszugeben.«
»Du tust ja geradezu so, als würden meine Familie und ich unter der Brücke schlafen und die Sozialhilfe versaufen. Moment mal, Cordula.« Mit einem beherzten Ruck riß ich den Hörer aus meiner Handfläche, ein bißchen Haut blieb, glaube ich, daran kleben, mit spitzen Fingern führte ich den Hörer an mein anderes Ohr. Janosch zur Rede stellen, notierte ich innerlich. Cordula hatte ihren Redefluß nicht unterbrochen.
»... glaubst du nicht auch? Ich rede nur davon, daß du es wahrscheinlich nicht mal schaffst, mit deinem Ehemann, dem international tätigen Großunternehmer und Stardesigner, anzugeben.«
»Er ist vor allem Großhändler in Sachen Fliesen, Kacheln, Kloschüsseln, Wannen und Waschbecken«, korrigierte ich.
»Genau das meine ich!« triumphierte Cordula. »Kloschüsseln. Wie das schon klingt! Ich sehe die Klatschmäuler jetzt schon triefen. Sag Bad-Design, rede von seinen exklusiven Badeinrichtungen, Innenarchitektur. «
»Das meiste Geld verdient er mit Toiletten«, warf ich müde ein. »Klos sind wie Särge, sie werden immer gebraucht.«
»Du kannst ihm einfach nicht verzeihen, daß er nun mal der bodenständige Typ ist, der nach der Formel »Eins und eins ist zwei« lebt. Wie auch immer, lächele die anderen mit deinem Glück in Grund und Boden. Du wirst sehen, wie fabelhaft gut es dir hinterher geht. Versprich es mir.«
Cordula ist nicht das, was man eine bedingungslose Frauenfreundin nennen würde, aber eins wußte ich sicher, sie kannte sich aus mit unseren Geschlechtsgenossinnen. Zaghaft und um Versöhnung bemüht, warf ich darum ein: »Also immerhin gehe ich morgen nachmittag zum Friseur.«
»Um dir doch nur wieder die Spitzen um 0,005 Millimeter abschneiden zu lassen, kenn’ ich doch! Dabei könntest du mit einer flotten Frisur um Jahre jünger aussehen.«
»Oder wie Angela Merkel«, maulte ich dazwischen. Meine langen Haare waren für mich der Inbegriff von Jugend und weiblicher Sinnlichkeit.
»Paß auf«, fuhr Cordula ungerührt fort, »ich komme dich morgen eine halbe Stunde früher abholen, wegen Gesichts- und Outfitkontrolle. Okay?« Bevor ich antworten konnte, schaltete meine Tochter Zoey sich in das Gespräch ein und Cordula ab.
»Mom, das nervt jetzt echt. Ich muß wirklich mit Lara sprechen. Die hat nicht nur diese Ätz-Mutter, sondern auch die totale Krise wegen der Sache mit ihrer voll unheilbaren Hautkrankheit.«
»Du meinst Pickel«, korrigierte ich und erntete nur ein entnervtes Grunzen.
»Echt lustig, Mom, du hast so was von keine Ahnung. Übrigens könntest du deine öden Hausfrauengespräche mit Psycho-Cordula wirklich tagsüber erledigen, wenn ich in der Schule bin.«
Bevor ich meiner Tochter ihre Frechheiten austreiben konnte, hatte sie längst auf Sendepause geschaltet. Statt Cordulas Stimme hörte ich nur noch den langgezogenen Signalton für freie Leitung.
Ich riß mir den klebenden Hörer diesmal aus der linken Handfläche, wusch Hände und Hörer im Bad und führte dabei ein klärendes Gespräch mit meinem Spiegelbild.
»Schminken! Blödsinn. Brauche ich nicht.« Schließlich sah ich insgesamt ziemlich unverändert aus. Brav, unverdorben, naives Seelchen … »Ich bleib’ mir eben treu. Jawohl«. Das erfüllte mich mit Stolz.
So lange, bis ich zu meinem Rotwein zurückkehrte, wieder in die Villosa-Bonbon-Dose griff und mir ein Stück kariertes Din-A4-Papier in die Hand fiel. Ich faltete den Bogen auseinander und las die Überschrift: »Meine Lebensliste« und dann: »Die folgenden Dinge habe ich in meinem Leben vor zu tun, zu erleben und zu erledigen – von Carolin Kaster.«
Das war ich. Vor meiner Hochzeit. Im zarten Alter von achtzehn. Ich zögerte, weiterzulesen. Dabei liebte ich Listen immer noch. Einkaufslisten, Wäschelisten, Checklisten. Listen beruhigten mich. Listen konnte ich abhaken. Das verschaffte mir in meinem Hausfrauendasein täglich kleine Erfolgserlebnisse. Listen säuberten mein Gehirn von irgendeinem Müll, an den ich dringend denken mußte. Listen schufen mir Platz für mein Kino im Kopf, nach dem ich so süchtig war. Dafür brauchte ich Listen. Aber nicht solche wie die, die ich jetzt in meiner Hand hielt. Sie weckte mich aus einem langen Dämmerschlaf der Seele und befreite mich aus einem Zustand wunschlosen Unglücks. Sie stürzte mich in einen Wirbelsturm verdrängter Leidenschaften, und dieser Wirbelsturm fegte so nachhaltig durch unsere Ikea-Idylle, daß am Ende kein Billy-Regal an seinem Platz bleiben sollte.
»Meine Lebensliste«, las ich noch einmal und dann:
1. Ein Studium von Architektur, Kunstgeschichte und Völkerkunde mit einem mehrfachen Doktor abschließen. Berühmt werden – und reich!
2. Im Heißluftballon über die Niagarafälle schweben, einmal in den Grand Canyon spucken, den Kilimandscharo besteigen, die Gorillas im Nebel besuchen, vor dem Tadsch Mahal Tango tanzen.
3. Mit einem anarchistischen, wildschönen, hochbegabten und eines Tages schwerreichen Künstler (z.B. Maler, Bildhauer) auf einer spanischen Finca, in einem italienischen Palazzo oder auf einer New Yorker Fabriketage mit Blick auf den Hudson-River leben.
4. Und abends bei Wein und Pasta über die Poesie, das Leben, Gott, Architektur, Kunst und die Welt philosophieren.
5. Danach mindestens dreimal die Woche voll verschärften, leidenschaftlichen, sinnesberauschenden Sex, nach dem mir mein Künstler jedesmal versichert, daß ich einzigartig begehrenswert bin, und er emotional, sexuell und intellektuell völlig von mir abhängig ist.
6. Außerdem unbeschränkten Zugang zu seinem millionenschweren Konto (falls ich nicht selber die Mio’s habe). »Liebling«, wird mein Künstler verzückt flüstern, »Geld interessiert mich nicht, gib du es aus.«
7. Ich schwöre, Greenpeace bekommt auch was ab!
Soweit die Pfantasiewelt einer Achtzehnjährigen.
Zurück in der Wirklichkeit, betrachtete ich – vom Rotwein inzwischen leicht benebelt – unser kreuzbraves Ikea-Himmelbett »Björndal« und krauste die Stirn. New York! Nie dagewesen. Leidenschaftlicher Sex! Ich konnte mich nicht mehr an das letzte Mal erinnern, nur noch an die ziemlich sprachlosen Routinenummern nach der Tagesschau.
Wann hatte ich diese Liste vergessen? Nicht, daß da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, ich war schon als Achtzehnjährige weit davon entfernt, eine männermordende, clevere blonde Schlampe zu sein. Vielmehr war ich eine kreuzbrave Musterschülerin aus der Provinz und – aus Solidarität mit den um 1980 aktiven Jammer-Feministinnen in lila Latzhosen – völlig ungeschminkt und unscheinbar.
Die gute, sanfte Carolin! Anders kannte mich niemand, weder mit achtzehn noch mit fünfunddreißig. Niemand wußte etwas von meiner inneren Rebellin, meiner lebensgierigen Freiheitsfanatikerin, meiner inneren Künstlerin. Hier, auf dieser Liste war sie verewigt. Ich hatte einmal Ehrgeiz gehabt, ich hatte Phantasie gehabt, ich hatte raus gewollt. Und es lediglich für drei Semester bis nach Köln geschafft und einmal bis Mallorca.
Der fast 35jährigen Provinzmutti aus Neuss am Rhein, die diese Liste las, wurde es noch sentimentaler zumute. Jeder Schluck Rotwein (Rioja von Aldi für DM 4,98) vertiefte das Seelenloch, in das sie hineinplumpste, um mehrere Meter. Diskussionen über Poesie, Kunst, Gott und die Welt. Pah! Die Wahrheit sah anders aus. Unsere Diskussionen gingen in etwa so: »Wo sind meine grünen Socken, Liebling?«
»Keine Ahnung! Schau mal in den Trockner.«
»Aber da muß ich ja bis in den Keller!«
»Ich geh’ ja schon und hol’ sie dir.«
Seufzend ließ ich das Blatt sinken und starrte in den bleigrauen, grieseligen Septemberhimmel. Typisch Niederrhein. Wer auf den deutschen Sommer schimpft, kennt den am Niederrhein nicht. Ich kannte ihn zur Genüge, denn mein Mann hielt nicht einmal viel von Reisen.
»Muß das sein? Das ganze Jahr über die elenden Geschäftsreisen, und dann soll ich auch noch in den Urlaub jetten? Am liebsten würde ich die Ferien in aller Ruhe zu Hause verbringen.«
Was wir regelmäßig getan hatten, während die Kinder bei meiner Mutter oder in Feriencamps urlaubten. Nein, weit war ich nicht über Neuss hinausgekommen. Außer einmal bis nach Mallorca. Mit meinem Traummann. Dr. Karsten Schaleen. Allerdings mit anderen Ergebnissen und anderem Ausgang als es auf der Liste stand. Scheiß-Liste.
Stand darauf vielleicht etwas von meiner ersten Schwangerschaft mit neunzehn, sofortiger Heirat und Studienabbruch? Nein. War etwa Janosch, der ebenfalls ungeplante Nachzügler erwähnt, der die Wiederaufnahme meiner Studien bis auf weiteres vereitelte? Nee. Genausowenig wie meine entsetzliche Schwiegermutter oder mein altersschwachsinniger Schwiegervater vermerkt waren, die inzwischen regelmäßig die Sommerferien und Weihnachten und Ostern und sämtliche gesetzliche Feiertage bei uns verbrachten, weil wir gnädigerweise IHR schönes Haus mit Rheinblick bei Neuss bewohnen durften. Auch unser darmkranker Mischlingshund Brownie war nicht aufgeführt, den ich mir ebensowenig ausgesucht hatte wie meine Schwiegereltern.
Zoey, die mich, seit sie laufen konnte, zur unfreiwilligen Mutter von Kaulquappen, Kröten, weißen Mäusen und Molchen gemacht hatte, hatte auch Brownie angeschleppt, um ihn, seine Bedürfnisse und seine Ausscheidungen bald darauf mir zu überlassen. Das Privileg aller Muttis. Wo es erstens um Essen, zweitens um Dreck aller Art und drittens um Schnupfen, Husten, Heiserkeit geht, sind wir gefragt. Wobei ich zur Rettung des Hundes sagen muß, daß er wenigstens kleine Anzeichen von Dank für meine Fürsorge zeigte.
Wie aufs Stichwort kratzte Brownie in diesem Moment an die Tür des Schlafzimmers und begleitete sich dabei mit herzzereißendem Jaulen. Das war’s. Ich verlor endgültig die Fassung. Niemand liebte mich – außer diesem Köter.
Gerührt hicksend und schluchzend und etwas angetrunken krabbelte ich zur Schlafzimmertür, griff von unten nach der Klinke und zog sie herab, stieß die Tür auf und prallte zurück. Brownie trug meine beste – und einzige – Perlenkette und war bombenfest in mein Hermés-Tuch – Duty-Free-Shop-Geschenk meines Mannes – gewindelt. Und das mit der Windel dürfen Sie so wörtlich nehmen, wie Brownie es bereits getan hatte.
»Janosch!« schrie ich mit letzter Kraft, während Brownie munter ins Schlafzimmer stürmte und es sich mit der patschnasser Windel im Bett bequem machte, um die Bißfestigkeit meiner Perlen zu testen. Knurrend verteidigte er seine Juwelen. »Verfluchter Köter!«
»Is’n los?« muffte beiläufig meine Tochter, während sie am Schlafzimmer vorbeischlurfte.
»Brownie hat das Bett naß gemacht, weil …«
»Warste wieder nicht Gassi mit ihm? Ziemlich Scheiße diese ganze Tierquälerei.« Vorwurfsvoll runzelte Zoey die Stirn. Seit einem Monat war sie von einer fanatischen Tier-Einsammlerin zur radikalen Veganerin mutiert. Das hieß: Sie aß keinen Fitzel Fleisch mehr, zwang mich, ihr nicht lederhaltige Schuhe aus England zu bestellen, verlangte, daß Welpe Brownie vegetarisch zu füttern sei und lehnte es aus ideologischen Gründen ab, ihn Gassi zu führen.
»Is’ nicht artgerecht, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Hunde müssen im Rudel leben, weg von Menschen. Jede Tierhaltung ist Tierquälerei. Da mach’ ich nicht mit.«
Vielleicht hatte sie damit ja recht, ich bezweifelte allerdings, daß irgendein wildes Rudel Brownies Vorliebe für »Caesar«-Häppchen in heller Soße ersetzt hätte.
In diese Gedanken versunken, verfehlte ich mal wieder den Moment einer Entgegnung auf Zoeys Frechheiten. So ging es mir oft, da ich so konfliktfreudig wie Bambi war. Erst als Zoey die unterste Stufe der Treppe erreicht und auf dem Weg zur Haustür war, fiel mir meine Erziehungsberechtigung wieder ein.
»Sag mal, wo willst du eigentlich jetzt noch hin?« rief ich ihr nach.
»Fresse!« rief sie zurück.
Was in diesem Fall keine rüde Beleidigung war, sondern ihr Freund, den ich nicht nur wegen seines Spitznamens befremdlich fand. Ich lehnte mich über die Brüstung der Galerie, die über der Eingangshalle schwebte.
»Um zehn Uhr bist du spätestens wieder hier«, befahl ich der Haustür, die bereits mit lautem Knall ins Schloß gefallen war. Nein, nicht einmal meine Tochter Zoey sah etwas anderes als die »gute, alte, sanfte Carolin« in mir. Seufzend machte ich mich
1. auf die Suche nach Reinigungsschaum und Schwamm,
2. nach neuem Bettzeug und
3. nach Janosch, um sein ohnehin schon zweiwöchiges Nintendo-Verbot um eine Woche zu erhöhen, weil er Brownie gewindelt und mein Telefon mit Klebstoff präpariert hatte.
Doch die Bestraferei fiel mir alles andere als leicht, nachdem er mir erklärt hatte, daß mit Brownies Windel sei nur ein Test gewesen, um mir das Gassi-Gehen zu ersparen. »Du wolltest doch in der alten Büchse nach Schulfreundinnen kramen, da hab’ ich gedacht, ich sag’ nix, weil Brownie so junkst, sondern zieh’ ihm was über.« Und die Idee mit dem Telefon habe er gehabt, als er mich nachmittags mit Staubsauger und Telefon in der Hand über eine Teppichkante stolpern sah. »Weißt du, Mama, da habe ich gedacht, wenn du dir den Hörer ans Ohr kleben könntest, würde so was nicht passieren.«
Janosch ist eins von den Kindern mit diesem leicht verhungerten Blick. Ich meine, er hat große, staunende Augen und ist so spillerig dünn, daß man auf seinen Rippen Akkordeon spielen kann – obwohl man bereits Tonnen von Vollwertkost, Fruchtzwergen und Kinderschokolade in ihn hereingestopft hat. Wenn so ein verhungertes Kind dann auch noch ein Meister des treuherzigen Blicks ist – rette sich wer kann, ich konnte es nie. Statt meinem Schlitzohr also eine allzu harte Standpauke zu halten, machte ich mich an die Säuberungsarbeiten im Schlafzimmer und hielt mir eine Standpauke über meine Erziehungsfehler. Hatte ich schon erwähnt, daß ich eine von diesen Friedfertigen bin?
Eine Viertelstunde später kam mein arbeitssüchtiger Mann von seinem Meeting mit den spanischen Geschäftspartnern heim und reagierte ungehalten.
»Mußt du die Betten unbedingt abends frisch beziehen? Du hast doch den ganzen Tag für so was Zeit. Richtig ungemütlich hier.«
Ich schloß haarscharf, daß sein Treffen nicht besonders erfolgreich verlaufen war und ließ ihn weiterschimpfen, während ich über den Traummann von meiner alten Liste nachdachte. Bildhauer oder Maler. Seufz! Wilde Liebesnächte auf einer spanischen Finca, zärtliche Gespräche bis ins Morgengrauen.
»Wenn du nur endlich mal lernen würdest, deine Zeit besser zu nutzen und einzuteilen«, knurrte mein Mann dazwischen. »Ist doch ganz einfach. Mach dir am Anfang der Woche eine Liste, und halte dich daran, anstatt dich mit tausend Merkzetteln ständig selbst zu blockieren. Eine einzige Liste reicht doch. Man muß sich nur daran halten.«
Genau! dachte ich und schwieg.
»Du bist ja schlimmer als meine Mutter«, brummelte er und verzog sich ins Bad. Ich glaube, dieser Satz war sein Todesurteil. Kurz bevor ich mich schlafen legte, stellte ich ihn an die Wand, riß die vollautomatische Guzzi hoch und durchsiebte ihn und seinen gestreiften Seidenpyjama mit 180 Schuß aus meinem Magazin. Rein gedanklich, versteht sich. Meine Tagträume dienen hin und wieder auch der Abfuhr aggressiver Energien.
Nach der standrechtlichen Erschießung gab ich meinem Mann einen Kuß und sagte »Gute Nacht, Liebling«.
»Gute Nacht? Wie wäre es …« Seine Hand tastete sich unter mein Nachthemd und – ganz nach Schema F – zunächst zu meiner linken Brust, zweimal streicheln, dann nach rechts, einmal kneifen, dann …
Nein, nicht heute nacht! dachte ich trotzig. Ich war ausnahmsweise nicht in meiner üblichen »make-love-not-war«-Stimmung. Was ich heute – ein Jahr später – als erste Nachwirkung der verhängnisvollen Liste deute.
»Schatz«, hauchte mein Mann programmgemäß in mein Ohr. Ich stellte mich kalt. »Na, nun komm schon, Liebling«, säuselte er unter Auferbietung all seiner Verführungskünste. »Jetzt, wo wir so gut wie alleine sind. Janosch spielt im Keller Nintendo, und Zoey schläft bei ihrer Freundin und …«
»Wie bitte?« Hellwach setzte ich mich auf und knipste das Licht an.
Ärgerlich schaute mein Mann zu mir hoch. »Muß das sein? Ich hatte wirklich einen verdammt harten Tag!«
»Wie kommst du darauf, daß Zoey bei ihrer Freundin schläft?«
»Na, weil du es ihr erlaubt hast. Hat sie mir gesagt, als ich sie auf dem Weg hierher traf. Weshalb ich eben dachte, daß du Lust auf ein bißchen mehr als einen Gute-Nacht-Kuß hast, dazu die frisch bezogenen Betten …«
Ich hörte gar nicht mehr hin, schwang die Beine über die Bettkante und griff nach dem Telefon.
»Wen rufst du denn jetzt noch an?«
»Fresse«, antwortete ich resolut. Mein Mann schaute mich an, als habe er soeben den Yeti entdeckt. »Falls es dich interessiert, so heißt der neue Freund deiner Tochter, und ich habe allen Grund anzunehmen, daß er die Freundin ist, von der sie dir erzählt hat. Und dann gute Nacht!«
»Niemals würde Zoey mich so frech anlügen!« entrüstete sich mein Mann. Nur das starke Geschlecht kann so gutgläubig sein.
»Fresse«, murmelte ich noch mal im Geiste, während ich die »Undenk-Bar« anrief. So hieß ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, das vor allem für sozial benachteiligte Jugendliche gedacht war und in dem meine Tochter regelmäßig ehrenamtlichen Thekendienst leistete. So muffig Zoey zu mir war, so großherzig war sie gegenüber allen Außenseitern unserer Gesellschaft. Was ich im Grunde so rührend fand wie die haushaltstechnischen Erfindungen meines Sohnes. Ich war auch ein wenig geschmeichelt, weil ich in Zoeys Sozialtick mich selber wieder fand – die ehemals friedensbewegte Weltverbessererin. Aber leider hatte Zoeys großes Herz auch Platz für Fresse, und der war sozial so was von benachteiligt und so wenig friedfertig, daß er bereits auf eine Liste von Straftaten zurückblicken konnte, die Billy the Kid alle Ehre gemacht hätte. Eine Liste, die mich ausnahmsweise nicht beruhigte.
Die Stimmung, die mich seit dem Fund meiner Lebensliste begleitete, verhalf mir zu ungewohnter Autorität.
»Guten Tag, hier spricht Carolin Schaleen«, blaffte ich in den Hörer. »Schicken Sie bitte sofort meine Tochter nach Hause. Sie ist minderjährig, und ihr Vater ist Besitzer eines Karate-Studios. Außerdem betreiben wir eine Kampfhundzucht.«
Ich legte auf. Karsten, mein Mann, rang nach Atem. »So kenne ich dich ja gar nicht, Carolin.«
»Dann wird es Zeit, daß du mich so kennenlernst«, sagte ich nur knapp, warf mir einen Bademantel über und ging nach unten, um meine Tochter in Empfang zu nehmen.
Eine halbe Stunde später war Zoey zu Hause. Allein. Allerdings mit einer neuen Hiobsbotschaft: »In den Herbstferien mache ich mit Fresse Motorradurlaub in Frankreich.«
»Im Leben nicht«, sagte mein Mann und ging sofort wieder zu Bett, um sich von diesem Schock zu erholen und mich meinen Mutterpflichten zu überlassen. Schließlich hatte ich ja in meinem Leben sonst nichts zu tun, während er morgen wieder Kloschüsseln an den Mann bringen mußte.
»Vergiß das mit dem Urlaub«, begann ich. »Du mußt doch einsehen, daß dein Vater und ich uns große Sorgen um dich machen, wenn du mit Leuten wie …«
»Hey, keine Vorurteile! Hast du selber immer gesagt. Ich liebe Fresse, und wir fahren auf seiner Honda nach Frankreich.«
»Mit Motorrädern werden Katzen, Hunde, Kröten überfahren.
Kannst du das als Veganerin verantworten?« Jaja, die gute alte Friedensbewegte in mir kam wieder zum Vorschein und untergrub die Autorität der Rebellin.
»Fresse fährt vorsichtig.«
»Die Franzosen essen Pferdefleisch«, versuchte ich es weiter auf die clever-sanfte Tour.
»Wenn ich einen dabei erwische, haut Fresse ihn platt.«
»Findest du das etwa artgerecht.«
»Findest du dich etwa komisch?« muffte Zoey zurück und drückte sich äußerst unfreundlich an mir vorbei Richtung Treppe.
Es langte. Ich spürte förmlich, wie sie ihren Triumph genoß. Diese ständigen Mutter-Tochter-Kabbeleien waren ihr neuestes Hobby. Okay, Pädagogen nennen so was »Grenzen austesten«. Ich wußte nur, daß sie meine Grenze nun verletzt hatte.
»Hör gut zu, Fräulein. Ich sag es nur einmal: Du fährst nicht, basta.« Mit diesen Worten drückte ich mich an meiner Tochter vorbei, joggte mit ungeahntem Elan die Treppe hoch und öffnete und schloß unsere Schlafzimmertür mit einem lauten Knall.
»Carolin!« schimpfte mein Mann.
»Klappe!« sagte ich laut und vernehmlich.
»Ist das vielleicht der Bruder von Fresse? Was ist denn nur mit dir los heute abend?« kam es verblüfft aus dem Bett.
»Nichts, mir geht nur dieser ewig gleiche Scheiß von Hausarbeit und Kindererziehung gewaltig auf den Geist. Dabei muß man ja verblöden!«
Mein Mann schnaubte verächtlich. »Du hast gut reden. Glaubst du vielleicht, das Kacheln und Toilettenschüsseln intellektuell anregend sind?«
»Warum hast du dich dann für die Toiletten und gegen ein eigenes Architekturbüro entschieden? Du warst so begabt, du hattest soviel Phantasie.«
»Carolin, bitte, das ist doch nun wirklich ein alter Hut, das müssen wir doch wohl nicht mehr durchdiskutieren. Wenn du meinen heutigen Tag erlebt hättest, würdest du dein Hausfrauendasein jedenfalls als Paradies auf Erden empfinden.«
»Ach ja?« gab ich gereizt zurück.
»Was hast du bloß? Du wolltest das doch immer so! Jedenfalls hast du nie etwas anderes behauptet, oder?«
Damit hatte er recht. Natürlich hatte ich – die Friedfertige, die Sanftmütige, die Möchtegern-Madonna, die er dereinst in Palma fotografiert hatte – nie etwas anderes behauptet. Schließlich war ich damals vollkommen verliebt gewesen in Karsten Schaleen und bald darauf vollkommen schwanger. Mein Mann hatte meine innere Lebenskünstlerin und Rebellin nie richtig kennengelernt. Ich selbst hatte sie ja auch erst heute abend wieder entdeckt.
Ich schwieg also. Beleidigt. Auch deshalb, weil kaum eine Sekunde später ein wohliges Schnarchen verriet, daß der Toilettenhändler und Ex-Traummann Karsten Schaleen die Diskussion für uninteressant und meinen Anflug von Rebellion für beendet hielt. Er sollte sich irren.