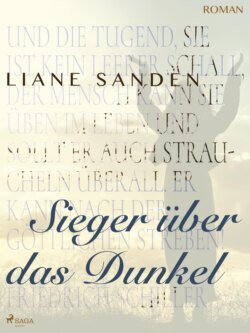Читать книгу Sieger über das Dunkel - Liane Sanden - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie ersten Tage hatte sich Heinz Mühlensiefen im Werffenwerk recht unbehaglich gefühlt. Hier imponierte niemandem die Tatsache, dass er der Sohn seines Vaters war. Bei einigen der Herren, hatte er ein leises ironisches Lächeln zu sehen geglaubt, als er davon sprach. Sehr bald hatte er sich davon überzeugt, hier war der Name nichts, die Leistung alles. Er war doch schon in der Welt herumgekommen. Aber eine so eigenartige Auffassung, wie in den Werffenwerken war ihm noch nicht begegnet. Als zukünftiger Inhaber der Mühlensiefenwerke hatte er immer mit einem gewissen Hochmut auf die kleinen Angestellten herabgesehen. Die hatten doch kein anderes Interesse, das war bisher seine feste Überzeugung, als für ein möglichst hohes Gehalt so wenig sich anzustrengen, wie nur möglich. Hier schien das anders zu sein. Als es 5 Uhr schlug — Dr. Mühlensiefen hatte vorsorglich seinen Platz schon aufgeräumt — sah er mit Erstaunen, dass die meisten der Herren keinerlei Eile zeigten. Wer mit seinem Pensum fertig war, freilich der rüstete sich zum Gehen. Aber die anderen taten so, als ob es ganz unwichtig sei, dass die Sirene das Schlusszeichen gegeben hatte.
Mühlensiefen beobachtete, wie ein Kollege einen anderen fragte: „kommen Sie mit? Ich will mit dem dreizehner Zug fahren.“
Und der andere hatte ohne aufzublicken gesagt:
„Nein, ich habe noch ein bis zwei Stunden zu tun.“
Und was Mühlensiefen dabei am meisten gewundert hatte, das schien den anderen Herren so selbstverständlich, dass man sich gar nicht weiter darum gekümmert hatte.
Auch das Verhältnis der männlichen Angestellten zu den jungen Mädchen setzte Mühlensiefen in Erstaunen. Es waren hübsche Mädels darunter. Auch solche, die sicher einem kleinen Flirt nicht abgeneigt waren. Dr. Heinz Mühlensiefen verstand sich darauf. Aber nirgends hatte er etwas anderes beobachten können, als Kameradschaft, unbefangenes Zusammenarbeiten von Menschen, die an der gleichen Sache wirkten. Dass die technischen Einrichtungen der Werffenwerke geradezu vorbildlich waren, war Mühlensiefen schon in den ersten Stunden aufgefallen. Aber dass auch die Menschen so stark von dem Werk beeinflusst wurden, das wollte Mühlensiefen nicht in den Kopf.
„Schön dumm“, hatte Heinz Mühlensiefen gedacht. „Wie die sich alle von dem Begriff Werffenwerk einfangen lassen. Das könnte mir nicht passieren.“ Und dann fühlte er, wie ihm die Schamröte ins Gesicht stieg. Hatte er, Dr. Heinz Mühlensiefen, sich nicht in diesem Augenblick zu der Auffassung bekannt, derwegen er immer auf die „kleinen Angestellten“ herabgesehen hatte?
Mühlensiefen versuchte vergeblich sich von dem Einfluss frei zu machen, den die Werffenwerke auch auf ihn übten. Und er beschloss einmal zu ergründen, worin dieser Zauber lag.
Er arbeitete nun schon mehrere Wochen in den Werffenwerken. Er betrachtete seine Tätigkeit als die eines Volontärs, der zu seiner weiteren Ausbildung sich im Werk etwas umzusehen hatte. Seinem klugen Blick entging es nicht, dass die Werffenwerke vorbildlich eingerichtet waren und arbeiteten. Jeder Mensch stand hier an seinem Platze. Jeder Mensch leistete Gutes. Das Arbeitstempo war besonders beschwingt. Aber nicht gehetzt. Allen, vom Direktor herunter bis zum kleinsten Angestellten, sah man an, das Werffenwerk war nicht nur der Brotgeber, sondern auch etwas, dem man sich innerlich verbunden fühlte. Diese Entdeckung beschäftigte Heinz Mühlensiefen. Es gab also Menschen, die eine Sache um ihrer selbst willen taten und liebten. Eigentlich hätte er es all den kleinen Buchhaltern, Hilfschemikern, Laborantinnen und Stenotypistinnen nicht verdenken können, wenn sie gerade nur ihre Pflicht getan hätten. Denn was hatten sie schliesslich für ein Interesse daran, den Gewinn für den Inhaber der Werffenwerke durch ihre eigene erhöhte Arbeit zu steigern? Aber als er einmal die Sozialabteilung kennenlernte, wurde er anderer Meinung. Hier lag der Schlüssel zu der steten Arbeitswilligkeit des Personals und auch der Schlüssel zum Verständnis für die beinahe väterliche Stellung des Geheimrats Werffen zu jedem im Werk. Hier sah Heinz Mühlensiefen zum erstenmal, dass Reichtum auch eine Verpflichtung gegenüber andern bedeutete. Das gab ihm innerlich einen Ruck. Er hatte bisher das Werk seines Vaters nur als Quelle zu einem bequemen, leichtsinnigen Leben betrachtet. Und selbst der Vater, obwohl seinen Angestellten gegenüber von Pflichtbewusstsein erfüllt, tat nicht annähernd das, was hier in den Werffenwerken für die Angestellten geschah. Heinz Mühlensiefen war klug genug, um zu erkennen, dass Wohltun unter Umständen mehr Zinsen tragen könnte als Kapital. Unwillkürlich wurde er von dem freudigen Arbeitseifer hier angesteckt. Und bald war es ihm dank seiner Begabung gelungen, hier und da kleine Verbesserungen vorzuschlagen, die bald in die Praxis umgesetzt wurden. Nach kurzer Zeit schon konnte Geheimrat Werffen dem alten Kommerzienrat Mühlensiefen einen vertraulichen Brief schreiben, in dem er sich in lobenden Worten über die Begabung von Heinz Mühlensiefen äusserte. Der alte Kommerzienrat Mühlensiefen war über diesen Bericht um so erfreuter, als sein Sohn Heinz ihn mit Mitteilungen nicht allzusehr verwöhnte. Vor allen Dingen hätte er gern etwas über den privaten Verkehr seines Jungen bei Werffens gewusst. Aber darüber schwieg sich sowohl Heinz wie der Geheimrat aus. So sandte denn Kommerzienrat Mühlensiefen einen Brief an seinen Sohn, den Heinz eines Morgens erhielt. Nach Mitteilungen über den geschäftlichen Zustand der Fabriken schrieb Kommerzienrat Mühlensiefen:
„Ich bedaure, mein Junge, dass Du Deine mir genügend bekannte Schreibfaulheit immer noch beibehältst. Vor allen Dingen hast Du mir noch gar nichts über Deinen Verkehr bei Werffens berichtet. Vergiss nicht, dass Du als künftiger Inhaber unserer Firma Beziehungen pflegen musst. Du weisst doch, dass ich Veranlassung habe, Geheimrat Werffen besonders dankbar zu sein, der sich in einem kritischen Moment mit dem ganzen Gewicht seiner Person für mich eingesetzt hat. — Wie hat sich denn eigentlich seine Tochter Annelore entwickelt? Ich habe sie als auffallend hübsches Kind in Erinnerung, das mir immer etwas bedrückt schien. Solche Menschen sind für Herzlichkeit doppelt dankbar! Grüsse den Geheimrat und Annelore von mir, wenn Du wieder bei ihnen bist. Mit bestem Gruss
Dein Vater.“
Heut schien es Mühlensiefen im Werk wieder zum Auswachsen langweilig. Missmutig sah er auf die Papiere, die der Prokurist ihm zur Bearbeitung übergeben hatte. Es war eine Rückfrage notwendig. Mühlensiefen wollte sich etwas Abwechslung verschaffen und ging deshalb selbst in die Filmabteilung hinüber, statt einfach zu telefonieren. Im Treppenhaus begegnete er Fränze Müller, seiner netten Bekannten aus der Untergrundbahn. An die hatte er gar nicht mehr gedacht. Das war ein munterer kleiner Kerl. Ein netter Zeitvertreib, solange Lou nicht da war.
„Sehe ich Sie endlich mal wieder, Fräulein Müller? Ich habe mich immerfort schon nach Ihnen umgesehen.“
„Ach, das tut mir aber leid“, sagte Fränze Müller spöttisch lachend. „Dass es solche Einrichtungen wie Post und Fernsprecher gibt, ist Ihnen wohl bisher noch gar nicht aufgefallen, Herr Doktor? Und dass Sie Ihre Wette verloren haben, auch nicht?“
„Um Gottes willen, machen Sie’s nur gnädig. Mit einem armen verlassenen Junggesellen darf man nicht so scharf ins Zeug gehen. Aber ins Kino darf man mit ihm gehen.“
„Darüber liesse sich reden, Herr Doktor. Natürlich nur, wenn Sie versprechen, schön brav zu sein.“
„Unerhört brav, Fräulein Müller. Ich bin bereit es zu beschwören.“
„Nee, schwören Sie lieber nicht. Wohin wollen Sie mich denn einladen?“
„Wohin Sie wollen, wenn wir nur dann noch gemütlich ein Glas Wein trinken gehen.“
„Gegen diese Verbesserung des Abendprogramms habe ich nichts Grundsätzliches einzuwenden. Jetzt muss ich aber weiter.“
„Um 7 Uhr am Alsterpavillon, Fräulein Fränze?“ Vergnügt lächelnd setzte Mühlensiefen seinen Weg fort. Glück gehabt, dachte er. Das Mädel hat etwas Prickelndes an sich. Mosseux? Nein, das war die kleine Müller nicht. Aber ein spritziger, leichter Rheinwein!
*
Seit dem letzten Spaziergang mit ihrem Vetter hatte Annelore Gerhard kaum noch zu Gesicht bekommen. Wenn sie ihn einmal traf, so war er immer, wie er sagte, ausserordentlich mit seiner neuen Erfindung beschäftigt. Er machte dann das sogenannte „Arbeitsgesicht“, wie sie es schon vom Vater her kannte und vor dem sie etwas Bangigkeit empfand. Es war so eine gewisse Falte in der Stirn und ein Abwesendsein, das man selbst unter der Liebenswürdigkeit sehr deutlich spürte. Da war es besser, Gerhard nicht mit sich selbst zu belästigen. Man konnte ihm ja auch nicht viel sagen. Denn diese eigentümliche Befangenheit ihm gegenüber wuchs mehr und mehr. Dazu kam ein gewisses Trotzgefühl. Wenn eben Gerhard um seiner Arbeit willen alles andere vergass und gar nicht mehr daran dachte, ob sie ihn brauchte oder nicht, dann wollte sie sich ihm nicht aufdrängen. Aber weh tat es, sehr weh! Wie allein sie doch war!
Immer weniger gelang es ihr, die Interessen ihrer Freundinnen zu teilen, um so mehr, als ihre Lieblingsfreundin Dorothee in einer Pension in Genf weilte. Immer weniger, das oberflächlich-vergnügte Leben der jungen Mädchen ihrer Kreise mitzumachen. In die Gesellschaftsschicht des Geheimrats Werffen war die Not und Sorge, der jetzigen Zeit bis an die Töchter noch nicht herangekommen. Die Männer freilich spürten allenthalben die Unsicherheit der gesamten Wirtschaftsverhältnisse. Und in einem Hause, in dem die Frau und Mutter Mittelpunkt war, mochte es wohl sein, dass man diese Sorgen auch von der Frau mit tragen liess. Bei Werffens aber hütete der Geheimrat sich ängstlich, seine Annelore mit irgend etwas zu beschweren. Auch die Freundinnen aus der Schulzeit lebten glücklich und sorglos dahin. Nur Annelore war innerlich weder glücklich, noch sorglos. Sie sprach nicht von sich. Nur, sie sah sehr blass aus. Etwas Müdes lag auf dem schmal gewordenen Gesichtchen. Sogar der Geheimrat bemerkte es, trotzdem er, in den neuen Unternehmungen beschäftigt, für alles Ausserberufliche wenig Aufmerksamkeit hatte.
„Fehlt dir etwas, Kind?“ hatte er beim Abendbrot gefragt. „Du siehst so schlecht aus. Brauchst du Zerstreuung? Ich sehe jetzt so selten deine Freundinnen bei dir. Lade sie dir doch ein. Oder willst du reisen? Ich hörte gestern von Senator Stübbe, dass er seine Familie für ein paar Wochen an die Riviera schicken will. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und ich bitte Frau Stübbe, dich mitzunehmen. Sie wird es sicher gern tun. Ich glaube, du hast Luftveränderung nötig.“
„Nein, nein“, hatte Annelore entschieden gesagt und den Vater flehend angesehen, „ich brauche nichts. Ich bin ganz gesund. Mir fehlt nur —“
Aber sie hatte nicht zu Ende gesprochen, was ihr fehlte. Plötzlich war sie vom Tisch geflohen und tränenüberströmt in ihr Zimmer gelaufen.
Kopfschüttelnd und ernstlich besorgt hatte der Geheimrat seiner einzigen nachgesehen. Noch am selben Abend rief er den alten Hausarzt, Sanitätsrat Brambach, an, um seinen Besuch zu erbitten. Aber unglückseligerweise musste Dr. Brambach am nächsten Morgen zu einer Familienfeier verreisen. Er schlug seinen Vertreter Dr. Veldten vor:
„Nehmen Sie Veldten, lieber Geheimrat“, sagte er, „er wohnt in Ihrer Nähe. Ich kenne ihn genau. Denn er hat eine Zeitlang bei mir gearbeitet. Er ist tüchtig und modern. Er will vor allem, genau wie ich es tue, nicht die Krankheit, sondern den Menschen heilen. Ich habe die Überzeugung, er hat die richtige Art für unsere kleine Annelore.“
Am nächsten Tage wurde Dr. Fritz Veldten in die Villa Werffen gerufen. Brambachs Empfehlung erfreute ihn sehr. Geheimrat Werffen selbst führte Veldten in Annelores Zimmer.
Mit müdem Gesicht reichte Annelore Dr. Veldten die Hand, der herzlich sagte:
„Gnädiges Fräulein, wir, das heisst meine Frau und ich, haben schon oft von Ihnen gehört, Ihr Vetter, Gerhard Hessenbrock, mein liebster Jugendfreund, hat uns schon sehr oft von einer Kusine Annelore erzählt.“
Annelores Gesicht wurde lebhafter. „Ach Gerhard“, sagte sie und verstummte dann sofort. Dr. Veldtens Blick streifte Annelore kurz. Ihm war die plötzliche Lebhaftigkeit Annelores bei der Nennung von Gerhard Hessenbrocks Namen nicht entgangen und ebenso nicht ihr plötzlich verlegenes Verstummen.
„Aha“, dachte er, „sollte ich schon auf den Kern der Krankheit gekommen sein? Vielleicht hat dies kleine Mädel einen Herzenskummer, der sich im Körper auswirkt.“ Jedenfalls fühlte er, er hatte Annelores Vertrauen einfach durch die Tatsache seiner Freundschaft mit Gerhard Hessenbrock gewonnen. Freiwillig gab Annelore ihm auf seine vorsichtigen Fragen Auskunft und liess sich willig untersuchen.
Im Nebenzimmer wartete Geheimrat Werffen. Bald kam Dr. Veldten wieder herein.
„Haben Sie bei meinem Kinde etwas feststellen können, Herr Doktor. Ist es etwas Ernstes?“
„Keinerlei Grund zur Beunruhigung, Herr Geheimrat. Organisch ist bei Ihrem Fräulein Tochter alles in Ordnung. Ich habe den Eindruck, dass Ihr Fräulein Tochter von irgend etwas bedrückt ist.“
„Aber wovon denn“, fragte der Geheimrat erstaunt, „sie hat doch alles, was sie gewünscht, Vergnügungen, keine Sorgen. Sie kann tun und lassen, was sie will.“
Veldten lächelte fein:
„Vielleicht ist es gerade das, Herr Geheimrat, dass Fräulein Annelore keinerlei Sorgen hat. Oder besser gesagt, keine Pflichten. Ich glaube, sie fühlt sich zwecklos auf der Welt. Und bei ihrem tiefen Gemüt wird das nicht das richtige sein. Wenn sie einen festen Pflichtkreis hätte, Aufgaben, Sorgen, wie sie ein junges Mädchen aus kleinen Verhältnissen hat, vielleicht wäre sie gesünder.“
Etwas ärgerlich sagte der Geheimrat: „Aber ich kann sie doch nicht deswegen in irgendein Büro stecken. Ich weiss nicht, was das jetzt mit den jungen Mädchen ist. Früher hatten sie auch keinen Beruf. Früher heirateten sie eben. Und damit war alles in Ordnung.“
„Ja, Herr Geheimrat, auch darin ist es heute anders. Heutzutage heiratet ein junges Mädchen doch nur, wenn sein Herz spricht. Das Leben ist eben anders geworden. In Ihrem Berufsleben doch auch. Glauben Sie nicht, dass auch die Frauen sich ändern, im Laufe der Zeit sich anders entwickeln?“
„Sie mögen recht haben, Herr Doktor. Man kommt gar nicht recht dazu, darüber nachzudenken vor lauter beruflichen Sorgen. Was machen wir aber praktisch mit meiner Tochter? Ich hatte ihr eine Reise vorgeschlagen. Aber sie brach bei dem Gedanken in Tränen aus. Sie will offenbar nicht von hier weg.“
Dr. Veldtens Gedanken gingen wieder zu Gerhard Hessenbrock. Vielleicht war auch der der Grund von Annelores Weigerung, fortzureisen. Aber er hielt sich nicht befugt, eine solche vage Vermutung dem Geheimrat mitzuteilen. So meinte er denn:
„Wenn Fräulein Annelore hier bleiben will, so halte ich es für richtiger, ihr nachzugeben. Eine Reise können wir uns immer noch aufsparen, wenn wir sehen, dass ihr Zustand sich nicht bessert. Vorläufig möchte ich ein paar Höhensonnebestrahlungen vorschlagen, die ich morgen beginnen will. Dann werden wir weitersehen.“
Der Geheimrat war einverstanden. Und Veldten unterrichtete Annelore von dem, was er beabsichtigte. „Seien Sie bitte heute nachmittag um fünf Uhr bei mir, gnädiges Fräulein“, sagte er, „ich werde Sie vor und nach den Bestrahlungen sehen. Die Behandlung selbst übernimmt meine Assistentin, nämlich meine Frau. Aber vorweg muss ich Ihnen eins sagen. Sie sind nicht krank, Fräulein Werffen. Ihnen fehlt nur der Wille, gesund zu sein. Ohne die Hilfe des Patienten aber kann der Arzt nur sehr wenig tun. Sie müssen helfen. Sie müssen frisch werden wollen. Wir werden schon herausbekommen, woran es liegt, dass Sie nicht wollen. Wenn der Wille zur Gesundheit dauernd fehlt, kann der Mensch krank werden. Das werden Sie Ihrem Vater nicht antun! Wenn also nicht um Ihrer selbst willen, dann wollen Sie um Ihres Vaters willen!“
*
Punkt fünf Uhr trat Annelore in das Wartezimmer Dr. Veldtens. Eine Minute später kam Frau Brigitte in einer grossen weissen Schwesternschürze.
„Fräulein Werffen? Oh, ich kenne Sie schon durch Ihren Vetter, unsern lieben Freund.“
Ihre Augen sahen herzlich in das blasse Mädchengesicht. Und Annelore erwiderte nach scheuem Aufblick diesen Blick strahlend. Im ersten Augenblick fasste sie Vertrauen zu dieser jungen, blühenden Frau mit den warmen, braunen Augen und der klugen Stirn.
„Also kommen Sie, Fräulein Werffen“, sagte Frau Dr. Veldten, „mein Mann hat mich schon über alles orientiert. Bitte machen Sie sich frei und legen Sie sich hier auf das Sofa unter die Lampe. Liegen Sie bequem? Hier, bitte, die Schutzbrille.“
Nachdem Brigitte Veldten Annelore gebettet hatte, schaltete sie die Lampe an und machte sich vorher selbst die Schutzbrille über die Augen. „So, Fräulein Veldten, und nun wollen wir die paar Minuten zu einem recht netten Plausch benutzen. Wir wollen doch nicht wie die Ölgötzen stumm dasitzen. Erzählen Sie mir einmal etwas recht Vergnügtes aus der letzten Zeit. Oder bin ich alte Frau für Sie eine grässliche Respektsperson, mit der man nicht frei vom Herzen weg reden kann?“
Annelore musste lachen:
„Sie sind doch keine alte Frau, Frau Doktor.“
„O bitte, Fräulein Werffen, ich bin ja schon sooo lange verheiratet“, lachte Frau Brigitte, „schon über ein halbes Jahr.“
Annelore lachte noch lauter:
„Das ist ja entsetzlich lange! Da müsste ich ja eigentlich tatsächlich einen ungeheuren Respekt vor Ihnen haben. Aber ich habe ihn wirklich nicht, denn Sie sehen trotz der langen Ehe aus, wie ein ganz junges Mädel. Ich könnte schon Vertrauen zu Ihnen haben, Frau Doktor.“
„Das ist ein gutes Wort, Fräulein Annelore. Also, dann erzählen Sie mal. Wie leben Sie so?“
Annelore schwieg einen Augenblick. Die alte Scheu wollte sie wieder überkommen. Aber die Stimme Frau Brigittes hatte etwas so Weiches, dunkel Beschwichtigendes, dass Annelore ganz warm ums Herz wurde. Die Sehnsucht, von sich zu sprechen, wurde übermächtig.
„Einsam lebe ich, Frau Doktor. Meine einzige Freundin ist in Genf in Pension und weibliche Verwandte habe ich gar nicht. Ich habe nur den Vater und meinen Vetter — das heisst, den habe ich ja auch gar nicht“, fügte sie schnell hinzu. Etwas Wehes lag in ihrem Ton.
Ganz zart strich Frau Brigitte über Annelores weiches Haar.
„Aber Kindchen, haben Sie denn gar keine Frau in Ihrer Nähe, mit der Sie sich mal richtig ausplaudern können?“
Es klang wie ein Schluchzen, als Annelore antwortete:
„Ach nein, das ist es ja eben. Ich bin immer allein. Papa ist ja reizend zu mir, aber der steckt doch den ganzen Tag im Werk. Manchmal sehnt man sich direkt nach einem Menschen, und dann dehnt sich der Tag bis ins Endlose.“
Wieder strich Frau Brigitte zärtlich über Annelores Kopf. Aber ihre Hand kam nicht weit. Zaghaft tastete Annelores Hand nach Brigittes Fingern.
„Sehen Sie, Frau Doktor“, jetzt unterdrückte sie ein Schluchzen, „das erlebe ich heute zum erstenmal, dass eine Frau mir so über den Kopf streicht.“
Mit einer schnellen Bewegung stellte Frau Brigitte die Lampe ab. Dann umfasste sie das schluchzende Mädchen.
„Aber Kindchen, liebes, wenn Sie wirklich so allein sind, kommen Sie in Zukunft zu mir! Wir werden gute Freunde werden. Wenn mein Mann unterwegs ist, dann bin ich auch allein. Aber ich hab’ zu tun. Wissen Sie was, Fräulein Annelore, wenn ich zu tun habe, dann helfen Sie mir. Und wenn Sie es gut machen, dann bekommen Sie zur Belohnung einen schönen Kuss. So. Hier haben Sie einen auf Vorschuss!“