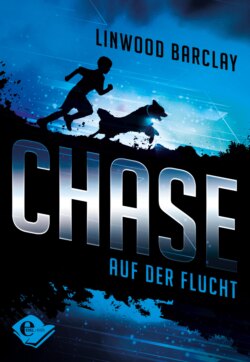Читать книгу Chase - Linwood Barclay - Страница 5
Prolog
ОглавлениеKaum hatte der Weißkittel das Zimmer mit den Käfigen betreten, ahnte der Gefangene, was der Mann im Schilde führte: Er wollte ihn töten.
Vielleicht erkannte er es an dem Lächeln, das der Weißkittelmann ihm zur Begrüßung durch die Gitterstäbe zugeworfen hatte. Der Mann lächelte so gut wie nie. Jetzt musterte er den Gefangenen durch seine übergroße Brille mit dem schwarzen Rand. Es war ein über fünfzigjähriger Weißkittel mit spärlichem grauem Haar, ein dürrer, blasser Mann, der tagein, tagaus vor dem Computer saß oder die Arbeiten im Labor überwachte, wenn dort eines der vielen Experimente durchgeführt oder ein Stück Technik installiert wurde. Mit dem Sicherheitsausweis, der an einem Schlüsselband um seinen Hals hing, konnte er sich frei im Gebäude bewegen.
Auf der Chipkarte war ein Foto von ihm zu sehen und sein Name zu lesen: SIMMONS.
Ja, vielleicht sollte der Gefangene ihn lieber beim Namen nennen. Es gab nur einen Simmons, aber mehr als genug Weißkittel – Weißkittelmänner und -frauen. Über die Jahre hatte der Gefangene etliche von ihnen kennengelernt, Daggert und Wilkins und noch viele andere. Und dann war da die rothaarige Frau, die nur Madam Director genannt wurde.
Dem Gefangenen waren die Weißkittel schon lange nicht mehr geheuer. Sie waren keine guten Menschen. Okay, sie gaben ihm zu fressen und kümmerten sich um ihn, sie trainierten ihn. Aber sie hatten ihn nicht lieb.
Nur zwei Weißkittel, ein Mann und eine Frau, waren dem Gefangenen wie echte Freunde vorgekommen. Aber die beiden hatte er schon lange nicht mehr gesehen, seit gut zwölf Monaten nicht mehr. Der Gefangene hatte sie wirklich sehr gemocht. Er hatte gerne ihren Geschichten gelauscht, und wenn sie ihn gestreichelt und liebevoll am Kopf getätschelt hatten, war ihm ganz warm geworden.
Den beiden war etwas Schlimmes zugestoßen. Da war sich der Gefangene ziemlich sicher.
Aber darüber konnte er jetzt nicht nachdenken. Vor ihm stand Simmons.
Dem Gefangenen war etwas aufgefallen: Simmons hatte beide Hände in den Taschen seines langen weißen Kittels vergraben, als versteckte er dort etwas. Und der Gefangene hatte so eine Ahnung, was es sein könnte.
Sicherheitshalber zog er sich tiefer in den Käfig zurück.
Auch die anderen Gefängnisinsassen waren misstrauisch geworden. In diesem Raum waren noch neun andere untergebracht, jeder in einem eigenen Käfig an der Wand, fünf in der oberen Reihe, fünf unten. Drei Häftlinge fauchten und bellten und trotteten aufgeregt im Kreis, auch wenn sie in ihrem Kerker nur in einem sehr engen Kreis trotten konnten. Simmons’ merkwürdige Ausstrahlung ließ sie genauso unruhig werden wie den Gefangenen.
Der Gefangene wünschte, er hätte sich mit den anderen unterhalten können und gewusst, was ihnen durch den Kopf ging. Doch die Weißkittel achteten sehr genau darauf, dass ihre Versuchsobjekte nicht auf fortschrittlichere Weise miteinander kommunizieren konnten – denn hätten sie mentale Verbindungen knüpfen können, hätten sie sich womöglich gegen ihre Wärter zusammengeschlossen. Natürlich konnten sich die Gefangenen noch auf traditionelle Art ausdrücken, sie konnten wimmern und knurren, mit dem Schwanz wedeln und die Nackenhaare sträuben. Aber eigentlich waren sie doch schon viel weiter.
Simmons näherte sich dem Käfig bis auf einen halben Meter und lächelte schon wieder. Zwischen seinen oberen Schneidezähnen hing ein Fetzen Spinat. »Wie geht’s uns heute?«, fragte er. »Wie geht’s meinem Kumpel?«
Der Gefangene starrte ihn bloß an und überlegte. Wäre es nicht klüger, erst mal nicht aggressiv zu werden? So zu tun, als würde er nichts Böses ahnen? Andererseits war Simmons nicht naiv. Obwohl der Gefangene offiziell ein fehlerhaftes Versuchsobjekt war, ein Misserfolg, wusste Simmons genau, wie intelligent er war.
Schließlich hatten die Weißkittel höchstpersönlich all die Implantate in seinem Körper entwickelt und installiert. Sie hatten sie gleich dort drüben auf der anderen Seite des Zimmers eingebaut, auf einem abgewandelten Operationstisch mit grellen Leuchten darüber und einem Dutzend Monitoren an der Wand dahinter. Nur weil diese Menschen ihn sorgfältig programmiert hatten, war er so viel mehr als ein normaler Hund. Mit seinen neuen Begabungen und Fähigkeiten war er dem Tier, als das er zur Welt gekommen war, um Lichtjahre überlegen. Als kleiner Welpe hätte er sich nie träumen lassen, was er eines Tages alles können würde: Er konnte lesen, verschiedenste Sprachen verstehen, Daten analysieren – und einer viele Milliarden schweren Geheimorganisation als Augen und Ohren dienen.
Als Welpe hatte er eigentlich nur davon geträumt, Eichhörnchen zu jagen.
Die Weißkittel wussten von den bemerkenswerten Fähigkeiten des Gefangenen. Aber sie wussten auch von seinen gravierenden Fehlern. Sosehr sie sich auch bemüht hatten, das Versuchsobjekt war nicht mehr zu retten. Kein Stück Technik konnte seine tierischen Instinkte unterdrücken. Und wenn sie ihm noch so viel Software installierten, gegen seine Hundenatur kamen sie nicht an. Vor allen Dingen ließ er sich viel zu leicht ablenken. Man konnte sich nie darauf verlassen, dass er sich auf seine aktuelle Aufgabe konzentrierte. Würden die Weißkittel ihn beispielsweise losschicken, um eine von Terroristen gelegte Bombe aufzuspüren, die Tausende Menschen töten könnte, und in der Nähe würde zufällig jemand einen Ball werfen … dann würde er die Mission abbrechen und diesem hinterherrennen.
Und deshalb, das ahnte der Gefangene, würden ihm die Weißkittel etwas Schlimmes antun.
»Schau mal, was ich für dich habe«, sagte Simmons und zog die linke Hand aus der Tasche. Darin hielt er etwas Kleines, Dunkles, kaum größer als eine Murmel.
Ein Leckerli.
Ein fleischiges, salziges Leckerli.
Der Gefangene bemerkte, wie sich seine Zunge aus dem Maul schob und über seine Lefzen und seine Schnauze glitt. Es passierte ihm einfach, ganz unabsichtlich. Die Weißkittel wussten alles über ihn, und natürlich kannten sie seine Vorliebe für diese Leckerlis – das war eine seiner vielen Schwachstellen. Jetzt nutzten sie sie aus.
Fast hätte der Gefangene sich gezwungen, gleichgültig dreinzublicken, als interessierte er sich nicht für das Leckerli. Aber sollte er nicht lieber reagieren wie immer? Ja, das wäre die beste Taktik. Er wedelte mit dem Schwanz.
Soll er doch denken, ich würde mich freuen.
Das Leckerli zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt, steckte Simmons die Hand durch das Gitter.
»Komm doch mal her«, lockte er. »Das wird dir schmecken. Ich weiß doch, wie du die Dinger immer runterschlingst. Mmmmmhhhh, wie gut das riecht! Ich könnte glatt selbst reinbeißen. Das sind doch deine Lieblingsleckerlis.«
Der Gefangene hob den Kopf, bis er fast an die Käfigdecke stieß, und schnüffelte. Stimmt, das war eindeutig eine seiner Lieblingssorten. Als sich seine Nasenlöcher unmerklich weiteten, um den Duft besser in sich aufzunehmen, konnte er das Leckerli fast schmecken.
Er wedelte weiter mit dem Schwanz, schmiegte sich aber immer noch an die hintere Käfigwand.
»Was ist denn, Kollege?«, fragte Simmons. »Keinen Hunger? Ich bin doch extra vorbeigekommen, um dir eins zu bringen. Und ich hab sogar noch mehr davon in der Tasche.«
Simmons’ rechte Hand steckte tatsächlich noch in der Tasche. Wieder blähten sich die Nasenlöcher des Gefangenen. Er sog das Aroma des schmackhaften Bröckchens auf.
Da stimmte etwas nicht. Plötzlich war der Gefangene sich absolut sicher. Mit dem Leckerli stimmte etwas nicht.
Es roch irgendwie seltsam.
Er durfte es nicht fressen. Aber wenn er es nicht tat, würde der Weißkittel ahnen, dass er durchschaut war.
Also trottete der Gefangene nach vorne, reckte seinen pelzigen Hals zum Käfiggitter und nahm das Leckerli vorsichtig zwischen die Zähne.
»Gut gemacht!«, rief Simmons. »Mmmh, schmeckt das lecker!«
Der Gefangene musste sich sehr zusammenreißen, sonst hätte er das Bröckchen mit ein paar gierigen Schmatzern verspeist. Doch er konnte es auch nicht ewig zwischen den Zähnen halten. Er musste dem Weißkittel etwas vorspielen.
Deshalb mahlte er ein paarmal mit den Kiefern und schloss das Maul – und klemmte das Leckerli dabei unter seiner langen, feuchten, rosafarbenen Zunge ein. Dort würde es sich allerdings in kurzer Zeit von selbst auflösen. Wenn er das zuließ, hätte er es auch gleich hinunterschlucken können.
Was er aber nicht riskieren durfte.
»Wirst schon ein bisschen müde, oder?«, sagte Simmons. »Ja, es kann nicht mehr lange dauern, Chip …« Er lächelte mitleidig. »Ganz ehrlich, für mich ist das eigentlich noch schlimmer als für dich. Wir zwei sind doch richtig dicke Freunde geworden. Wir haben doch so viel zusammen erlebt. Und manchmal stelle ich mir immer noch vor, alles wäre nach Plan gelaufen und wir hätten einfach weitermachen können …«
Aha, dachte der Gefangene. Ich soll also müde werden.
Den Gefallen konnte er dem Weißkittel tun. Wenn er schon ein Betäubungsleckerli im Maul hatte, sollte er auch ein bisschen Müdigkeit vortäuschen. Aber noch blieb er stehen und legte den Kopf schief, als interessierte er sich tatsächlich dafür, was der Mann ihm da erzählte.
»Ist wirklich schade um dich, Chipper. Du bist ein prächtiger Hund. So ein feines Kerlchen wie dich hätte jeder gerne als Haustier. Aber bei uns reicht das eben nicht. Und ich kann dich auch nicht einfach irgendeiner Familie schenken, damit du dort wie ein normaler Köter aufwächst. Nicht mit dem ganzen Kram, den wir in dich eingebaut haben.«
Der Gefangene namens Chipper blinzelte. Für eine halbe Sekunde ließ er die Augen zufallen und den Kopf nach unten sacken.
»Du weißt ja …«, flüsterte Simmons und lehnte sich zum Gitter, damit ihn die anderen Gefängnisinsassen nicht hören konnten. »Wir müssten dich erst aufschneiden und das ganze Zeug wieder aus dir rausholen, und danach wärst du sowieso tot. Also machen wir’s eben anders, so leid’s mir auch tut. Schau doch, wie müde du schon bist. Wieso haust du dich nicht hinten aufs Ohr? Dann kann ich den Käfig aufsperren.«
Der Gefangene wich zwei Schritte zurück und kauerte sich auf den Boden, die Vorderbeine ausgestreckt, den Kopf gesenkt. So signalisierte er Simmons, dass von ihm nichts zu befürchten war.
Der Käfig wurde geöffnet, die rostigen Scharniere quietschten. Einige der anderen Hunde jaulten und bellten noch immer. Es stank nach Fell und Angst.
»Braver Junge«, sagte Simmons. »Es tut auch gar nicht weh, das verspreche ich dir. Es geht so schnell, du wirst es gar nicht richtig mitkriegen.«
Gleichzeitig zog Simmons die rechte Hand aus dem Kittel. Darin hielt er einen schmalen, zylinderförmigen, etwa fünfzehn Zentimeter langen Gegenstand.
Mit glitzernder Spitze.
Der Gefangene wusste, was das war. Jeden Moment würde Simmons ihm die Nadel tief in den hinteren Oberschenkel stoßen und den Kolben mit dem Daumen herunterdrücken.
Und ihm einen sanften, sekundenschnellen Tod spritzen.
Ja, der Gefangene war hochintelligent. Er wusste über all das Bescheid. Simmons selbst hatte es ihm beigebracht, er und die anderen Weißkittel hatten seine Speichermodule mit diesen und ähnlichen Informationen gefüllt. Und trotzdem hielten sie sich am Ende immer noch für tausendmal klüger. Trotzdem hatten sie nicht damit gerechnet, dass er ihre Pläne durchschauen würde.
Sie hatten nicht die geringste Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Betont langsam richtete Chipper sich auf, um Simmons keine Angst einzujagen, und stellte seine Hinterbeine dicht vor die Rückwand des Käfigs.
»Schön stillhalten«, sagte Simmons zärtlich und hob die Hand mit der Spritze. Die andere streckte er nach vorne, um den Gefangenen festzuhalten.
Da rammte der Gefangene die Hinterbeine gegen die Wand und katapultierte sich durch die Käfigtür wie ein pelziges Geschoss.
Eine Millisekunde nachdem das vergiftete Leckerli unter seiner Zunge herausgeflutscht war, schlossen sich seine Kiefer um Simmons’ Handgelenk. Er grub seine Zähne in das Fleisch, bis die Spritze aus Simmons’ Hand rutschte und beinahe lautlos auf den Fliesen landete.
Simmons selbst wurde dafür immer lauter. Als die Zähne des Gefangenen seine Haut durchbohrten und eine Schlagader aufrissen, brüllte er wie am Spieß. Dann kippte er um und hielt sich die verletzte Hand, während sich der Gefangene weiter in seinem Arm verbiss.
»Hilfe!«, schrie Simmons.
Die anderen Hunde rasteten aus. Ihr zorniges, übermütiges Kläffen hallte durchs Zimmer wie eine hysterische Symphonie.
In der Luft hing Blutgeruch.
Aus dem Lärmen der anderen Hunde hörte der Gefangene viel mehr Gefühle heraus, als seine ahnungslosen Kerkermeister wahrnehmen konnten. Das Bellen und Fauchen verriet ihm, dass sie wütend waren und verängstigt – doch es war auch eine Menge hämische Freude dabei. Alle Gefängnisinsassen verachteten ihre Herrchen und Aufseher, diese skrupellosen Menschen, die nichts anderes im Sinn hatten, als sie zu Hightech-Sklaven zu machen.
Chipper lockerte seinen Griff um Simmons’ Handgelenk und widmete sich stattdessen dem Sicherheitsausweis am Schlüsselband. Als er danach schnappte, zuckte Simmons panisch zusammen, aber Chipper zerbiss bloß den elastischen Stoff. Die Chipkarte schlidderte über den Boden.
»Hilfe!«, schrie Simmons noch einmal und blickte hinauf zu der Überwachungskamera in der Ecke. Doch jetzt, mitten am Tag, würde dort wahrscheinlich niemand zusehen. Das hoffte Chipper jedenfalls. Wurde dieser Raum nicht vor allem nachts überwacht, wenn sich die Agenten anderer Länder oder irgendeiner konkurrierenden Behörde leichter in die Anlage einschleichen und die Tiere stehlen – oder töten – könnten? Außerdem war das Getöse der kläffenden und knurrenden Hunde so laut, dass von Simmons’ Hilferufen wahrscheinlich nicht viel zu hören war.
Mit den Zähnen bekam Chipper die Chipkarte nicht zu fassen, sie lag zu flach am Boden. Also schleckte er sie mit der Zunge auf wie einen Cracker. Danach manövrierte er sie im Maul nach vorne, klemmte sie behutsam zwischen die Vorderzähne und rannte zur Tür, während Simmons sich weiter am Boden krümmte, eine Hand um seinen verletzten Arm gekrallt. Das Lesegerät hing in einem Meter Höhe neben der Tür. Wie oft hatte der Gefangene beobachtet, wie die Weißkittel ihre Chipkarten benutzten? Man musste bloß damit vor einem grünen Lichtpunkt herumwedeln, der in etwa so groß war wie eine Bleistiftspitze, das war alles.
Der Gefangene stellte sich auf die Hinterbeine, die Vorderpfoten an die Wand gestützt, und hielt die Karte vor das Licht. Prompt glitt die Tür zur Seite.
Als er hindurchhuschte, warf er noch einen Blick zurück – Simmons stemmte sich gerade mühsam hoch.
»Halt!«, rief er und stolperte dem Gefangenen hinterher. »Komm zurück, du missratener Köter, oder –«
Doch noch bevor Simmons die Tür erreicht hatte, schnappte sie ihm vor der Nase zu, und ohne Chipkarte konnte er sie nicht öffnen.
Chipper raste den langen Gang entlang. Er kannte den Weg ins Freie, schließlich wurden er und die anderen ständig nach draußen gebracht, sie brauchten viel Auslauf und Training. Am Ende des Flurs, kurz vor der nächsten Tür, bremste er ab, doch der Marmorboden war über Nacht gewischt worden, und so rutschte er einfach weiter und donnerte gegen die geschlossene Pforte. Um ein Haar wäre ihm die Chipkarte aus dem Maul gefallen. Er rappelte sich auf, stellte sich erneut auf die Hinterbeine und schwenkte den Ausweis vor dem grünen Lichtpunkt.
Die Tür öffnete sich.
Nun befand er sich im weitläufigen Eingangsbereich. Viele Menschen marschierten zügig von A nach B, Weißkittel und Anzugträger, alle versunken in ihre üblichen Aufgaben. Das war Alltag im Institut. Hier wurde nicht getrödelt. Hier hatte man immer zu tun.
Der Haupteingang stand offen. Das ist das Tor zur Echten Welt, dachte der Gefangene. Die beiden großen Glastüren waren zur Seite gefahren, und kühle, frische Luft wehte herein und trug eine Million Düfte an seine Schnauze. Jeder Einzelne davon roch nach Freiheit.
Alle Menschen erstarrten. Ein frei laufendes Versuchstier ohne Leine und Wärter – das war ein ungewöhnlicher Anblick. Und ein Hund mit blutverkrusteter Schnauze und einer Chipkarte zwischen den Zähnen war noch ungewöhnlicher.
Vielleicht denken sie, die Weißkittel hätten mir ein neues Kunststück beigebracht.
Den offenen Ausgang fest im Blick, erhöhte Chipper das Tempo. Als ihm die Karte aus dem Maul fiel, achtete er kaum darauf. Er brauchte sie nicht mehr.
»Haltet ihn auf!«, brüllte jemand.
»Schnappt euch den Köter!«, rief ein anderer. »Er darf nicht entkommen!«
»Knallt ihn ab!«, schrie der Erste.
»Spinnst du?«, erwiderte eine dritte Person. »Der ist ein Vermögen wert!«
Chipper hatte keine Zeit, einen Blick über die Schulter zu werfen und zu überprüfen, ob ihn schon jemand mit der Waffe anvisierte. Er musste rennen.
Vor ihm schloss sich langsam die Tür. Irgendwer hatte auf den Notknopf gehämmert.
Der Gefangene legte noch einen Zahn zu.
Der Spalt wurde schmaler und schmaler.
Im letzten Augenblick quetschte Chipper sich hindurch. Seine Schwanzspitze wurde in der Tür eingeklemmt, doch mit einem kurzen Ruck riss er sich los.
Der Gefangene war kein Gefangener mehr. Er war frei.
Doch er wollte nicht einfach nur frei sein. Er hatte etwas Wichtiges zu erledigen.
Chipper musste den Jungen finden.