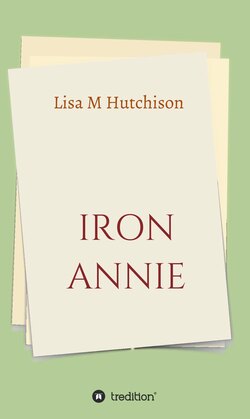Читать книгу Iron Annie - Lisa M Hutchison - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеProlog
Zsofia linste um die Ecke des Stationszimmers im Pflegeheim, „Guten Morgen meine Liebe.“
„Wünsche ich Ihnen auch“, antwortete ich. „Es ist aber noch nicht Zeit für Ihre Augentropfen.“
„Ich weiß“, lächelte sie, „ich wollte nur ‚Hallo‘ sagen und sehen, wie es Ihnen geht.“
„Danke, alles gut bei mir. Wie geht es Klara heute?“
„Sie ruht sich aus – sie ist noch etwas schwach seit der Operation, aber es geht ihr gut genug, dass sie nachher zum Mittagessen herunterkommt.“ Sie winkte kurz und verschwand wieder.
Ich arbeitete bereits einiger Zeit in der Pflegeabteilung einer jüdischen Seniorenresidenz in Toronto, und die beiden Nemeth-Schwestern gehörten zu meinen Lieblingsbewohnern. Sie hatten mich direkt ins Herz geschlossen, vielleicht wegen meines ungarischen Nachnamens, und wir plauderten bei vielen Gelegenheiten miteinander. Beide waren Damen der alten Zeit, stets selbstsicher, gut gekleidet und gepflegt. Sie waren gebildet und standen noch mitten im Leben. Keine der beiden hatte je geheiratet und sie waren unzertrennlich. Jede hatte ihr eigenes Apartment in der Residenz, aber sie verbrachten dennoch die meiste Zeit gemeinsam. Klara hatte kürzlich eine neue Hüfte erhalten, die Operation aber gut überstanden. Ich wandte mich wieder meiner Arbeit zu, beschäftigt damit, die Medikamente auszuteilen, Termine zu organisieren und verärgerte Bewohner zu beruhigen, und so ging der Morgen rasch vorbei.
Als ich in einem der Aufenthaltsräume saß, um mein belegtes Brot zu essen, näherte sich Benny mit einem Stirnrunzeln. Er schien immer schlechte Laune zu haben und heute war keine Ausnahme. „Haben Sie gestern ferngesehen?“, fragte er ärgerlich. „Sie müssten doch wissen, was Ihre Leute uns angetan haben!“
Er bezog sich auf meine deutschen Wurzeln. Ich seufzte; Benny war ein Unruhestifter. „Benny, ich war damals noch nicht einmal geboren und Sie sollten nicht unschuldige Leute für vergangene Sünden verantwortlich machen.“
„Ich habe meine gesamte Familie da drüben verloren!“, brodelte es aus ihm hervor und sorgte bei mir für Verwirrung.
„Benny, Sie wurden hier geboren und Ihre Familie besucht Sie regelmäßig, warum also sagen Sie so etwas?“
„Ach so, ich glaube, das habe ich vergessen“, war seine kleinlaute Antwort. „Aber es hätte ja so sein können“, fügte er selbstgerecht hinzu.
„Nun, Benny, wenn Sie das irgendwie beruhigt, ich habe den Großteil meiner Familie in diesem entsetzlichen Krieg verloren und ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie keine Unwahrheiten mehr über Ihre Familie verbreiten würden.“ Ich war wütend auf ihn; er schien es zu genießen, mich regelmäßig zu piesacken.
„Alles klar, Zeit fürs Mittagsessen“, sagte er und schlurfte von dannen.
Zsofia, die Klara zum Esszimmer half, hatte Bennys Bemerkungen aufgeschnappt. „Ich muss mit Benny mal ein ernstes Wörtchen sprechen und ihm meine Geschichte erzählen“, sagte sie zu mir. „Es ist eine wahre Geschichte und keine ausgedachte.“
„Warum eigentlich kommen Sie nicht einmal für einen Tee an Ihrem freien Tag vorbei,“ fügte sie hinzu, „Klara und ich erzählen Ihnen unsere Geschichte. Ich sollte Benny ebenfalls einladen, vielleicht kann er dann noch die eine oder andere Sache lernen.“
„Abgemacht.“ Lächelnd verabredeten wir uns für den folgenden Dienstagnachmittag zum Teekränzchen.
Die nächsten Tage verliefen ereignislos und am Dienstagnachmittag erreichte ich Zsofias Apartment mit einem Strauß Blumen und mit Vorfreude darauf, etwas Zeit mit den entzückenden Schwestern zu verbringen. Klara saß gemütlich zurückgelehnt auf einem Liegesitz mit einem Kissen im Rücken und ich konnte meinen Augen nicht trauen – da saß Benny, auf dem Sofa, und nippte an seinem Tee.
Zsofia goss mir Tee aus einem silbernen Samowar ein und reichte ein paar selbstgemachte Kekse herum.
„Nun, Benny“, sage sie, „du magst denken, was du willst, aber bitte unterbrich uns nicht, während wir Dir unsere schier unglaubliche Geschichte erzählen.“
Wir machten es uns gemütlich und warteten auf den Bericht der Schwestern über ihren Lebensweg.
„Wir wurden in Budapest geboren“, begann Zsofia. „Unser Vater war ein Anwalt und wir hatten ein angenehmes Leben; unsere Mutter erledigte die Hausarbeit – sie hatte mit fünf Kindern genug zu tun –, wir gingen in die Schule, an hohen Feiertagen in die Synagoge, hatten viele Freunde–“
„Die meisten waren keine Juden“, unterbrach sie Klara.
„Das stimmt, meine beste Freundin Anna war Römisch-Katholisch“, lächelte Zsofia. „Alles in allem ein recht normales Leben einer durchschnittlichen Familie. Dennoch herrschten in ganz Europa nach dem Ersten Weltkrieg große politische Unruhen und die Kommunisten, Faschisten und Nationalsozialisten stiegen besorgniserregend schnell auf. In Deutschland kam Hitler an die Macht, in Italien Mussolini und in Russland Stalin. Die Welt wurde zu einem dunklen und furchterregenden Ort.“
Zsofia hielt inne, um unsere Teetassen aufzufüllen und Klaras Kissen aufzuschütteln. Benny knabberte an seinem Keks und sagte kein Wort.
„Klara, kannst du ein bisschen weitererzählen, während ich zu Atem komme?“, fragte Zsofia ihre jüngere Schwester.
„Ja, natürlich, drágám, ich versuche mal, mich so gut es geht, an alles zu erinnern.“ Und so erzählte sie weiter: „Eines Tages kam unser Vater nach Hause und sagte, er habe seine Arbeit verloren. Gefeuert, weil er Jude war. Mutter schien deswegen nicht sonderlich beunruhigt zu sein und schlug ihm vor, er solle sich Arbeit bei einer anderen Kanzlei suchen oder sogar seine eigene eröffnen. Wie dem auch sei, er konnte keine Arbeit finden und eines Nachts kam die Geheimpolizei an unsere Tür und nahm uns alle fest.“
Hier verschluckte sich Klara und Zsofia musste wieder übernehmen. „Sie brachten uns in verschiedene Lager – glücklicherweise blieben Klara und ich zusammen. Wir sahen unsere Eltern nie wieder und auch die Jungs fanden wir nie mehr.“
Wir saßen still da und dachten an den Schrecken, den diese beiden Damen durchlitten, hatten.
Nach einer längeren Pause fuhr Zsofia fort: „Aus irgendeinem Grund kamen wir also nach Lettland und wurden in ein Arbeitslager geschickt. Eine unserer Aufgaben war, die Landebahn des Flughafens in Riga von Schnee zu befreien sowie die Flughalle und die Toiletten zu reinigen.“
Ich hielt den Atem an und starrte sie an, erinnerte ich mich doch gerade an eine Geschichte, die mir mein Vater über zwei junge Frauen erzählt hatte. War das überhaupt möglich? Wie wahrscheinlich war so etwas? Ich konnte kaum erwarten, dass sie fortfuhren.
„An einem verschneiten Tag,“ übernahm Klara wieder, „wurde uns gesagt, dass wir den Schnee auf der Landebahn räumen sollten. Es war harte Arbeit und uns war schrecklich kalt in unseren Sommerkleidern und Sandalen. Plötzlich brüllte uns ein Soldat an, dass wir einen Eimer und Lappen holen und in ein Flugzeug einsteigen sollten, um dort etwas zu reinigen. Wir beeilten uns – immerhin würde es, so dachten wir, im Flugzeug zumindest ein bisschen wärmer sein. Außerdem waren wir neugierig, wie ein Flugzeug von innen aussah, denn wir hatten noch nie eines gesehen“, kicherte Klara.
Da übernahm Zsofia erneut. „Wir stiegen die Stufen hinauf und betraten ein sehr sauber aussehendes Flugzeug und waren verwirrt – was sollten wir hier noch reinigen? Als wir uns umsahen, erblickten wir eine sehr schick gekleidete Dame, die vorne im Flugzeug saß. Und eine Familie mit einigen Kindern, die sich gerade auf den Sitzen niederließen. Der Pilot kam an Bord und bugsierte uns schnell in das Badezimmer. Nun, es war nicht wirklich ein Badezimmer, eher ein kleiner Schrank mit einem Eimer mit Deckel und einem winzigen Waschbecken. Ich werde nie verstehen, wie wir beide überhaupt dort hineinpassen konnten.“ Die beiden kicherten, bevor sie weitererzählten.
„Der Pilot deutete auf eine Reisetasche auf dem Toilettendeckel und bedeutete uns, indem er auf unsere Körper und Füße zeigte, dass wir dort Kleidung finden würden und uns etwas überwerfen sollten. Wir verstanden nicht recht, was wir tun sollten, aber er trieb uns zur Eile und so taten wir wie geheißen. Die Reisetasche enthielt glücklicherweise einen langen Mantel und schlechtsitzende Stiefel für Klara sowie einen Rock, einen Pullover und Socken für mich. Allerdings keine Schuhe. Wir hielten den Atem an, als ein zweiter Pilot die Tür öffnete und uns hinausschubste, während andere Leute das Flugzeug bestiegen. Er zeigte uns unsere Sitze, schloss die Tür ab und sprintete in das Cockpit. Das Flugzeug war bereit zum Abflug.“
Bennys Mund stand weit offen und ich war sprachlos. Zsofia deutete auf Benny und sagte ernst: „Es gibt überall gute Menschen. Um genau zu sein, sind die Guten den Schlechten zahlenmäßig überlegen – denk immer daran!“
Benny nickte bloß.
„Bitte, erzählen Sie weiter“, bat ich. „Was geschah dann?“
„Nun“, sagte Klara, „jung zu sein und in einem echten Flugzeug zu fliegen war sehr aufregend für uns. Wir hatten keine Ahnung, wohin wir flogen, genossen aber die paar Stunden Ruhe und Frieden. Der erste Pilot kam heraus, um die Passagiere zu begrüßen, und hieß uns gleichermaßen willkommen, als ob wir zahlende Fluggäste wären. Außerdem hielt er uns ein wunderschönes Paar Stiefel für Zsofia hin, die ihr recht gut passten. Es war so verwirrend und wir wussten nicht, was wir von all dem halten sollten. Wir sprachen ein wenig Deutsch und er sagte uns, dass wir nach Barcelona flögen und dass wir an Bord bleiben sollten, bis es völlig leer sei. Es war richtig aufregend – wir waren noch nie in Spanien gewesen und fragten uns, was uns dort wohl erwartete.
Wie es uns eingetrichtert war, blieben wir nach der Landung zurück, bis der Pilot kam und uns holte. Er brachte uns zur Flughalle – gemeinsam mit der Familie und den Kindern aus dem Flugzeug –, wo wir herausfanden, dass die Reisetasche der Mutter gehörte. Der Pilot hatte sie sich ‚ausgeborgt‘ und selbstverständlich verlangte sie ihre Kleidung zurück. Wir umarmten uns und wünschten einander viel Glück, als wir uns trennten. Sie waren anscheinend auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, wo sie Verwandte hatten.
Jedenfalls brachte uns der Pilot zu einem jüdischen Joint-Distribution-Committee-Zentrum in Spanien, wo er uns alles Gute wünschte und verschwand.“
Zsofia übernahm. „Er sagte mir mit einem verschmitzten Grinsen, dass die Stiefel Eva Braun gehört hätten. Ich war fassungslos und hatte keine Ahnung, wie er an sie gekommen war.“
Hier brachen alle in Gelächter aus. Sie lachten, bis ihnen die Bäuche schmerzten, und Benny gluckste: „Du hättest sie behalten sollen, jetzt könnten sie gutes Geld wert sein!“ Und sie lachten erneut laut los.
„Von dort wurden wir in ein Flüchtlingszentrum gebracht, damit unser Fall bearbeitet werden konnte und wir irgendwann Papiere erhalten würden. Ohne dass wir wussten, wo wir schlussendlich landen würden, reisten wir nach Portugal und von dort aus nach Brasilien.“
Zsofia erklärte weiter, dass wegen des Drucks vonseiten Deutschlands die Anzahl der Juden, die nach Spanien einreisen durften, von 1942 bis 1944 auf weniger als 7.500 reduziert worden war, obwohl die spanischen Konsulate 4000 bis 5000, für die Ausreise lebenswichtigen Ausweisdokumente, an Juden in ganz Europa aushändigte. Portugal, ein neutrales und alliiertenfreundliches Land, erlaubte vielen tausenden Juden die Durchreise zum Hafen von Lissabon. Eine Menge amerikanischer und französischer jüdischer Organisationen halfen den Flüchtenden, einmal in Lissabon angekommen, in die USA und nach Südamerika auszureisen.
Kurz darauf hatte das amerikanische Rote Kreuz einen unserer in Toronto lebenden Cousins ausfindig gemacht, und so ließen wir uns in Kanada nieder. Unser Cousin half uns, so gut er konnte, und bald fanden wir Arbeit und begannen unser neues Leben in Kanada.“
Beide Schwestern sahen erschöpft aus und ich schlug vor, dass sie sich ausruhen und wir an einem anderen Tag weitermachen sollten. Benny schaute ernst drein, erhob sich, klopfte mir sanft auf die Schulter und verließ das Apartment.
„Ich hoffe, er hat heute etwas gelernt“, kommentierte Zsofia und umarmte mich fest.
Ich ging tief in Gedanken versunken heim und suchte nach einem Foto meines Vaters, einem in seiner Lufthansa-Uniform, und brachte es den Schwestern am nächsten Tag mit.
Sie starrten das Foto ungläubig an und riefen aus: „Das ist der Pilot! Das ist er, er hat uns gerettet – wie sind Sie an sein Bild gekommen?“
Ich erklärte Ihnen, dass dies mein Vater sei, und die Zeit schien für einen Moment stillzustehen, bevor wir alle gleichzeitig losplapperten.
Was für ein unglaublicher Zufall des Schicksals!
Es erübrigt sich zu sagen, dass ich bald von allen Bewohnern wie eine nahe Verwandte behandelt wurde, nachdem Benny sichergestellt hatte, jedem einzelnen von dieser unglaublichen Geschichte zu berichten.
*Mein Vater, der stille Held!
Wie so viele andere Bücher begann dieses hier mit einer Idee, die sich zu einem schriftlichen Bericht über das Leben meiner Eltern entwickelte, dann zu einem Manuskript und schlussendlich zu einem Buch. Man mag versucht sein, es als „biographische Fiktion“ zu betiteln, aber es ist viel mehr als das. Alle beschriebenen Ereignisse – und es gab derer noch viele, viele mehr, die ich hätte einbeziehen können – basieren auf wirklichen Geschehnissen. Alle Dialoge wurden im Stil und Kontext verfasst, wie meine Eltern miteinander und mit mir und meinen Geschwistern sprachen.
Bei der Recherche zu ihrer Geschichte traf es mich, als völlig Vater-fixiertes Kind, wie eine Offenbarung, dass meine Mutter und Großmutter die wahren Heldinnen der Geschichte sind. Keine Frau sollte jemals durchmachen müssen, was sie erlebt hatten. Wie es so ist in Zeiten eines Krieges, wurden die Frauen zurückgelassen, damit sie sich in unmenschlichen Zuständen um die Kinder und Alten kümmerten – sie müssen deshalb als die wahren Heldinnen anerkannt werden. Meine Mutter war wahrlich eine Heldin!
Ich werde meinen Eltern für ihre Liebe ewig dankbar sein.
Meine Dankbarkeit gilt aber auch einigen weiteren Menschen, die es mir ermöglicht haben zu schreiben. Zuallererst, mein geliebter Ehemann, Robert. Seine endlose Unterstützung und die vielen Jahre, in denen er mich ermunterte, meine Geschichte aufzuschreiben, können nicht in Worte gefasst werden.
Dann ist da Matthew Godden, mein wundervoller Lektor: Seine Begeisterung und Hilfe waren unschätzbar wertvoll für mich.
Und zu guter Letzt, Marilyn, meine Freundin, „proofreader, cheerleader and enthusiastic supporter“.
An euch alle mein zutiefst empfundenes „Thank You!“