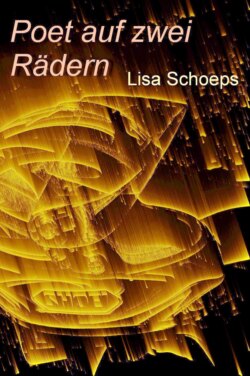Читать книгу Poet auf zwei Rädern - Lisa Schoeps - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеRamona und ich stiegen ins Auto, kurbelten die Fenster nach unten, um die Wärme entweichen zu lassen. Die Jungs waren noch mit Anziehen beschäftigt. Micha schloss den Kinngurt seines Helms und setzte sich auf sein Motorrad, startete die Maschine und wendete.
Tom zog den Reisverschluss seiner dünnen Jacke über der Arbeitsuniform zu. Ein Handschuh war herunter gefallen, er ging um sein Motorrad herum und hob ihn auf.
Die vertraute Ruhe in der kleinen Straße wurde durch das kernige Röhren der Motoren unterbrochen. Für uns klang es wie Musik. Ich drehte am Ende der Sackstraße um. Wir winkten noch mal zum Abschied und bogen in Richtung Hauptstraße ab. Am Marktplatz mit der Kirche und dem Wirtshaus vorbei, bogen wir auf die B17 Richtung Süden. In der Gegenrichtung war viel Verkehr. Typisch Freitagnachmittag und Berufsverkehrszeit.
In unsere Richtung war es ruhiger, es waren immer wieder größere Lücken im Verkehr. Mit Tempo 90 schwammen wir im Verkehr mit. Ramona und ich fuhren mit meinem Golf ein Stück hinter den Motorrädern. Nebenbei liefen im Radio die Nachrichten, es wurde wieder über Reagans Besuch in Berlin und die daran geknüpften Erwartungen gesprochen, aber auch über die Ausschreitungen. „…Es war ein Tag, den viele Berliner im Gedächtnis behalten haben: West-Berlin stand gleichsam vor dem Bürgerkrieg. Es war der Höhepunkt schwerer Auseinandersetzungen mit der Hausbesetzer-Szene, die beim Reagan-Besuch ihren Antiamerikanismus brutal austobte….“ Das Ganze sollte als die "Schlacht am Nollendorfplatz" in die linke Geschichtsschreibung eingehen. Dann kam die Meldung, dass Curd Jürgens gestorben sei. Schade ich mochte ihn als Schauspieler. Der Wetterbericht versprach, dass das Hochdruckwetter anhalten sollte. Hoffentlich!
Bei den ersten Klängen von „Bohemien Rhapsodie“ dachte ich, „Endlich mal etwas Vernünftiges und nicht nur dieses Neue Deutsche Welle Gedudel!“ Oder noch schlimmer Nicole, sie hatte vor kurzem mit „Ein bisschen Frieden“ den Grand Prix de Eurovision gewonnen, und der Song wurde im Radio rauf und runter gespielt. Ich dachte an das Mädchen mit den langen, blonden Haaren, dem altmodischen schwarzen Kleid mit weißen Tupfen und dem großem Kragen und der weißen Gitarre - ich konnte den Song nicht mehr hören.
„Ich hätte nie gedacht, dass wir alle zusammen feiern würden. Ich freue mich, dass wir als eine große Familie wieder zusammen sein können“, sagte Ramona mehr zu sich selbst, aus dem Fenster blickend. Die Landschaft zog an ihr vorbei. Sie hing ihren eigenen Gedanken nach. Nach einiger Zeit sprach sie weiter, „Mama probiert immer wieder neue Menüs aus, sie will, dass an diesem Tag alles perfekt ist. Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ob das so sein würde, hätte ich gesagt du spinnst.“
„Es hat sich viel getan“, antwortete ich nachdenklich, „jetzt haben wir ein Happy End, wie in einem billigen Groschenroman.“
Es entstand eine neuerliche Pause. Bei dem Gedanken, was sich die letzten zwei Jahre abgespielt hatte, mussten wir beide lachen. Lachen war besser als weinen. Zeitweise hatte, das was sich zwischen uns und unseren Familien abspielt hatte, die Qualität eines billigen Groschenromans. Im Nachhinein mussten wir uns alle die Frage stellen, warum wir uns das nur gegenseitig angetan hatten.
Wir kamen zügig voran, die halbe Strecke lag bereits hinter uns. Wir steuerten auf eine lang gezogene Rechtskurve zu. Harmlos könnte man denken, aber der Schein trügt. Sie will nicht enden und man wird viel weiter hinausgetragen, als man eigentlich geplant hatte.
Woher ich das wusste? Wir waren sie jeder schon mal am Limit mit dem Motorrad gefahren. Ein ganzes Stück vor uns nahm ich im Gegenverkehr einen roten Kadett wahr, vor ihm hatte sich eine größere Lücke gebildet. Er fuhr langsamer, schnitt die Kurve. Er fuhr weit über der Mittellinie. Aus heiterem Himmel bekam ich Gänsehaut. Michael und Tom fuhren zügig und sicher, hatten einige Autos überholt, waren aber noch in Sichtweite. Kannten die Strecke. Genossen das Fahren bei dem schönen Wetter.
Nachdem es ein eher nasses und kaltes Frühjahr war, freuten wir uns über jeden trockenen und sonnigen Tag, an dem wir Gelegenheit zum Motorradfahren hatten. Warum lenkte der Kadett nicht auf seine Spur zurück, er musste die Motorräder doch schon längst bemerkt haben?
Micha fuhr ein Stück vor Tom. Die beiden hielten einen Abstand von ungefähr dreißig Metern zueinander, fuhren leicht versetzt. Sie waren schon bedrohlich nahe an dem Kadett. Sahen die beiden das Auto nicht?
Wie in Zeitlupe ereignete sich die Katastrophe. Im Bruchteil von Sekunden, und doch kam es mir vor, als ob die Zeit stillstand, beziehungsweise sich wie in Superzeitlupe in unsäglicher Langsamkeit dehnte.
Das rote Auto fuhr stur weiter auf der falschen Fahrbahnseite, erfasste die Bol d’Or frontal. Ein lauter Knall, metallische Geräusche. Das Quietschen von Reifen. Tom versuchte dem Hindernis auszuweichen. Sein Bremslicht leuchtete auf, erlosch. Er riss sein Moped herum. Kämpfte, versuchte, der über die Straße schlitternden Bol’Or auszuweichen.
Michael wirkte wie eine Puppe, erst schlug er auf dem Auto auf, um dann hoch in die Luft gewirbelt zu werden. Wie eine Feder oder ein Blatt im Herbst. Ich war gefangen in der Regungslosigkeit des Entsetzens.
Wie in Trance erlebte ich die Szene, die sich vor mir abspielte. Tief in meiner Erinnerung spüre ich den Rhythmus pulsierender Donnerschläge, mein Herz raste. Intuitiv wusste ich, es war etwas Schreckliches passiert.
Mein Auto stand. Ich war wie gelähmt, mein Geist hatte sich von meinem Körper abgekoppelt. Mechanisch stieg ich aus dem Auto und rannte in die Richtung in die ich Michael fliegen gesehen hatte. Dort angekommen kehrte Stille um mich herum ein.
Ich starrte auf seinen regungslosen Körper. Erstickendes, kaltes, unbeschreibliches Grauen umfing mich. Er lag da, als wenn er schlafen würde. Durch das Visier sah ich, dass die Augen fest geschlossen waren. Tom und Ramona waren neben mir.
Bald standen viele Leute um uns herum. Stimmengewirr umgab uns, sie hörten sich wie ein byzanthistischer Chor an. Klangen schrill. Zu laut, zu verworren. Wo kamen all die Leute her?
Das Unheil und die Dramatik des Geschehenen, lies uns vier wie in einem Bühnenbild erscheinen. Jegliches Zeitgefühl hatte mich verlassen. Um uns herum herrschte hektische Betriebsamkeit.
Trotzdem wirkte das alles weit weg, wie durch eine Nebelwand. Tom, Ramona und ich waren ganz still, wie innerlich erstarrt. Tom nahm Micha den Helm ab, ich hielt seinen Nacken. Ramona war zurück zum Auto gelaufen und holte eine Decke. Wir funktionierten, kümmerten uns um ihn. Die Handgriffe geschahen mehr aus Instinkt als aus rationaler Handlung. Der Horror des Geschehenen hielt uns fest in seinem Bann. Wir hatten ihn auf die Seite gelegt und zugedeckt.
Tom hielt mich an sich gepresst. Der Schmerz der Verzweiflung breitete sich aus. In meiner Erinnerung höre ich einen unwirklichen Schrei, der Gedanke daran lässt mich noch heute erschaudern. Ich hatte das Gefühl mittendrin und doch nicht wirklich dabei zu sein. Mein Herz raste, bebte, mit jedem Schlag zog es mich tiefer in die Gewissheit, dass ich ihn verlieren würde.
Nach einiger Zeit war ein Martinshorn zu hören. Ob nur ein paar Minuten oder bereits Stunden vergangen waren bis der Notarzt eintraf, konnte ich nicht beurteilen. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Jemand zog an mir.
„Bitte lass ihn los“, befahl die Stimme. Sie wollte, dass ich ihn loslasse, ihn gehen lies.
Nein, niemals! Ich fühlte, wie mich jemand festhielt, jemand auf mich einredete. Es klang weit weg. Es war als wenn die Erde stillstehen würde, grenzenlose Ohnmacht. Ich war zu keinem Wort, zu keiner Bewegung fähig, meine Knie waren weich. Wir lebten, aber der Tod war ganz nah.
Jemand legte eine Decke um meine Schultern. Zog, trug mich von ihm weg. Völlig teilnahmslos saß ich einige Momente später, mit dem Rücken an ein Fahrzeug gelehnt, im Gras.
Aus der Entfernung beobachtete ich wie das Notarztteam in seiner trainierten, professionellen Weise Micha versorgte. In den Gesichtern konnte man nicht lesen. Einer der Männer war zum Wagen zurückgelaufen, hantierte mit dem Funkgerät. Ein anderer Mann betrachtete den Helm eingehend, drehte, wendete und befühlte ihn. Seine Mine war ernst, er legte den Helm in den Krankenwagen.
Wie aus dem nichts tauchte ein neues Geräusch auf, wie ein großer Schwarm Bienen. Neben uns auf dem Feld fing die Luft an zu vibrieren. Ein Hubschrauber landete. Zwei weitere Männer in orangen Overalls entstiegen ihm, sie liefen in Michas Richtung. Die Männer redeten miteinander. Kurz darauf sah ich, wie er auf einer Bahre in den Hubschrauber verladen wurde. Einer der Männer hielt eine Infusion hoch. Sie nahmen den Helm mit. Micha konnte ich nicht sehen.
Ich wollte aufstehen, bei ihm sein, doch meine Beine weigerten sich das Gewicht meines Körpers zu tragen. Der Sanitäter sagte, „Bleiben sie hier, sie können jetzt nichts tun.“ Er legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter. Die Luft wirbelte wieder, tosend hob der Hubschrauber ab, dann war nur noch ein Punkt am Himmel sichtbar. Und Stille.
Zwei Polizisten kamen in unsere Richtung, trotz der Decke zitterte ich am ganzen Körper und war starr vor Entsetzen. Einer der Polizisten sprach mit dem Sanitäter, der sich um uns kümmerte. Sie wollten wissen ob wir auch in den Unfall verwickelt waren.
Tom saß jetzt neben mir. Ich sah zu ihm auf, sein Gesicht spiegelte etwas Unbestimmtes, ein Aufgewühlt sein, das nur ihn alleine betraf. Etwas stecke tief in ihm, das keiner nachempfinden konnte. Die Frage warum Micha, warum nicht ich. Normalerweise fuhr immer Tom vor.
Ramona saß neben mir mit tränenüberströmtem Gesicht. Sie hatte mit ihren Armen ihre Knie umschlossen. Die Wimperntusche hatte ihr Gesicht zu einer grotesken Maske verschmiert. Verwirrung, Schrecken, Fassungslosigkeit wechselten sich in ihrem Blick ab.
Die Polizisten stellten Fragen, Tom war als einziger im Stande einen vernünftigen Gedanken zu fassen, er beantwortete ihre Fragen zum Unfallhergang. Äußerlich war er unversehrt, doch der Schock saß ihm genauso tief in den Knochen. Er war aufgestanden und unterhielt sich ganz ruhig mit den Polizisten. Ich hörte nicht richtig hin. Mein Blick schweifte ziellos umher.
Der Mann mit dem roten Kadett hatte eine Wunde am Kopf, er saß ganz benommen in der Nähe, er konnte das gerade Erlebte auch noch nicht begreifen. Er war etwa Mitte vierzig, trug eine helle Stoffhose, die jetzt Flecken vom Blut hatte und ein weißes Hemd. Er hatte dunkle Haare, er sah in diesem Moment unendlich alt aus. Ich empfand eine grenzenlose Wut auf ihn, er hatte mir das Liebste im Leben genommen. Eine Weile lang fixierte ich ihn mit meinem Blick. Er schien mich nicht zu bemerken oder ignorierte er mich? Er schüttelte immer wieder den Kopf. Sprach aber mit keinem.
Einer der Polizisten fragte wer ich sei, Tom antwortete die Freundin des Motorradfahrers. Er sah mich mitfühlend an.
Um uns herum herrschte immer noch geschäftiges Treiben. Ich tauchte in eine Parallelwelt ein, versank wie ein Stein im undurchdringlichen See meiner Gefühle. Das Bild des gerade Erlebten hatte sich in mein Innerstes eingebrannt, wie ein Blatt im Wind fliegend sah ich Michael. Wieder und wieder. Eine Zeitlang versank ich, lies mich tragen. Mit der Zeit wurde alles wahr, war schwindelerregend, gegenwärtig. Das Zittern verschlimmerte sich, alles in mir war in Aufruhr.
Allmählich verschwanden die Schaulustigen. Nachdem alle Beweise und Spuren gesichert waren, wurde die Unfallstelle aufgeräumt. Die Polizei versuchte den Verkehr wieder in Gang zu bekommen. Jemand rief in die Menge der noch umherstehenden Menschen, wem der rote Golf gehöre. Mein Auto stand noch immer mitten auf der Fahrbahn, es war mir egal. Irgendjemand fuhr ihn zur Seite.
Nach einiger Zeit begann ich aus der Ohnmacht in die Realität zurück zu gleiten. Grauen umklammerte mich, Panik, Horror. Ich starrte Löcher in die Luft. Tom hielt mich wieder fest. Er wirkte ganz ruhig und stark.
„Sag, dass es nicht wahr ist, bitte!“ flehte ich ihn mit tränenerstickter Stimme an.
Er schüttelte nur den Kopf, hatte einen unendlich traurigen Ausdruck in seinen Augen. Die furchtbarsten Minuten unseres Lebens. Fassungslosigkeit überlagerte alles.
Der ausklingende, schöne Sommertag hatte für uns er jegliche Wärme und Farbe verloren. Auf der Fahrt zum Krankenhaus starrte ich aus dem Fenster. Tom fuhr. Im Nachhinein der glatte Wahnsinn. Er sagte, dass wir damit rechnen müssen, dass er sterbe oder bereits gestorben ist.
„Nein! Das will ich nicht.“ Widersprach ich, wie ein trotziges Kind.
Ich war außerstande, die Lage rational zu betrachten. Die Fahrt erschien mir unendlich lang. Wir steckten immer wieder im Freitagabend Feierabendverkehr fest. Warum dauerte das so lange?
Das Unfallkrankenhaus, in das sie ihn geflogen hatten, wirkte monströs und modern. Ein imposanter Bau, in Mitten der Voralpenlandschaft. Vom Parkplatz waren es nur wenige Minuten bis zum Eingang. Ich stolperte hinter Tom her, er zog mich mehr als ich bewusst ging.
Die Eingangshalle war kühl und sachlich. Tom erkundigte sich nach dem Weg, wir liefen durch viele Gänge. Ich nur hinterher, wie ein kleines Kind. Da war der typische Krankenhausgeruch nach Desinfektionsmittel und Pfefferminztee. Die Gänge kamen mir wie lange Schläuche vor, die alle gleich aussahen und miteinander verbunden waren. Hellerleuchtet, viele gleiche Türen. Gleichförmigkeit, Eintönigkeit, Stoßkanten an den Wänden auf der Höhe der Krankenhausbetten. Leere Betten auf den Gängen, blauer Linoleumfußboden, pastellfarbene Wände. Am Ende eines Ganges ein Treppenhaus, manchmal ein Fenster.
Endlich sah ich in einem Wartebereich Michas Mutter Sabine und Ramona, sie waren kurz vor uns angekommen. Die Polizei hatte Ramona schon etwas früher nach Hause gebracht, sie hatte es Sabine erzählt.
Wir haben uns angeschaut, aber nichts gesagt. Sabine und ich das war eine schwierige Beziehung. Tom ging zu seiner Mutter und nahm sie in den Arm. Sie weinte stumm, sah um Jahre gealtert aus, in sich zusammengesunken. Ich stand stumm neben ihm. Er hat gefragt wie es inzwischen aussähe, sie hat mit den Schultern gezuckt.
„Wir wissen es nicht, eine Schwester sagte, die Notfall OP kann noch mehrere Stunden dauern.“ Ihre Stimme hatte einen fremden Klang angenommen.
In der Besucherecke standen mehrere Plastikstühle. Die Sorte weiß und unbequem, nach einiger Zeit weiß man nicht mehr, wie man sich setzen soll, eine bequeme Stellung gibt es nicht.
Es war ein offener Bereich, in ein paar Metern Entfernung eine Theke, hinter der zwei Krankenschwestern arbeiteten. Es war ein Kommen und Gehen, sie händigten Krankenblätter aus, telefonierten. Mit der Zeit wurde es ruhiger. Wir waren die einzigen Wartenden in diesem Bereich.
Wir saßen still in der Besucherecke. Die Zeit zog sich in unsäglicher Langsamkeit, Minuten wurden zu Stunden. Jeder war in seinen eigenen Ängsten gefangen. Keiner wollte etwas sagen. Keiner wollte das Unaussprechliche aussprechen. Tom saß neben mir und gab mir Halt. Ramona saß bei ihrer Mutter.
Es war inzwischen tiefe Nacht. Hin und wieder liefen wir etwas im Raum auf und ab. Ricky, hatte einen Kaffeeautomaten gefunden, die zum Teil noch halbvollen Plastikbecher standen auf einem Tablett am Boden. Der Kaffee war scheußlich und inzwischen kalt.
Der Philodendron, der als Hydrokulturgewächs in der Ecke stand, hatte siebzehn, zum Teil etwas eingestaubte Blätter. Die Wasserstandsanzeige stand auf halbvoll. Der Gang, in den wir sahen, hatte acht große und ebenso viele kleine Fenster.
Zählen, die Dinge ganz genau zu betrachten, immer noch mal nachkontrollieren, diese Rituale hielten mich davon ab, den Verstand zu verlieren. Jeder Muskel schmerzte, doch der Schmerz hatte etwas Erlösendes. Er bestätigte, dass ich hier war. Ich zählte alles, die Blätter des Philodendron unterschieden sich in der Anzahl der Zacken. Die Deckenelemente, große und kleine, alles was man zählen konnte. Es beruhigte meine Nerven.
Dann, es fühlte sich an, als wäre eine Ewigkeit vergangen, erschien einer der Ärzte. Er sah müde aus, er trug noch die grüne Kleidung aus dem OP. Auf dem Kittel zeichneten sich Schweißränder ab. Er hatte auch kleine Flecken, die bei genauerem hinsehen Blut waren.
Wir sahen ihn alle schweigend und mit der Hoffnung an, dass er nicht den Satz, vor den wir uns alle fürchteten, aussprechen würde. Er hatte nicht mehr allzu viele Haare, die übrigen waren schon grau. Er blickte in die Runde, Sorge und Müdigkeit hatte unsere Gesichter gezeichnet. Er ging auf Sabine zu.
„Sind sie die Mutter?“
Sie nickte.
„Würden sie bitte für einen Moment mit mir kommen?“
Sabine stand auf und folgte ihm. Warum hat er nichts gesagt, der Horror breitete sich wie ein Wirbelsturm in mir aus. Ich konnte keinen ansehen, starrte auf den Boden. Stumm betete ich darum, dass er lebte. Die Anspannung war unerträglich. Um nicht verrückt zu werden und meine Panik zu unterdrücken, zählte ich ein um das andere Mal die Platten der Deckenverkleidung im Wartebereich.
Die Zeitspanne, die verging bis sie zurückkam erschien mir wiederum endlos. Wir sahen sie an. Tom war aufgestanden und stand jetzt neben ihr, er hatte den Arm schützend um sie gelegt. Vier Augenpaare starrten sie erwartungsvoll an.
„Er lebt….noch…“ ihre Stimme war gebrochen, das Ende des Satzes hing in der Luft.
Dann wiederholte sie mit einer fremdklingenden, monotonen Stimme den Bericht des Arztes. „Sein Zustand ist immer noch sehr instabil, bei den Verletzungen handelt es sich um ein so genanntes Polytrauma. Die OP ist den Umständen entsprechend gut verlaufen. Über die Auswirkungen des Schädel-Hirn-Traumas und der damit einhergehenden Blutung konnte der Arzt noch keine Prognose abgeben, man muss die nächsten Stunden und Tage abwarten.
Er hat eine instabile Beckenfraktur, die dadurch verursachten Blutungen wurden gestoppt, er hat aber viel Blut verloren. Mehr können sie im Moment nicht tun.“
Alle anderen Verletzungen könnten erst im zweiten Schritt behandelt werden, da von ihnen keine akute Lebensgefahr ausging. Mehr würde er jetzt nicht verkraften. Sorge bereitete den Ärzten ein Serienbruch der Rippen auf der rechten Seite, der die Atmung zusätzlich beeinträchtigte. Er hätte aber Glück, die Lunge sei nicht beschädigt. Er hatte noch mehrere kleinere Brüche, diese wären jedoch unkompliziert.
Es hörte sich so sachlich an, unwirklich. Der Bericht erschlug uns, wir saßen stumm da. Gab es noch irgendeinen Teil seines Körpers der nicht in Mitleidenschaft gezogen war? Ich weinte still vor mich hin, Sabine kam auf mich zu, sie nahm mich in den Arm. Eine vorher nicht gekannte Nähe war plötzlich entstanden.
„Wir können für einen Moment zu ihm“, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Sie nahm mich bei der Hand, die anderen blieben zurück. Wir mussten uns umziehen, Plastiküberzieher für die Schuhe, grüne Kittel. Eine Schwester begleitete uns. Sie hatte ein nettes, rundes Gesicht, versuchte uns zu beruhigen, uns Mut zuzusprechen. Sie öffnete eine Schiebetür. Der Raum war hell und hoch technisiert, er hatte etwas aus einem Science Fiction Film. Micha lag in einem Bett, das neben drei anderen aufgereiht war. Trotz seiner Größe sah er sehr zerbrechlich aus.
Die Augen waren fest geschlossen, die blonden Haare unter dem Verband kaum zu sehen. Das Beatmungsgerät erzeugte ein gleichmäßiges zischendes Geräusch, der Schlauch, der in seinem Mund steckte, war mit einem transparenten Pflaster fixiert.
Es war gespenstisch, viel Verband, viele Schläuche und das kontinuierliche Piepsen des Überwachungsmonitors. Er war nur mit einem dünnen Laken zugedeckt, ob er friert?
Die ganze Zeit über hatte ich mir eingeredet, dass es schon nicht so schlimm werden würde. Als ich neben ihm stand, wurde das Geschehene immer realer. Bis dahin war alles nicht ganz wahr gewesen, mein Herz hatte es nicht geglaubt. So standen Sabine und ich eine Weile an seinem Bett. Ich hatte seine Hand in meine gelegt und umschlossen, er lag neben mir und war doch unerreichbar.
Wieder draußen auf dem Gang trafen wir nochmals den Arzt mit dem Sabine gesprochen hatte, er hatte sich umgezogen, trug jetzt einen frischen, weißen Mantel.
Er sah uns an und sagte, „Man muss die Nacht und sie nächsten Tage abwarten, sehen in wieweit sich sein Zustand stabilisiert, mehr können wir im Moment nicht tun. Sie sollten sich auf das Schlimmste einstellen. Es ist besser, wenn sie nach Hause fahren und sich ausruhen, beten könnte vielleicht helfen.“
Es klang so nüchtern. Wie oft hatte er Angehörigen schon Ähnliches mitteilen müssen. Sich auf das Schlimmste einstellen, es klingt so unpersönlich. Dabei ging es hier um den Menschen den ich mehr alles andere liebte.
Er kann doch nicht so einfach aus unserem Leben verschwinden. Nur weil ein Autofahrer nach einem Päckchen Zigaretten im Handschuhfach gekramt hat. Und kurz unaufmerksam war.
Tom hatte es uns während des Wartens erzählt. Der Mann in dem roten Kadett hatte das gegenüber der Polizei an der Unfallstelle ausgesagt. Warum? Es war so sinnlos. Ich wollte lieber mit ihm sterben als ihn verlieren.