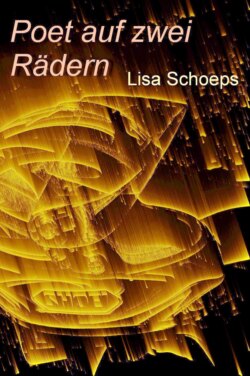Читать книгу Poet auf zwei Rädern - Lisa Schoeps - Страница 9
Kapitel 7
ОглавлениеDurch das geschenkte Geld konnte ich die dringendsten Rechnungen bezahlen und hatte sogar die Möglichkeit ein paar Tage Urlaub an einem der Klinik nahegelegenen See zu verbringen. Es war August und Ferienzeit.
Der Campingplatz lag direkt am See. Ich hatte mein Fahrrad dabei und konnte mit dem Rad zur Klinik fahren. Unser kleines Zelt hatte die Ausmaße einer Hundehütte, ich hatte es an einem schattigen Platz unter einem Baum aufgebaut. Man konnte in ihm nur sitzen, es war gerade mal Platz um zwei schmale Luftmatratzen nebeneinanderzulegen. Das Wetter war gut ich hielt mich die meiste Zeit im Freien auf. Wenn ich nicht in der Klinik war, saß ich im Schatten und las oder schlief oder fuhr mit dem Fahrrad in der näheren Umgebung spazieren.
Ich wurde ruhiger, es ging mir wieder besser. Ich konnte sogar wieder lachen. Meine wechselnden Zeltnachbarn waren sehr nett, wir unterhielten uns über das Wetter, die schöne Landschaft, über Belanglosigkeiten. Ich habe ihnen nie von Michael erzählt. Mit ihnen war es, als wäre nie etwas passiert. Die Normalität tat mir gut.
Tom kam oft zu Besuch. Ich denke, meine Zeltnachbarn glaubten, er wäre mein Freund. Wir setzten uns dann an den See und schauten den Enten und Segelbooten zu. Selbst mit ihm konnte ich nur oberflächlich über die Dinge die in mir vorgingen, sprechen. Ich schlief unregelmäßig und ich grübelte viel. Ich fragte mich immer wieder, wie meistern wir die Zukunft? Schaffen wir das? Und spielte das Warum-Spiel.
Kleine Fortschritte zeichneten sich ab. Michael war seit einiger Zeit in ein normales Zimmer verlegt worden, das er mit zwei anderen teilte. Die Gesellschaft seiner beiden Zimmerkollegen führte ihm vor Augen, dass andere mit einem ebenso bitteren Schicksal weiterleben mussten.
Rudi hatte durch einen Motorradunfall das linke Bein unterhalb des Oberschenkels verloren. Er war 24 Jahre und überspielte seinen aufgestauten Frust gekonnt. Auf dem zweiten Blick war jedoch schnell klar, dass sein Sarkasmus nur dem Selbstschutz diente. Er war sehr verbittert darüber, dass ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit und Übermut sein ganzes Leben verändert hatten.
Christian hatte mehrere Wirbelbrüche, er war bei der Arbeit von einem Gerüst gestürzt. Er war erst 19 und machte eine Maurerlehre. Trotz alledem strahlte er am meisten Lebensmut von den Dreien aus, auch wenn er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen würde. Er schmiedete Pläne für seine Zukunft.
Michael hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Leben abgeschlossen. Eine tief depressive Stimmung hatte ihn in Besitz genommen. Er war ganz tief im Tal der Tränen gefangen, in einem bleiernen Mantel von unendlicher Resignation. Es fiel ihm schwer den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Lethargie bestimmte sein Handeln. Durst zu verspüren und die Kraft aufzubringen, die Tasse zu nehmen, kostete ihn fast übermenschliche Kräfte. Gefangen zu sein in einer Welt, die nur noch aus Hoffnungslosigkeit bestand, wirkte sehr bedrohlich auf uns.
Sabine wollte mit dem behandelnden Arzt über seinen besorgniserregenden Gemütszustand sprechen. Ich hatte sie gefragt ob, ich mitkommen könnte. Sie hat den Arm um mich gelegt und genickt. Es war derselbe Oberarzt, der mit uns in der Nacht des Unfalls gesprochen hat. Sein Büro war klein, mit viel Fachliteratur vollgestopft und einigen Urkunden an den Wänden. Auf dem Schreibtisch stand ein Bild von seiner Familie, er hatte vier Kinder, die Jungs schon ziemlich erwachsen, das Mädchen mit den dunklen Locken sehr viel jünger. Ein Nachzügler? Das Bild von seiner Frau schien schon älter zu sein, die Frisur und die Kleidung passten nicht mehr in die aktuelle Zeit. Sie sahen glücklich aus. In einer Ecke nahe dem Fenster fristete eine Grünpflanze ihr trauriges Dasein. Er hatte keinen grünen Daumen.
Wir nahmen auf den beiden Freischwingersesseln gegenüber seines Schreibtisches Platz. Er erklärte uns, dass Michaels Verhalten nicht ungewöhnlich sei. Studien hätten gezeigt, dass die wiederzuerlangende Lebensqualität insbesondere, in Anbetracht des vorliegenden Verletzungsgrades, von der Länge der künstlicher Beatmung und der Intensität der Intensivbehandlung stark beeinflusst würden. Bei Michael sahen diese Determinanten nicht gut aus. Auf der anderen Seite konnte man selbst zu diesem Zeitpunkt leider immer noch keine langfristige Prognose abgeben, manchmal gäbe es auch kleine Wunder.
Gemessen an seinen Ausgangsverletzungen sei sein Zustand sehr zufrieden stellend. Mit steigender Verletzungsschwere würden die psychischen Probleme im Sinne der Bewältigung des Unfalls sich oftmals in emotionalen Störungen ausdrücken. Das war bei Michael der Fall.
Michaels Schlaf-Wach-Rhythmus war durcheinander gekommenen. Die Schlafqualität wäre schon beim Gesunden eine Determinante der Lebensqualität, hieraus ließen sich Energieverlust, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit erklären. Schlaf hat einen großen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Er fuhr weiter fort, die Kraftlosigkeit und geringe Motivation wären ebenfalls auf einer emotional-psychischen Ebene zu erklären. Man konnte sie sowohl durch rein körperlich-funktionelle Gesichtspunkte erklären, als auch durch körperliche und psychisch-reaktive Aspekte im Sinne der Unfallbewältigung bzw. -verdrängung. Die andauernden Schmerzen des Patienten würden den Zustand verschlimmern. Er versicherte uns, das Michael das Maximum an Schmerzmittel bekam, das zu verantworten war.
Dann sprach er in seiner schon durch die Wortwahl sehr distanzierten Sprache weiter, Verletzungen des Gehirns und des Schädels wären zwar selten direkte Auslöser der Schmerzen, jedoch oft Ursache kognitiver Störungen, die zu emotionaler Labilität und zu verminderter Schmerztoleranz führen können. Der Teufelskreis aus mangelndem, schlechtem Schlaf führt zu Gereiztheit, Labilität und Unzufriedenheit. Die schlägt sich oftmals auf die Schmerzverarbeitung des Patienten nieder.
Die einschlägigen Symptome der Depression wären unübersehbar: Die anhaltende Niedergeschlagenheit mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und eine ausgeprägte Schwäche des Antriebs und der Entschlussfähigkeit, sowie der Verlust des Interesses an allen Dingen des Lebens.
„Ihr Sohn bekommt seit einiger Zeit stimmungsaufhellende Medikamente. Nur leider schlagen sie nicht in dem erhofften Rahmen an“, endete er seine Erläuterungen.
Ich hörte die Worte, hatte aber Probleme sein Fachchinesisch richtig zu verstehen.
Sabine fragte nach, „Gibt es denn nichts um ihn aus der Depression zu holen? Glauben sie, dass er jemals wieder sprechen kann?“
„Er bekommt Trizyklika gegen die Depression. Wie gesagt, man kann jetzt noch keine langfristige Prognose abgeben. Er besteht die Hoffnung das er die Sprache zurück erlangen kann, aber wann und in welcher Form weiß nur Gott.“
Er blickte etwas ratlos drein. Ob es diese distanzierte, extrem versachlichte Sprache war, die die Barriere zwischen ihm und den Menschen, die er behandelte, aufbaute, um sich selbst zu schützen ging es mir durch den Kopf. Als wir gegangen waren, dachte ich über die Art der Formulierungen nach. Alles sehr präzise, viele Fremdwörter, ohne jegliche Emotion. Ist es der Weg wie sie ihren Beruf auf Dauer ausführen können? Mit dem sie die Distanz zwischen sich und dem Elend, das sie umgibt, wahren?
Wirklich weitergeholfen hatte uns das Gespräch nicht. Das Warten brachte uns noch um den Verstand.
Es fiel so schwer Verständnis aufbringen, stark zu sein, nicht aufzugeben. Oft glaubte ich mich am Rande dessen, was ich noch geben konnte. Ich spürte Wut, wollte ihn manchmal schütteln, ihm entgegenschreien, dass er ein kleinwenig mithelfen muss. Michael litt unter seiner Unbeweglichkeit, in allen Aspekten seines Lebens. Konnte man seinen Zustand noch Leben nennen?
Der Arzt versicherte ihm immer wieder, dass er eine gute Chance hätte sowohl wieder Laufen als auch Sprechen zu lernen, aber er müsse auch selber wollen. Die Röntgenbilder sahen vielversprechend aus und das EEG war unauffällig. Die Brüche und die anderen Verletzungen heilten zwar langsam aber man konnte deutliche Fortschritte erkennen.
Er brauche Geduld. Ihm und uns halfen diese Aussagen nicht, es schien als würde er daran zerbrechen. Michael war ganz tief in seiner Depression gefangen, es fehlte ihm jeglicher Antrieb weiterzukämpfen. Er sehnte sich den Tod herbei, am liebsten wäre er über die unsichtbare Grenze gegangen. Er war willenlos, nur noch eine Hülle.
In der Bewegungstherapie verhielt er sich wie eine Puppe, er ließ es einfach mit sich geschehen. Es schien, als könnte er die Situation nur noch ertragen indem er seine Seele von seinem Körper trennte. Die Schwestern setzten ihn für einige Stunden am Tag in den Rollstuhl. Er ließ es mit sich geschehen. Wenn ich kam saß er teilnahmslos, in sich zusammengesunken am Tisch oder vor dem Fenster und starrte Löcher in die Luft. Sein Blick wirkte stets abwesend, leer.
Inzwischen war es Spätsommer, am Morgen lag dichter Nebel über dem Land, die Tage wurden bereits wieder deutlich kürzer. An guten Tagen schob ich ihn nachmittags im Klinikgarten, ich suchte dann einen schönen Platz für uns aus. Stellte ihn so, dass die Sonne nicht blendete, passte auf, dass ihm nicht kalt wurde. Ich las aus unseren Lieblingsbüchern vor, da ich nicht wusste, was ich noch sagen sollte. Hielt seine Hand.
Es war zum Heulen den Frust und die Wut und Verzweiflung mit anzusehen und den stillen, allgegenwärtigen Kampf den er mit sich selbst führte. Die Mühe, die es ihn kostete auch nur einfache Silben zu formen. Ich wünschte mir so sehr, dass er nicht aufgab und wusste nicht wie ich ihm helfen sollte. Wenn, dann haben wir auf Papier kommuniziert, der linke Arm war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben und es stellte sich als Glück heraus das er Linkshänder war. Somit konnte er zumindest schreiben.
Ich konnte nur erahnen was in ihm vorging. Das Schreckliche, das er durchlebt hatte, immer noch durchlebte. Es hatte sich wie ein tiefer Stachel in seine Seele gebohrt, er konnte es nur schwer verarbeiten. Er konnte die negativen Gefühle nicht zulassen, ohne daran gänzlich zu zerbrechen. Es war ein großer Fehler, sie zu verdrängen, davonzulaufen, nicht stehenzubleiben, die Furcht nicht zu bekämpfen, sie zu zähmen. Ihm fehlte die Kraft, er konnte nicht mehr.
An einem schönen Nachmittag Anfang September saßen wir im Klinikgarten. Ich hatte den Rollstuhl so neben die Bank geschoben das Michael neben mir saß.
Der Föhn, der warme Wind der von den Bergen herabfiel, erzeugte eine kristallklare Sicht. Der Himmel war stahlblau, ohne jegliche Wolke. Die ersten Blätter fingen an, sich langsam zu verfärben. Es war eigentlich noch viel zu früh. Vor uns breitete sich das Panorama des Karwendels aus. Eine Bilderbuchlandschaft wie auf einer Postkarte.
Micha wirkte bedrückter als an anderen Tagen, er wollte etwas erzählen, konnte jedoch nicht, was ihn zusätzlich frustrierte. Heute ging es ganz besonders zäh. Selbst Worte die er inzwischen richtig gut konnte, wollten nicht klappen. Er hatte an diesem Tag auch stärkere Schmerzen als sonst, es ging ihm nicht gut. Er war blass, die Lippen fast farblos, dunkle Schatten unter den Augen, auf der Haut lag ein dünner feuchter Film. Hatte er wieder Fieber? Seine Augen sahen matt und doch ganz glasig aus. Micha hatte einen Block mit Papier auf seinen Knien liegen, mit zitternder Handschrift schrieb er etwas darauf.
„Ich will sterben! Hilf mir. Bitte!“
Er sah mich flehend an. Seine schönen blauen Augen verdunkelten sich, füllten sich mit Tränen.
Sekundenlang stockte mir der Atem, jetzt war es ausgesprochen, die düstere Ahnung bestätigt. Er hatte sich selbst aufgegeben. Ich war wie versteinert, mein Herz setzte einige Schläge lang aus. In mir stieg Panik auf, ich kritzelte spontan ein großes NEIN darüber, fing an unkontrolliert zu sprechen, fast schon beschwörend, dass er schon so weit gekommen war und wir den Rest des Weges auch noch schaffen würden.
Wen wollte ich überzeugen, ihn oder vielleicht mich selbst?
Er solle sich umsehen es war ein wunderschöner Tag. Aber seine Verzweiflung war so greifbar, der Tod stand neben uns. Er wollte sterben. Er hatte endgültig aufgegeben. Ich redete, und redete, könnte nicht mehr wiederholen was ich erzählt habe, nur um die innere Panik, die mich überrollte, zu besiegen. Schlagartig spürte ich mein Herz wieder schlagen, so fest das es wehtat.
Erst liefen ihm nur stumm die Tränen herunter, dann wurde ein herzergreifendes Schluchzen daraus. Er wurde von einem Weinkrampf geschüttelt, schien zusammenzubrechen.
Was sollte ich machen? Unsicherheit breitete sich aus. Ich nahm ihn in den Arm, überlegte fieberhaft was ich tun könnte, konnte jedoch keinen klaren Gedanken fassen. Meine eigene Hilflosigkeit überwältigte mich, wie so oft in diesen Tagen.
Es gab nur noch uns, die Welt um uns rückte in weite Ferne. Er zitterte am ganzen Körper. Ob uns jemand bemerkt hat? Ich weiß es nicht. Wir waren allein. Die Geräusche der Umgebung drangen nur wie aus weiter Ferne zu uns. Nach einiger Zeit hatte ich mich wieder etwas gefangen, ich fing erneut an mit leiser, zärtlicher Stimme mit ihm zu reden wie mit einem kleinen Kind. Hielt ihn fest, versuchte ihn zu trösten, streichelte ihn, dabei wurde mir bewusst wie abgemagert er war. Man konnte jede Rippe fühlen. Kraulte mit stummer, mitfühlender Zärtlichkeit sein Haar. Ich zitterte vor Angst, hoffte genug Einfühlungsvermögen aufzubringen, die richtigen Worte und Gesten zu finden um ihm zu zeigen, dass er nicht allein war, dass ich ihn mehr als alles andere liebte.
Es fiel mir so unendlich schwer Stärke zu zeigen und Hoffnung zu verbreiten. Ich hatte selbst so viele Zweifel und wusste nicht wie es weiter gehen sollte. Auf keinen Fall wollte ich ihn gehen lassen.
Nach einer Weile wurde er ruhiger, stumm blickte er mich an, es war so, als wenn er meine Gedanken lesen würde. Alle konnte ich täuschen, nur ihn nicht. Er strich mir über die Wange, ich nahm seine Hand und drückte sie fest dagegen. Spürte die Kühle, seine Finger waren ganz kalt. Schon wieder spürte ich die Tränen unter meinen Lidern. Alles, nur das nicht, ich musste jetzt stark sein redete ich mir ein. Ich konnte ihn nicht ansehen, schloss für einen Moment die Augen um mich zu sammeln. Er zog meine Hand zu seinem Mund, plötzlich merkte ich wie seine Lippen meine Handfläche berührten, sie küssten.
Warum tut er das jetzt? Ich erstarrte, auf der einen Seite sehnte ich mich nach seiner Liebe, auf der anderen traute ich in der aktuellen Situation meinen eigenen Gefühlen nicht über den Weg. Wie versteinert saß ich da, er zog seine Hand zurück streichelte ganz leicht meine Wange. Jetzt tröstet er mich! Ich wollte doch für ihn da sein, ich fühlte mich wie ein Versager.
Tom, kam an jenem denkwürdigen Tag abends unerwartet vorbei. Die Geschehnisse des Nachmittags hatten mich aus der Bahn geworfen. Er betrachtete mich gleichmütig, um seinen Mund ein kaum angedeutetes Lächeln und schüttelte ungläubig den Kopf. Ich versuchte meine bröckelnde Fassade aufrechtzuerhalten, fühlte mich ertappt.
Er schaute mich lange an, er sah mein verheultes Gesicht. Mut zur Wahrheit? Nein lieber nicht, denn wenn ich anfangen würde über, das was in mir vorging zu sprechen, würde ich zusammenbrechen. Dann würde der Damm brechen.
Wir gingen auf die Dachterrasse. Er setzte sich neben mich und legte den Arm um meine Schultern. Wir saßen eine ganze Weile stumm da, dann erzählte ich ihm die Geschichte vom Nachmittag.
„Willst du nicht endlich darüber sprechen, wie du dich fühlst. Du hast seit dem Unfall mit niemandem wirklich darüber gesprochen.“
„Ich kann nicht. Ich kann und will das ‚was ich fühle‘ nicht in Worte fassen.“
„Du hilfst keinem, wenn du alles in dich hineinfrisst. Komm rede, mit mir, “ bohrte er nach. Das ich mich weigern könnte kam ihm nicht in den Sinn.
„Ich kann nicht, ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Es ist mir im Moment alles einfach alles zu viel. Heute war ein schrecklicher Tag. Ich weiß nicht was ich noch tun kann. Ich komme mir so hilflos vor.“
„Du tust schon viel mehr, als irgendjemand von dir erwarten kann. Micha weiß das auch. Aber es nützt auch nichts, wenn du morgen zusammenklappst. Lass dir helfen.“
„Ich weiß nicht wie, ich habe Angst. Der Berg erscheint mir gigantisch, ich habe Angst, dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin.“
Dabei fühlte ich wieder das bodenlose Grauen, das mich wie ein Eisschleier umgab und sich wie ein Gespenst in mir ausbreitete.
„Ich habe Angst, dass ich zusammenbreche, ich bin müde, habe aber Angst, einzuschlafen. Ich habe Angst wenn ich die Augen schließe, ich sehe dann nur schreckliche Bilder.“
„Du musst nicht alles allein tragen.“
Dabei strich er mir behutsam über die Haare. Ich fragte ihn, ob Micha mit ihm auch schon über Selbstmord gesprochen habe.
„Ja, schon mehrmals. Er hat mich gebeten ihm zu helfen sich umzubringen.“
„Warum hast du mir das nicht erzählt?“ fragte ich ihn fassungslos.
„Was hätte es verändert?“
Wir haben lange darüber gesprochen, ob es ein Ausweg ist oder ein Davonlaufen. Ob es noch Hoffnung auf ein einigermaßen normales Leben gibt. Tom meinte, wenn es gar keine Hoffnung mehr gäbe, dann würde er ihm helfen. Wir schwiegen. Ich konnte ihn verstehen.
Wenn ich geglaubt hatte, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte, belehrten mich die folgenden Wochen eines Besseren. Sie wurden zum Maßstab der tiefen Depression, Lethargie, Antriebslosigkeit, einfach nur bleiernen Traurigkeit und dem drohenden Tod, der immer auf der Schwelle stand.
Total verzweifelt über meine eigene Hilflosigkeit lag ich nachts wach und habe geweint. Irgendwann hatte ich auch keine Tränen mehr, alles Fühlen erlosch, es war nicht mehr länger zu ertragen. Ich rettete mich mit Ritualen aus frühester Kindheit durch die Nacht. Denkspielen, mir Dinge ganz genau einprägen, irgendetwas, zum Beispiel eine Seite des Telefonbuchs, alle Namen, Adressen und Nummern auswendig zu lernen nur um meinen Geist zu beschäftigen. Lange Zahlenreihen zu rechnen, ein Bild bis ins kleinste Detail zu beschreiben. Nur nicht denken.