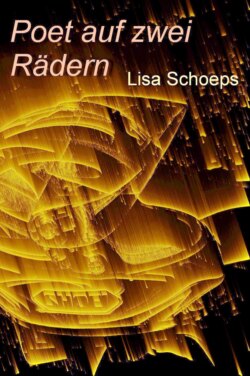Читать книгу Poet auf zwei Rädern - Lisa Schoeps - Страница 8
Kapitel 6
ОглавлениеDie Wochen vergingen, außer ein paar schwer interpretierbaren Lauten konnte Micha nichts von sich geben. Es gab so Vieles, über das wir reden mussten und es ging nicht. Ich vermisste unsere Gespräche. Fühlte mich schrecklich alleingelassen und einsam.
Michael wirkte inzwischen so, als würde er alles was um ihn herum vorging erfassen. Sein Verstand schien wieder voll zuarbeiten, darin lag eine ungeahnte Grausamkeit des Schicksals. Er war in sich gefangen. Erst wenn einem ein Gut wie die Sprache genommen wird, wird einem so richtig bewusst, wie wertvoll es ist. Unsere Kommunikationsform war einseitig, ich redete und Micha sah mich an.
Es brachte mich fast um mitzuerleben, wie der Mensch, den ich am meisten liebte, durch einen Unfall ins Kleinkindalter zurückgeworfen wurde. Seine Verzweiflung war so offensichtlich, dass man sie greifen konnte. Er konnte das, was in ihm vorging nicht artikulieren. Er litt, seelisch und körperlich. Die Zeit hatte keine Bedeutung mehr, wurde körperlos und dahin schwimmend, seitwärts gleitend, ohne Anfang und ohne Ende. Seine Augen spiegelten die immer gleiche Frage, wozu lebe ich noch, obwohl ich doch besser tot wäre. Er hatte trotz der starken Schmerzmittel Schmerzen und Fieber. Wegen des Beckenbruchs konnte er sich noch immer kaum bewegen. Der heilte nur sehr langsam. Er war hilflos. Mir hallten, ungewollt, die Worte meiner Mutter im Gedächtnis „Mädel du bist noch so jung, und der Kerl kann nicht mehr sprechen und nicht laufen, wird es wahrscheinlich nie wieder können, wird ein Pflegefall bleiben, du verbaust dir dein ganzes Leben“.
Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich schob den Gedanken ganz schnell beiseite. Schluckte ein paar Mal heftig, wischte mir über die Augen, kämpfte um meine Fassung. Bleierne Angst und Traurigkeit waren meine ständigen Begleiter, sie überlagerten alle anderen Gefühle, zeitweise war mir ganz übel davon. Wenn ich ihn ansah, keimten auch in mir Zweifel auf. Zweifel, ob wir mit der neuen Situation auf Dauer zurechtkämen.
Groteskerweise half es mir in seiner Nähe zu sein, denn dann war ich mir zumindest sicher, dass er lebt.
Ich erzählte ihm von meinem Tag. Die positiven Dinge, nichts von meinen eigenen Ängsten, war fröhlich, versuchte ihn zum Lachen zu bringen. Ich las aus den Büchern vor, die er liebte. Jeden Tag aus den gesammelten Werken von Lord Byron. Seine poetischen Texte waren im Lauf unserer Beziehung zu einem Teil von ihr geworden. Sie stammten aus seinen Briefen und Tagebüchern, wir hatten oft stundenlang darüber gesprochen, was wohl in einem tieferen Sinne gemeint war. Diese Gespräche gehörten nur uns. Es hatte sich zu einem Spiel zwischen uns entwickelt. Er lächelte, vielleicht auch weil die Erinnerung einen kurzen Moment die brutale Wirklichkeit überlagerte.
Den Ulysses fand ich immer sehr langatmig, Micha mochte ihn und es ist ein dickes Buch. Es beschreibt einen einzigen Tag in Dublin, im Leben von Leopold und Molly Blum, sowie Stephen Dadelus. So ähnlich wie Homers Odysseus, nur modern. Den 16. Juni 1904. In achtzehn Episoden werden minutiös alle Geschehnisse, Gefühle, Gedanken der Protogonisten erzählt. Am Ende hat man das Gefühl Leopold Blum besser zu kennen als sich selbst. Das Zitat von James Joyce „Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft, alles verläuft in einer ewigen Gegenwart.“ Erschien mir in unserer jetzigen Situation außerordentlich passend. Henry Millers, ‚Im Wendekreis des Krebses’ war ein anderes Buch das wir beide sehr mochten. Es besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt der Sprache. Ein Buch, das einen in seinen Bann zieht mit Millers ganz eigenem Stil von aufeinander folgenden Tagebucheinträgen. Er beschreibt stark überzeichnet dargestellte Alltagssituationen. Seine allgemeinen philosophischen Überlegungen über das Leben machen das Ganze amüsant und leicht lesbar.
Micha mochte es, wenn ich ihm vorlas, es zerteilte seinen Tag, nahm ein Kleinwenig von der Einförmigkeit, dem immer selben Ablauf, dem immer selben Blick an die Zimmerdecke, den wiederkehrenden Ritualen und den langen einsamen Stunden, gefangen in der Bewegungslosigkeit und Einsamkeit. Wir sprachen mit Blicken miteinander. Damit hielten wir den Funken Hoffnung am Leben, dass wieder bessere Zeiten kommen würden.
Die Schwestern bemerkten meine Verzweiflung, wenn ich aus dem Zimmer kam und machten mir Mut. Es war bewundernswert was diese Menschen tagtäglich leisten. Und welch menschlichem Elend sie gegenüberstehen. Sie versicherten mir immer wieder, dass es ihm hilft wenn er weiß, dass er nicht allein ist.
Doch die Zeiten des Zweifels wurden immer häufiger, in denen ich mir überlegte wie soll das weiter gehen, wie schaffen wir das? Wie kann ich auf Dauer für uns beide Sorgen. Bin ich dem Ganzem gewachsen? In mir vernahm ich Stimmen, die ich nicht hören wollte, Selbstmitleid, Zweifel, Aussichtslosigkeit.
Wenn ich mich den Gedanken hingab, stockte mir der Atem. Ich dachte an unser verwinkeltes, halbrenoviertes Haus und an ein Leben im Rollstuhl und daran nicht mehr miteinander sprechen zu können. An die schwerverständlichen einzelnen Wortfetzen, die er bislang hervorbrachte. Ich überlegte wie das Morgen aussehen sollte.
Nachts war ich starr vor Angst und Panik, wusste nicht, woher ich noch weitere Kraft mobilisieren sollte, um für ihn eine Stütze zu sein. Immer öfter fragte ich mich, ob ich auf Dauer in der Lage war, mit einem Mann, der sich im Stadium eines Kleinkindes befand, den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich hasste mich für meine Zweifel, ich kam mir verwerflich vor. Und doch waren auch diese Gedanken Bestandteil meiner nächtlichen Zwiegespräche.
Ich versuchte sie wegzuschieben, sie zu verdrängen. Meine Seele wollte sich zurückziehen, zurück in eine heile Welt. Du bist anders dachte ich, ein Feenwesen. Ich fing wieder an zu zählen, mir Dinge die ich gesehen hatte ganz genau ins Gedächtnis zurückzuholen. Das beruhigte mich. In meiner Phantasie wurde alles gut. Meine verwirrten Gedanken bewegten sich nur schwerfällig. Sie ist wieder da die unheilbare Wunde, sie brennt und schmerzt. Meine Angst vor der Einsamkeit wuchs, die Zweifel meldeten sich immer lauter zu Wort. Ich wog noch 48 kg bei 175cm Größe, verlor immer mehr Gewicht, meine Kleidung schlabberte lose um meinen Körper. Ich war müde, schrecklich müde. Ich nahm jeden Morgen all meine Kraft zusammen um aufzustehen und weiterzumachen. Und setzte ein Lächeln für den Rest der Welt auf.
Doch das Ende war nah, ich war nur noch überfordert und übermüdet, am Ende meiner Kräfte. Existenzangst beherrschte mein Leben. Am liebsten wäre ich davongelaufen, ich wünschte mir nichts sehnlicher, als endlich Ruhe zu finden. Ich wollte schlafen, einen klaren Kopf bekommen.
Meine Finanzmisere, erkannte ich, konnte ich nicht allein in den Griff bekommen, trotz meiner diversen Nebenjobs. So bin ich dann doch über meinen Schatten gesprungen und bat meinen Vater um Unterstützung. Nach einem langen, inneren Kampf mit mir selbst habe ihn angerufen und mit ihm vereinbart, dass wir uns in seiner Werkstatt treffen. Zu meinen Eltern nach Hause wollte ich nicht, ich hätte meine Mutter nicht ertragen, nicht nach unserem letzten Treffen. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich einem neuerlichen Streit mit ihr standgehalten hätte oder ob die dünne Wand, die mein Innerstes vor der Außenwelt verbarg, zerbersten würde.
In der Werkstatt kam ich mir deplatziert, verloren vor. Wir haben uns angesehen.
„Hallo“, sagte ich laut um die Maschinen zu übertönen.
Mein Vater unterbrach seine Arbeit, schaltete die Bandsäge ab. Stille kehrte ein. Mit der ihm so typischen Handbewegung klopfte er die Sägespäne von seiner Arbeitsjacke. Er roch nach Holz, Zigarettenrauch und Schweiß. Die Vertrautheit der Umgebung gab mir Halt.
„Hallo, du siehst blass aus“, begrüßte er mich.
Er kam auf mich zu und blieb kurz vor mir stehen. Früher hätten wir uns umarmt, jetzt erschien es uns unpassend. Wir gaben uns wenigstens die Hand. In diesem Moment realisierte ich, wie traurig ich darüber war, dass wir uns so fremd geworden waren. Es lag eine unüberbrückbare Distanz zwischen uns.
Intuitiv wusste er, dass ich nicht mit ins Haus kommen wollte, er fragte mich ob ich etwas essen wolle, wir könnten in den Biergarten am See fahren und uns dort in Ruhe unterhalten. Ich aß gerne frisch geräucherte Renken. Er wollte es mir leicht machen. Er sagte, er geht sich noch schnell umziehen, vorher pustete er mir der Pressluft seine Arbeitssachen sauber.
„Wir treffen uns dann dort“, sagte ich während ich ins Auto stieg und losfuhr.
Kurze Zeit später kam mein Vater nach. Er hat nicht viel gesagt, er hat mir einen Umschlag in die Hand gedrückt. Ich schaute nicht hinein, sondern steckte ihn in meine Tasche. Ich glaube, er hätte mich gerne in den Arm genommen. Ich konnte es nicht zulassen. Er hat es gespürt und respektiert, und sich mir gegenüber auf die Bank gesetzt. Er hat beim Fischer frische geräucherte Renken geholt und Brot. Ein himmlisches Mahl, sonst lebte ich von klarer Brühe, billigem Brot oder Nudeln. Etwas anderes konnte ich mir nicht leisten.
Wir haben über Belanglosigkeiten geredet. Er hat mich die ganze Zeit beobachtet, ich wusste, dass er fast nicht hinsehen konnte. Aber er wusste auch: Wenn er versucht, mir zu nahe zu kommen, ergreife ich die Flucht.
„Rufe an, wenn du etwas brauchst, oder reden möchtest“, sagte er zum Abschied.
Viel später erfuhr ich, dass er mit Tom gesprochen hatte. Er wusste viel mehr als ich angenommen hatte. Erst habe ich’s als Verrat empfunden, aber es war aufrichtige Sorge.