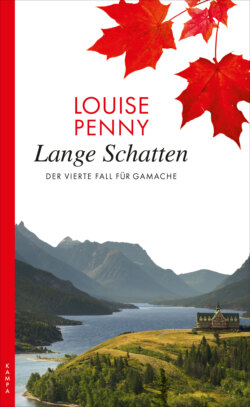Читать книгу Lange Schatten - Louise Penny - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеNachdem sich die Gamaches mit einer Runde im See und einem Gin Tonic auf dem Steg erfrischt hatten, duschten sie und gesellten sich zu den anderen Gästen im Speisesaal. Kerzen brannten in Sturmlampen, und jeder Tisch war mit einem kleinen Blumengesteck aus alten englischen Rosen geschmückt. Auf dem Kaminsims stand ein üppigeres Gesteck, fast eine Skulptur aus Pfingstrosen und Flieder, zartblauem Rittersporn und hinfällig entrücktem Tränendem Herz.
Die Finneys saßen zusammen an einem Tisch, die Männer in Dinnerjacketts, die Frauen in luftigen Sommerkleidern, da es selbst zu dieser Stunde noch warm war. Bean trug weiße Shorts und ein froschgrünes T-Shirt.
Die Gäste sahen zu, wie die Sonne hinter den sanften Hügeln am Lake Massawippi unterging, und genossen dabei die verschiedenen Gänge, angefangen bei dem amuse-bouche aus einheimischem Karibu. Reine-Marie hatte die escargots à l’ail gewählt, gefolgt von gebratener Entenbrust mit einem confit von wildem Ingwer, Mandarine und Kumquat. Gamache aß einen bunten Gartensalat mit gehobeltem Parmesan, danach Wildlachs mit Sauerampferjoghurt.
»Und zum Dessert?« Pierre zog eine Flasche aus dem Weinkühler und schenkte ihnen nach.
»Was können Sie denn empfehlen?« Reine-Marie traute ihren Ohren nicht. Hatte sie das wirklich gefragt?
»Für Madame hätten wir frisches Minzeeis auf einem mit dunkler Bioschokoladencreme gefüllten Eclair, und für Monsieur einen Pudding du chômeur à l’érable avec crème chantilly.«
»Oje«, flüsterte Reine-Marie und wandte sich an ihren Mann. »Wie heißt dieser berühmte Satz von Oscar Wilde noch mal?«
»›Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.‹«
Sie bestellten das Dessert.
Als sie zu guter Letzt keinen einzigen Bissen mehr hätten hinunterbringen können, kam der Käsewagen, beladen mit verschiedenen von den Mönchen in der nahe gelegenen Benediktinerabtei Saint-Benoit-du-Lac hergestellten Käsesorten. Die Brüder führten ein Leben in Kontemplation, sie hielten Vieh, gingen ihrer Arbeit in der Käserei nach und übten sich in gregorianischen Gesängen von so großer Schönheit, dass sie weltberühmt damit geworden waren, was bei Männern, die sich bewusst von der Welt zurückgezogen hatten, nicht einer gewissen Ironie entbehrte.
Während Armand Gamache seinen fromage bleu genoss, blickte er über den See in einen nur langsam verblassenden Himmel, so als würde ein so schöner Tag nur unwillig zu einem Ende kommen. In der Ferne war ein einzelnes Licht zu sehen. Ein Cottage. Es wirkte keineswegs wie ein Eindringling in der unberührten Natur, im Gegenteil, es hatte etwas Anheimelndes. Gamache stellte sich vor, dass eine Familie am Ufer saß und nach Sternschnuppen Ausschau hielt oder in der schlichten Stube beim Licht von Propangaslampen Rommé, Scrabble oder Cribbage spielte. Sie hatten natürlich Strom dort, aber ihm gefiel die Vorstellung, dass Menschen, die tief in den Wäldern von Québec lebten, nur Gaslampen benutzten.
»Ich habe heute mit Roslyn in Paris gesprochen.« Reine-Marie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, der dabei leise knarrte.
»Wie geht es ihr?« Gamache musterte das Gesicht seiner Frau, obwohl er wusste, dass, wenn es ein Problem gäbe, sie ihm dies schon längst mitgeteilt hätte.
»So gut wie nie. Noch zwei Monate. Es wird also im September zur Welt kommen. Ihre Mutter fliegt nach Paris, um sich um Florence zu kümmern, wenn das Kleine da ist, und Roslyn hat gefragt, ob wir nicht auch kommen wollen.«
Er lächelte. Sie hatten natürlich schon darüber geredet. Nichts könnte sie davon abhalten, ihre Enkelin Florence, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter zu besuchen. Und das neue Baby. Jedes Mal, wenn Gamache daran dachte, überkam ihn ein schier unfassbares Glücksgefühl. Allein die Vorstellung, dass sein Kind selbst ein Kind hatte, schien ihm geradezu unglaublich.
»Sie haben schon Namen ausgesucht«, sagte sie beiläufig. Aber Gamache kannte seine Frau, ihr Gesicht, ihre Hände, ihren Körper, ihre Stimme. Und die Stimme hatte plötzlich einen etwas anderen Ton angenommen.
»Erzähl.« Er legte die Gabel mit dem Käse auf den Teller und faltete seine großen, ausdrucksstarken Hände auf der weißen Damasttischdecke.
Reine-Marie sah ihren Ehemann an. Er wirkte immer so ruhig und gelassen, was aber nur noch zu dem Eindruck von Stärke beitrug.
»Wenn es ein Mädchen wird, soll sie Geneviève Marie Gamache heißen.«
Gamache wiederholte den Namen. Geneviève Marie Gamache. »Das klingt schön.«
War das der Name, den sie auf Geburtstags- und Weihnachtskarten schreiben würden? Geneviève Marie Gamache. Würde die Kleine auf kurzen Beinchen die Treppe zu ihrer Wohnung in Outremont hochrennen und laut »Grandpapa, Grandpapa!« rufen? Und würde er »Geneviève« rufen und sie mit seinen starken Armen auffangen und sie sicher und warm an seine Brust drücken, was den Menschen vorbehalten war, die er liebte? Würde er sie und ihre Schwester Florence eines Tages auf Spaziergänge durch den Parc Mont Royal mitnehmen und ihnen seine Lieblingsgedichte beibringen?
Wo lebt ein Mensch so seelenschwach,
Dass er noch niemals bei sich sprach:
»Das ist mein Land, mein Heimatland!«
So wie es sein eigener Vater getan hatte.
Geneviève.
»Und wenn es ein Junge wird«, fuhr Reine-Marie fort, »wollen sie ihn Honoré nennen.«
Schweigen. Schließlich sagte Gamache: »Aha«, und senkte den Blick.
»Das ist ein wunderschöner Name, Armand, und eine noch schönere Geste.«
Gamache nickte, sagte aber immer noch kein Wort. Er hatte sich schon manchmal gefragt, was er empfände, wenn dieser Fall eintreten sollte. Aus irgendeinem Grund hatte er damit gerechnet, vielleicht weil er seinen Sohn kannte. Sie waren sich so ähnlich. Groß und kräftig gebaut, sanftmütig. Und hatte er damals nicht selbst mit sich gerungen, ob er Daniel Honoré nennen sollte? Bis zum Tag der Taufe hatte er Honoré Daniel heißen sollen.
Aber dann hatte er es seinem Sohn doch nicht antun wollen. War das Leben nicht auch ohne einen Namen wie Honoré Gamache schon schwer genug?
»Er bittet dich, ihn anzurufen.«
Gamache sah auf seine Uhr. Fast zehn. »Ich melde mich morgen früh bei ihm.«
»Und was willst du ihm sagen?«
Gamache drückte die Hände seiner Frau und ließ sie wieder los, dann lächelte er sie an. »Wie wäre es mit Espresso und einem Glas Likör im Salon?«
Sie sah ihn fragend an. »Möchtest du dir nicht kurz die Beine vertreten? Ich werde mich um den Espresso kümmern.«
»Danke, meine Liebe.«
»Ich warte auf dich.«
»Wo lebt ein Mensch so seelenschwach«, murmelte Armand Gamache, während er langsam die Dunkelheit durchmaß. Der süße Duft des nächtlichen Gartens begleitete ihn und die Sterne, den Mond und das Licht von der anderen Seite des Sees. Von der Familie im Wald. Seiner Phantasiefamilie. Vater, Mutter und glückliche, gedeihende Kinder.
Kein Leid, kein Verlust, kein scharfes Klopfen abends an der Tür.
In diesem Moment ging das Licht am anderen Ufer aus, und alles war in völlige Dunkelheit getaucht. Die Familie hatte sich friedlich schlafen gelegt.
Honoré Gamache. War das wirklich so falsch? War es falsch, was er empfand? Was sollte er Daniel morgen früh sagen?
Er starrte ins Leere und dachte kurz nach, bis er bemerkte, dass sein Blick auf etwas Leuchtendem ruhte. Vor dem Wald. Er sah sich um, ob jemand in der Nähe war, ein weiterer Zeuge. Aber Terrasse und Garten lagen verwaist da.
Neugierig ging Gamache über das weiche Gras darauf zu. Er warf einen Blick zurück auf die fröhlich funkelnden Lichter des Manoir und die Leute, die sich durch die Zimmer bewegten. Dann drehte er sich wieder um.
Der Wald lag dunkel da. Aber nicht still. Tiere liefen darin herum, Zweige knackten, gelegentlich war ein leises Krachen zu hören, wenn etwas von den Bäumen zu Boden fiel. Gamache hatte keine Angst vor der Dunkelheit, aber wie die meisten phantasiebegabten Kanadier fürchtete er sich ein kleines bisschen vor dem Wald.
Aber das weiß leuchtende Ding dort rief nach ihm, und er fühlte sich unwiderstehlich davon angezogen, so wie Odysseus von den Sirenen.
Es stand direkt am Waldrand. Er ging darauf zu, überrascht, wie groß es war, ein gleichmäßiger Quader ähnlich einem riesigen Zuckerwürfel. Er reichte ihm bis zur Hüfte, und Gamache streckte die Hand aus, nur um sie sofort wieder zurückzuziehen. Die Oberfläche war kalt, fast klamm. Er streckte erneut die Hand aus, entschlossener dieses Mal, und ließ sie einen Moment auf dem Ding ruhen. Er lächelte.
Es war aus Marmor. Er hatte Angst vor einem Marmorblock gehabt, dachte er und musste über sich lachen. Wie peinlich. Gamache trat einen Schritt zurück und starrte ihn an. Der weiße Stein leuchtete, als hätte er das wenige Mondlicht, das auf ihn fiel, eingefangen. Es war nichts als ein Marmorblock, sagte er sich. Kein Bär, kein Puma. Nichts Beängstigendes, nichts, was irgendwie unheimlich war. Aber er fand es dennoch unheimlich. Es erinnerte ihn an etwas.
»Peters praller pinker Pickel platzt.«
Gamache erstarrte.
»Peters praller pinker Pickel platzt.«
Da war es wieder.
Er drehte sich um und sah eine Gestalt mitten auf dem Rasen. Sie war von einer durchsichtigen Nebelschwade umgeben, und unter ihrer Nase glühte ein roter Punkt.
Julia Martin war nach draußen gekommen, um heimlich eine Zigarette zu rauchen. Gamache räusperte sich laut und raschelte mit der Hand durch einen Busch. Sofort fiel der rote Punkt zu Boden und verschwand unter einem zierlichen Fuß.
»Guten Abend«, rief sie heiter, auch wenn Gamache bezweifelte, dass sie wusste, wem sie gegenüberstand.
»Guten Abend, Madame«, sagte Gamache mit einer kleinen Verbeugung, nachdem er zu ihr getreten war. Sie war schlank und trug ein elegantes Abendkleid. Ihre Haare waren frisch frisiert, und sie hatte sich geschminkt und die Nägel lackiert, obwohl sie doch hier in der Wildnis waren. Sie wedelte mit ihrer schlanken Hand vor ihrem Gesicht herum, um den beißenden Zigarettenrauch zu vertreiben.
»Mücken«, sagte sie. »Kriebelmücken. Das Einzige, was einem die Ostküste verleiden kann.«
»Gibt es im Westen keine Kriebelmücken?«, fragte er.
»In Vancouver nicht. Ein paar Pferdebremsen auf dem Golfplatz. Sie können einen allerdings in den Wahnsinn treiben.«
Das konnte sich Gamache gut vorstellen, nachdem er selbst einmal von Pferdebremsen verfolgt worden war.
»Zum Glück hält einem der Zigarettenrauch die Viecher vom Leib«, sagte er mit einem Lächeln. Sie zögerte, dann kicherte sie. Sie war ein umgänglicher Mensch und lachte oft und gerne. Vertraulich berührte sie seinen Arm, obwohl sie keineswegs auf vertrautem Fuße miteinander standen. Aber sie trat einem damit nicht zu nahe, es war reine Gewohnheit. Als er sie in den letzten Tagen beobachtet hatte, hatte er bemerkt, dass sie jeden anfasste. Und jeden anlächelte.
»Sie haben mich ertappt, Monsieur. Beim heimlichen Rauchen. Ist das nicht lächerlich?«
»Hätte Ihre Familie etwas dagegen?«
»In meinem Alter kümmere ich mich schon längst nicht mehr darum, was andere von mir denken.«
»Ist das wahr? Ich wünschte, bei mir wäre das auch so.«
»Na ja, vielleicht kümmert es mich ein bisschen«, gab sie zu. »Ich war länger nicht mehr mit meiner Familie zusammen.« Als sie sich zum Manoir wandte, folgte er ihrem Blick. Drinnen beugte sich Thomas gerade zu seiner Mutter und sagte etwas zu ihr, während Sandra und Mariana zusahen, schweigend und ohne zu bemerken, dass sie beobachtet wurden.
»Als die Einladung eintraf, wollte ich zuerst eigentlich nicht kommen. Dieses Familientreffen findet einmal im Jahr statt, müssen Sie wissen, aber ich habe mich bisher immer davor gedrückt. Es ist so weit von Vancouver.«
Sie konnte die Einladung noch vor sich sehen, wie sie mit der Anschrift nach oben auf dem polierten Parkett in ihrer Eingangshalle lag und aussah, als sei sie aus großer Höhe heruntergefallen. Sie kannte dieses Gefühl. Sie hatte den dicken weißen Umschlag mit der allzu bekannten krakeligen Handschrift angestarrt. Es war ein Willenskampf. Aber sie wusste, wer gewinnen würde. Wer immer gewann.
»Ich will sie nicht enttäuschen«, sagte Julia Martin schließlich leise.
»Das können Sie doch gar nicht.«
Sie wandte sich ihm mit großen Augen zu. »Meinen Sie?«
Er hatte es aus reiner Höflichkeit gesagt. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie die Finneys zueinander standen.
Sie sah, dass er zögerte, und lachte erneut. »Verzeihen Sie mir, Monsieur. Jeden Tag, den ich mit meiner Familie verbringe, regrediere ich um zehn Jahre. Mittlerweile fühle ich mich wie ein linkischer, unsicherer Teenager. Heimlich zum Rauchen in den Garten zu verschwinden! Sie eigentlich auch?«
»Im Garten rauchen? Nein, das mache ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich wollte mir nur die Beine vertreten.«
»Passen Sie bloß auf. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen etwas zustößt.« Sie schien ein wenig mit ihm zu flirten.
»Ich passe immer auf, Madame Martin«, sagte Gamache, ohne darauf einzugehen. Er vermutete, dass das ihrem normalen Umgangston entsprach und sie eigentlich nichts weiter damit im Sinn hatte. Er hatte sie nun schon seit einigen Tagen beobachtet, und sie redete mit allen so, Männern wie Frauen, Fremden wie Verwandten, Hunden, Eichhörnchen, Kolibris. Kokett, nett.
Aus dem Augenwinkel sah er eine Bewegung. Er hatte den Eindruck, etwas Weißes wäre vorbeigezischt, und einen Moment lang setzte sein Herzschlag aus. War das Marmording zum Leben erwacht? Kam es etwa vom Waldrand auf sie zu? Er drehte sich um und sah auf der Terrasse eine Gestalt im Schatten verschwinden. Im nächsten Moment tauchte sie wieder auf.
»Elliott«, rief Julia Martin, »wie schön. Sie bringen mir sicher meinen Brandy und Bénédictine, oder?«
»Ja, Madame.« Der junge Kellner lächelte, als er das Glas von dem Silbertablett nahm und ihr reichte. Dann wandte er sich an Gamache. »Und für Monsieur? Darf ich Ihnen auch etwas bringen?«
Er sah so jung aus, so unbedarft.
Und doch wusste Gamache, dass der junge Mann an der Ecke des Hauses gestanden und sie beobachtet hatte. Warum?
Dann musste er über sich selbst lachen. Er sah Dinge, die nicht da waren, hörte Worte, die nicht gesprochen wurden. Eigentlich war er ins Manoir Bellechasse gekommen, um genau das abzustellen, er wollte sich entspannen und nicht mehr jeden Flecken auf dem Teppich verdächtig finden und überall Messer blitzen sehen. Nicht mehr die versteckten Gemeinheiten wahrnehmen, die sich im Gewand ganz normaler Worte in ein Gespräch schleichen konnten. Und die Empfindungen, die glatt gestrichen, gefaltet und in etwas anderes verwandelt wurden, wie eine Art Gefühlsorigami. Es sah hübsch aus, aber dahinter verbarg sich oft etwas ganz und gar Abstoßendes.
Es war schlimm genug, dass er sich angewöhnt hatte zu überlegen, ob die älteren Nebendarsteller noch lebten, wenn er einen alten Film sah. Und wie sie gestorben waren. Aber wenn er anfing, bei ganz normalen Passanten auf der Straße den Schädel unter der Haut zu erkennen, war es an der Zeit abzuschalten.
Und doch musterte er jetzt misstrauisch den jungen Kellner Elliot und war nahe daran, ihn des Hinterherspionierens zu bezichtigen.
»Nein, danke. Madame Gamache hat schon für mich im Salon bestellt.«
Julia sah Elliot nach, als er sich zurückzog.
»Ein attraktiver junger Mann«, sagte Gamache.
»Finden Sie?«, fragte sie mit amüsierter Stimme, ohne dass man ihre Miene im Dunkeln erkennen konnte. Dann fuhr sie fort: »Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich einmal einen ähnlichen Job hatte, als ich ungefähr so alt war wie er, allerdings lange nichts so Großartiges wie das Hotel hier. Es war ein Ferienjob in einem Imbiss auf der Main in Montréal. Sie wissen schon, Boulevard Saint-Laurent.«
»Ja, kenne ich.«
»Natürlich. Verzeihen Sie. Ein übler Laden. Der Besitzer zahlte einen Hungerlohn und konnte seine Pfoten nicht von mir lassen. Ekelhaft.«
Sie hielt inne.
»Aber ich war begeistert. Mein erster Job. Ich hatte meinen Eltern erzählt, dass ich einen Segelkurs im Jachtklub machte, und sprang stattdessen in den 24er und fuhr nach Osten. Unbekanntes Terrain für Anglos in den Sechzigern. Eine richtige Mutprobe«, sagte sie mit unüberhörbarer Selbstironie in der Stimme. Gamache konnte sich jedoch an die Zeit erinnern und wusste, dass sie recht hatte.
»Ich erinnere mich an meinen ersten Gehaltsscheck. Ich zeigte ihn zu Hause meinen Eltern. Wissen Sie, was meine Mutter sagte?«
Gamache schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Sie betrachtete den Scheck, dann gab sie ihn mir zurück und sagte, ich sei bestimmt stolz auf mich. Und das war ich auch. Aber es war klar, dass sie eigentlich etwas anderes meinte. Und da tat ich etwas sehr Dummes. Ich fragte sie, was sie meinte. Seither weiß ich, dass ich keine Fragen stellen sollte, wenn ich nicht auf die Antwort vorbereitet bin. Sie sagte, ich sei privilegiert und würde das Geld überhaupt nicht brauchen, jemand anderes allerdings schon. Im Grunde hätte ich es einem armen Mädchen gestohlen, das den Job tatsächlich brauchen würde.«
»Das ist nicht nett«, sagte Gamache. »Aber sie hat es doch bestimmt nicht so gemeint.«
»Doch, das hat sie, und sie hatte recht. Am nächsten Tag habe ich gekündigt, aber gelegentlich ging ich an dem Laden vorbei und warf einen Blick durchs Fenster, um der neuen Bedienung bei der Arbeit zuzusehen. Und ich war glücklich.«
»Armut kann die Menschen erdrücken«, sagte Gamache leise. »Aber das kann ein privilegiertes Leben auch.«
»Ich habe das Mädchen sogar beneidet«, sagte Julia. »Dumm, ich weiß. Romantisch. Ich bin sicher, dass sie kein leichtes Leben hatte. Aber ich dachte, dass es vielleicht wenigstens ihr eigenes ist.« Sie lachte und nippte an ihrem Glas. »Sehr gut. Meinen Sie, dass er von den Mönchen hier in der Abtei stammt?«
»Der Bénédictine? Ich weiß es nicht.«
Sie lachte. »Diese Worte höre ich nicht oft.«
»Welche Worte?«
»›Ich weiß es nicht.‹ Meine Familie weiß immer alles. Mein Mann weiß immer alles.«
Die letzten Tage hatten sie über das Wetter geplaudert, den Garten, das Essen im Manoir. Das war das erste ernsthafte Gespräch, das er mit einem der Finneys führte, und es war das erste Mal, dass diese Frau ihren Ehemann erwähnte.
»Ich bin schon ein paar Tage früher ins Manoir gekommen. Um …«
Sie schien nicht zu wissen, was sie sagen sollte, und Gamache wartete. Er hatte alle Zeit und Geduld der Welt.
»Ich bin gerade dabei, mich scheiden zu lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.«
»Ich habe davon gehört.«
Die meisten Kanadier hatten davon gehört. Julia Martin war mit David Martin verheiratet, dessen spektakulärer wirtschaftlicher Erfolg und noch spektakulärerer Niedergang von den Medien genüsslich auseinandergenommen worden war. Er hatte sein Vermögen mit Versicherungen gemacht und war zu einem der reichsten Männer Kanadas aufgestiegen. Sein Niedergang hatte vor einigen Jahren begonnen. Er hatte sich quälend lange hingezogen, so als rutsche jemand einen schlammigen Abhang hinunter. Man hatte ständig den Eindruck, er könnte die Talfahrt aufhalten, aber stattdessen sammelte sich dabei immer schneller immer mehr Schlamm und Dreck an. Bis es schließlich selbst seine Feinde nicht mehr mit ansehen konnten.
Er hatte alles verloren, sogar seine Freiheit.
Seine Frau hatte ihm beigestanden. Groß, elegant, würdevoll. Statt mit ihrem privilegierten Leben Neid zu wecken, hatte sie es irgendwie geschafft, die Zuneigung der Leute zu gewinnen. Die Leute mochten ihre Fröhlichkeit, die sich mit Sensibilität paarte. Ihre Würde und Aufrichtigkeit machten es möglich, sich mit ihr zu identifizieren. Zu guter Letzt bewunderten sie diese Frau sogar, weil sie sich öffentlich entschuldigte, als schließlich klar war, dass ihr Mann alle und jeden angelogen und Zehntausende von Menschen um ihre gesamten Ersparnisse gebracht hatte. Und sie hatte versprochen, das Geld zurückzuzahlen.
Inzwischen saß David Martin in einem Staatsgefängnis in British Columbia ein, und Julia Martin war nach Hause zurückgekehrt. Sie würde nach Toronto ziehen, hatte sie der Presse erklärt, kurz bevor sie verschwunden war. Und jetzt war sie hier, in Québec. Mitten in den Wäldern.
»Ich wollte mich vor dem Familientreffen ausruhen, endlich wieder zu Atem kommen. Ich bin gern für mich allein. Das habe ich vermisst.«
»Verstehe«, sagte er. Und das tat er. »Aber eines begreife ich nicht.«
»Ja?« Sie klang wachsam, wie eine Frau, die es gewohnt war, dass ihr allzu persönliche Fragen gestellt werden.
»Peters praller pinker Pickel platzt?«
Sie lachte. »Das ist so ein Spruch aus unserer Kindheit.«
Auf einer Hälfte ihres Gesichts spielte das goldene Licht aus dem Manoir. Die beiden standen schweigend da und sahen zu, wie die Leute von Zimmer zu Zimmer gingen. Es war fast so, als würden sie einer Theateraufführung beiwohnen. Die Bühne erleuchtet und für verschiedene Szenen verschiedene Kulissen, durch die sich die Schauspieler bewegten.
Er sah wieder zu seiner Gesprächspartnerin und wunderte sich. Warum war der Rest der Familie im Haus und sie hier draußen im Dunkeln, allein, und beobachtete sie?
Sie hatten sich im Salon mit der hohen Holzdecke und den edlen Möbeln versammelt. Mariana ging gerade zum Klavier, wurde aber von Madame Finney wieder verscheucht.
»Die arme Mariana.« Julia lachte. »Es ändert sich doch nie etwas. Magilla kommt nie dazu zu spielen. Thomas ist der Musiker in der Familie, so wie mein Vater. Er war sehr talentiert.«
Gamache ließ seinen Blick zu dem alten Mann auf dem Sofa wandern. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die gichtigen Hände gefällige Klänge hervorbrachten, aber wahrscheinlich waren sie ja nicht immer so verkrüppelt gewesen.
Thomas setzte sich auf die Klavierbank, hob die Hände und schickte sich an, die Nachtluft mit einer Melodie von Bach zu erfüllen.
»Er spielt wunderschön«, sagte Julia. »Das hatte ich ganz vergessen.«
Gamache stimmte ihr zu. Durchs Fenster sah er, wie Reine-Marie Platz nahm und ein Kellner zwei Espressi und zwei Gläser Cognac vor sie stellte. Er wollte zurück ins Haus.
»Es fehlt übrigens noch einer von uns.«
»Ach?«
Sie hatte versucht, es zu verbergen, aber Gamache war der Unterton in ihrer Stimme nicht entgangen.
Reine-Marie rührte ihren Espresso um und hatte den Kopf dem Fenster zugewandt. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte. Da sie im Licht saß, sah sie mit Sicherheit nur die Spiegelung des Zimmers in der Scheibe.
Hier bin ich, flüsterte seine Seele. Hier drüben.
Sie drehte den Kopf ein wenig weiter, sodass ihre Augen direkt auf ihn gerichtet waren.
Das war natürlich Zufall. Aber der Teil von ihm, der auf die Vernunft nicht viel gab, war überzeugt, dass sie ihn gehört hatte.
»Morgen kommt Spot, mein jüngerer Bruder. Er bringt wahrscheinlich seine Frau Claire mit.«
Es war das erste Mal, dass er Julia Martin etwas sagen hörte, das nicht freundlich oder nett war. An den Worten lag es jedoch nicht, sie waren neutral. Der Ton war verräterisch.
Er war voller Angst.
Sie kehrten zum Manoir Bellechasse zurück, und als Gamache Julia Martin die Tür aufhielt, fiel sein Blick erneut auf den Marmorblock am Waldrand. Er konnte nur eine Ecke davon sehen, aber plötzlich wusste er, woran er ihn erinnerte.
An einen Grabstein.