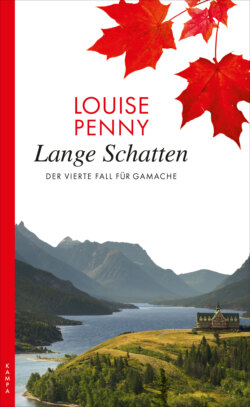Читать книгу Lange Schatten - Louise Penny - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление»Was für ein schöner Abend«, sagte Reine-Marie und schlüpfte neben ihrem Mann zwischen die kühlen, glatten Laken.
»Ja, das fand ich auch.« Er nahm seine Lesebrille ab und legte sein Buch aufgeklappt aufs Bett. Es war warm. Ihr winziges Hinterzimmer hatte nur ein Fenster, das zum Küchengarten hinaussah, das heißt, man konnte keinen Durchzug machen, aber sie hatten es weit aufgerissen, und die Musselinvorhänge bauschten sich in einer leichten Brise. Abgesehen von dem Licht ihrer Nachttischlampen, lag der Raum im Dunkeln. Es roch nach dem Holz der Wände und frischer Kiefer aus dem Wald, und vom Kräutergarten her wehte ein zarter, süßlicher Geruch zu ihnen herein.
»Noch zwei Tage, dann ist unser Hochzeitstag«, sagte Reine-Marie. »Der erste Juli. Denk nur, fünfunddreißig Jahre. Wie jung wir waren.«
»Ich vor allem. Und unschuldig.«
»Armer Junge. Habe ich dir große Angst eingejagt?«
»Ein bisschen vielleicht. Aber inzwischen habe ich sie überwunden.«
Reine-Marie lehnte sich gegen ihr Kissen. »Ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue, morgen den Rest der Finneys kennenzulernen.«
»Spot und Claire. Spot muss ein Spitzname sein.«
»Hoffen wir mal.«
Er nahm erneut sein Buch und versuchte zu lesen, aber die Lider wurden ihm schwer und fielen ständig zu, mochte er auch noch so sehr dagegen ankämpfen. Als ihm klar wurde, dass das ein Kampf war, den er weder gewinnen konnte noch musste, gab er auf. Er küsste Reine-Marie, ließ seinen Kopf auf das Kissen sinken und fiel zu dem Chor der Nachttiere draußen und dem Duft seiner Frau neben ihm in Schlaf.
Pierre Patenaude stand an der Tür zur Küche. Sie war sauber und aufgeräumt, alles war an seinem Platz. Die Gläser standen in Reih und Glied, das Silber lag in seinen Kästen, Geschirr war mit feinen Stofflappen zwischen den Tellern sorgfältig gestapelt. Das hatte er von seiner Mutter gelernt. Sie hatte ihm beigebracht, dass Ordnung Freiheit bedeutete. Chaos konnte ein Gefängnis sein. Ordnung befreite den Geist für andere Dinge.
Von seinem Vater hatte er gelernt, wie man Menschen führte. Wann immer er in seiner Kindheit einen schulfreien Tag hatte, durfte er ihn in seinem Büro besuchen. Dann saß er auf dem Schoß seines Vaters und roch dessen Rasierwasser und Tabak, während er telefonierte. Schon als Kind wusste Pierre, dass man ihn auf eine Aufgabe vorbereitete. Zurechtstutzte und formte, polierte und schliff.
Wäre sein Vater enttäuscht von ihm gewesen? Weil er es nur zu einem Maître d’hôtel gebracht hatte? Er glaubte nicht. Sein Vater wollte eigentlich immer nur eines für ihn. Dass er glücklich war. Er drehte das Licht aus und ging durch den verlassenen Speisesaal in den Garten, um sich noch einmal den Marmorblock anzusehen.
Mariana summte vor sich hin, während sie sich Schicht um Schicht aus ihren Kleidern schälte. Dabei sah sie von Zeit zu Zeit zu dem schmalen Bett, das neben ihrem stand. Bean schlief schon oder tat zumindest so.
»Bean?«, flüsterte sie. »Gib deiner Mommy einen Gutenachtkuss, Bean.«
Das Kind war still. Anders als das Zimmer. Fast jede freie Fläche war mit Weckern vollgestellt. Digitalwecker, elektrische Wecker und solche zum Aufziehen. Alle auf sieben Uhr gestellt. Alle bewegten sich unerbittlich auf diese Uhrzeit zu, wie sie es seit Monaten Tag für Tag machten. Sie schienen sogar dauernd mehr zu werden.
Mariana fragte sich, ob es nicht langsam zu weit ging. Ob sie etwas unternehmen sollte. Das konnte doch nicht normal sein bei einem zehnjährigen Kind, oder? Was als ein neuer Wecker pro Jahr begonnen hatte, hatte sich unkrautartig vermehrt und Beans Zimmer zu Hause inzwischen völlig überwuchert. Der allmorgendliche Lärm war kaum auszuhalten. Sie bekam von ihrem Schlafzimmer aus mit, wie ihr merkwürdiges Kind die Wecker einen nach dem anderen ausmachte, bis endlich das letzte blecherne Rasseln verklungen war.
Das konnte doch nicht normal sein.
Wobei an Bean eine ganze Menge nicht normal war. Insofern wäre es ein bisschen so, als versuche sie, den Brunnen zuzudecken, nachdem das Kind hineingefallen war, wenn sie jetzt psychologische Hilfe suchte, dachte Mariana. Sie zog das Buch unter Beans Hand hervor, lächelte und legte es auf den Boden. Es war auch eines ihrer Lieblingsbücher gewesen, und sie fragte sich, welche Geschichte Bean am liebsten mochte. Odysseus? Pandora? Herakles?
Als sich Mariana vorbeugte, um Bean einen Kuss zu geben, bemerkte sie das alte Textilkabel an dem Lüster. Vor ihrem geistigen Auge sah sie einen Funken in einem leuchtenden Bogen auf das Bett fallen, das zuerst zu schwelen und dann zu brennen begann, während sie beide schliefen.
Sie trat einen Schritt zurück, schloss die Augen und richtete wieder die unsichtbare Mauer um Bean herum auf.
Jetzt konnte nichts mehr passieren.
Sie drehte das Licht aus und legte sich ins Bett, sie fühlte sich wabbelig und verschwitzt. Je näher sie ihrer Mutter kam, desto schwerer wurde sie, so als hätte ihre Mutter eine eigene Atmosphäre und Schwerkraft. Morgen würde Spot eintreffen, und es würde anfangen. Und aufhören.
Sie versuchte, eine bequeme Stellung zu finden, aber die Nacht schloss sich mit festem Griff um sie, und die Decke lag schwer wie Blei auf ihr. Sie strampelte sich frei. Aber was wirklich zwischen ihr und dem Schlaf stand, war weder die widerliche Hitze noch das schnarchende Kind oder die schwere Bettdecke.
Es war eine Banane.
Warum stichelten sie immer gegen sie? Und warum machte es ihr mit ihren siebenundvierzig Jahren immer noch so viel aus?
Sie drehte sich um, um einen kühlen Fleck unter der jetzt schon völlig verschwitzten Decke zu finden.
Banane. Und wieder hörte sie ihr Lachen. Und sah ihre Blicke.
Denk nicht dran, ermahnte sie sich. Sie schloss die Augen und versuchte, nicht an die Banane zu denken und nicht an das Ticktack der Wecker in ihrem Kopf.
Julia Martin saß an dem Toilettentisch und nahm ihre Perlenkette ab. Schlicht und elegant, ein Geschenk ihres Vaters zu ihrem achtzehnten Geburtstag.
»Eine Lady gibt sich stets zurückhaltend«, hatte er gesagt. »Sie drängt sich nie in den Vordergrund. Sie nimmt anderen ihre Befangenheit. Vergiss das nicht.«
Und sie hatte es nicht vergessen. Sie hatte sofort gewusst, dass er recht hatte mit dem, was er sagte. Und plötzlich waren die Unbeholfenheit, die Ungewissheit und die Einsamkeit, die sie in ihrer Pubertät empfunden hatte, verschwunden. Vor ihr erstreckte sich ein gerader Weg. Schmal, das ja, aber gerade. Sie empfand eine grenzenlose Erleichterung. Sie hatte ein Ziel, eine Richtung. Sie wusste, wer sie war und was sie zu tun hatte. Anderen ihre Befangenheit nehmen.
Sie legte ihre Kleider ab und ging den Tag im Kopf noch einmal durch, um eine Liste der Leute aufzustellen, die sie womöglich verletzt hatte, der Leute, die sie wegen irgendetwas, das sie gesagt oder getan hatte, womöglich nicht mochten.
Und sie dachte an den netten Frankokanadier und ihr Gespräch im Garten. Er hatte sie beim Rauchen ertappt. Was musste er von ihr halten? Und dann hatte sie auch noch mit dem jungen Kellner geflirtet und einen Drink angenommen. Trinken, rauchen, flirten.
Oje, er musste sie für oberflächlich und schwach halten.
Sie gelobte für den nächsten Tag Besserung.
Sie ließ den Perlenstrang wie eine junge Schlange auf sein blaues Samtbett gleiten, dann nahm sie ihre Ohrringe ab und wünschte, dabei auch gleich ihre Ohren abnehmen zu können. Aber dafür war es sowieso zu spät.
Die Eleanor-Rose. Warum machten sie das nur? Nach all den Jahren und obwohl sie sich so bemühte, nett zu sein, warum brachten sie da diese blöde Rose wieder aufs Tapet?
Denk nicht dran, ermahnte sie sich, es ist egal. Es ist ein Witz. Mehr nicht.
Aber die Worte waren schon bis tief in ihr Inneres gedrungen und nicht mehr zu vertreiben.
Im Nachbarzimmer, dem Seezimmer, stand Sandra unter einem funkelnden Sternenhimmel auf dem Balkon und fragte sich, wie sie es zuwege bringen konnten, beim Frühstück den besten Tisch zu bekommen. Sie war es überdrüssig, immer als Letzte bedient zu werden, immer nachfragen zu müssen und selbst dann noch garantiert die kleinsten Portionen zu bekommen.
Und dieser Armand war der schlechteste Bridgespieler aller Zeiten. Warum hatte gerade sie mit ihm zusammenspielen müssen? Die Hotelangestellten scharwenzelten ständig um ihn und seine Frau herum, bestimmt, weil sie Frankokanadier waren. Eigentlich ein Skandal. Sie schliefen in dieser Besenkammer, dem billigsten Zimmer im ganzen Manoir. Wahrscheinlich ein Krämer und seine Gattin, die Putzfrau. Dass sie überhaupt im selben Hotel nächtigen mussten, war schon eine Riesenungerechtigkeit. Aber dennoch hatte sie es bislang ihnen gegenüber nicht an Höflichkeit fehlen lassen. Mehr konnte man wirklich nicht erwarten.
Sandra hatte Hunger. Und sie war wütend. Und müde. Und morgen würde Spot eintreffen und alles nur noch schlimmer machen.
Aus ihrem luxuriösen Zimmer heraus betrachtete Thomas den steifen Rücken seiner Gattin.
Er hatte eine schöne Frau geheiratet, und aus einer gewissen Distanz und von hinten war sie noch immer umwerfend.
Nur schien ihr Kopf seit Kurzem gewachsen und der Rest geschrumpft zu sein, so als hätte er nun eine Art Luftmatratze an seiner Seite, aus der die Luft entwichen war. Orangefarben und weich und schlaff und eigentlich zu nichts mehr nutze.
Während Sandra ihm den Rücken zuwandte, nahm er mit einer schnellen, geübten Handbewegung die alten Manschettenknöpfe ab, die ihm sein Vater zu seinem achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte.
»Die hat mir einmal mein Vater geschenkt, und jetzt ist es an der Zeit, sie an dich weiterzugeben«, hatte sein Vater gesagt. Thomas hatte die Manschettenknöpfe und den abgegriffenen Samtbeutel, der dazugehörte, genommen und sie mit einer möglichst lässigen Bewegung, mit der er seinen Vater verletzen wollte, in seine Hosentasche befördert. Und tatsächlich, es war ihm gelungen.
Sein Vater schenkte ihm nie wieder etwas. Nie.
Rasch legte er sein altes Jackett und das Hemd ab, froh, dass niemand bemerkt hatte, wie abgewetzt die Manschetten waren. In diesem Moment trat Sandra durch die Tür. Lässig warf er das Hemd und das Jackett über einen Stuhl.
»Warum musstest du mir beim Bridge eigentlich widersprechen?«, fragte sie.
»Habe ich das?«
»Sicher. Vor deiner ganzen Familie und diesem Paar, dem Krämer und seiner Putzfrau.«
»Die Putzfrau war ihre Mutter«, verbesserte Thomas sie.
»Siehst du, schon wieder. Ich kann nichts sagen, ohne dass du mich verbesserst.«
»Willst du etwa Dinge in die Welt setzen, die nicht stimmen?«
Wie oft hatten sie im Laufe ihres Ehelebens diesen Pfad schon beschritten.
»Na gut, was habe ich also gesagt?«, fragte er schließlich.
»Du weißt genau, was du gesagt hast. Dass Birnen am besten zu geschmolzener Schokolade passen.«
»Wie bitte? Um Birnen geht es?«
So wie er es sagte, klang es lächerlich, aber Sandra wusste genau, dass es das nicht war. Sie wusste, dass es wichtig war. Entscheidend.
»Ja, Birnen. Ich sagte Erdbeeren, und du sagtest Birnen.«
Allmählich fand sie es selbst ein wenig banal.
»Ich finde Birnen eben besser«, sagte er.
»Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass du zu diesem Thema überhaupt eine Meinung hast!«
Dieses ganze Gerede über warme Schokolade, die von frischen Erdbeeren oder, wenn es sein musste, auch Birnen tropfte, ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie sah sich nach den kleinen Schokoladentäfelchen um, die in Hotels auf die Kissen gelegt wurden. Suchte ihre Seite des Betts ab, seine Seite, die Kissen, das Nachttischchen. Sie lief ins Badezimmer. Nichts. Sie starrte das Waschbecken an, fragte sich, wie viele Kalorien Zahnpasta hatte.
Nichts. Nichts Essbares. Sie betrachtete ihre Nagelhaut, aber die hob sie sich lieber für den Notfall auf. Sie kehrte ins Zimmer zurück, wo ihr Blick auf die abgewetzten Manschetten fiel, und sie fragte sich, warum sie so abgewetzt waren. Sicher nicht durch zu viele Berührungen.
»Du hast mich vor allen anderen gedemütigt«, sagte sie, indem sie ihr Verlangen nach etwas Süßem in das Verlangen, jemanden zu verletzen, verwandelte. Er drehte sich nicht einmal um. Sie wusste, dass sie es gut sein lassen sollte, aber es war zu spät. Sie hatte seine Beleidigung durchgekaut, sie zerpflückt und hinuntergeschluckt, sodass sie zu einem Teil von ihr geworden war.
»Warum tust du das? Wegen einer Birne? Warum kannst du mir nicht ein einziges Mal in deinem Leben zustimmen?«
Zwei Monate lang hatte sie Zweige und Beeren und irgendwelches blödes Gras gefressen und sieben Kilo verloren, und das alles nur aus einem einzigen Grund. Damit seine Familie sagte, wie hübsch und schlank sie aussah, und dass vielleicht sogar Thomas es bemerkte. Vielleicht würde er ihnen glauben. Vielleicht würde er sie berühren. Nur berühren. Nicht einmal mit ihr schlafen. Sie nur berühren. Sie hungerte danach.
Irene Finney sah in den Spiegel und hob die Hand. Sie näherte den eingeseiften Waschlappen ihrem Gesicht, dann hielt sie inne.
Morgen würde Spot kommen, und dann wären sie wieder alle zusammen. Die vier Kinder, die vier Himmelsrichtungen.
Wie viele alte Menschen wusste Irene, dass die Erde flach war. Sie hatte einen Anfang und ein Ende. Und sie war am Ende angelangt.
Nur eines gab es noch zu tun. Morgen.
Irene Finney starrte ihr Spiegelbild an. Langsam begann sie, mit dem Waschlappen über ihre Wangen zu reiben. Im Nebenzimmer ballte Bert Finney die Hände zu Fäusten, als er das unterdrückte Schluchzen seiner Frau hörte, die ihr Gesicht abwusch.
Armand Gamache erwachte im Schein der Morgensonne, der durch die reglosen Vorhänge sickerte und über ihr Lager und seinen schwitzenden Körper floss. Die feuchten Laken hatten sie ans Fußende des Bettes gestrampelt. Neben ihm regte sich Reine-Marie.
»Wie viel Uhr ist es?«, fragte sie verschlafen.
»Halb sieben.«
»Morgens?« Sie stützte sich auf einen Ellbogen. Er nickte und lächelte. »Und es ist schon so heiß?« Er nickte noch einmal. »Es wird mörderisch werden.«
»Das hat Pierre gestern auch gesagt. Eine Hitzewelle.«
»Jetzt weiß ich endlich, warum es Welle heißt«, sagte Reine-Marie und fuhr mit dem Finger über seinen feuchten Arm. »Ich brauche eine Dusche.«
»Ich weiß etwas Besseres.«
Binnen Minuten waren sie am Steg, schlüpften aus ihren Sandalen und ließen ihre Handtücher in kleinen Haufen auf das warme Holz fallen. Gamache und Reine-Marie betrachteten die Welt der zwei Sonnen, zwei Himmel, vervielfältigter Berge und Wälder. Der See war nicht nur glasklar, er war auch ein Spiegel. Ein Vogel glitt über den wolkenlosen Himmel und zog gleichzeitig auf dem stillen Wasser seine Bahn. Diese Welt war so vollkommen, dass sie in zwei Hälften zerfiel. Kolibris schwirrten im Garten umher, und Schmetterlinge flatterten von Blüte zu Blüte. Zwei Libellen flirrten über den Steg. Reine-Marie und Gamache waren die einzigen Menschen auf der Welt.
»Du zuerst«, sagte Reine-Marie. Sie schaute ihm so gerne dabei zu. Genau wie ihre Kinder, als sie klein waren.
Er lächelte, beugte seine Knie und stieß sich von den Planken ab. Einen Moment lang schien er in der Luft zu schweben, die Arme ausgestreckt, als hoffte er, das gegenüberliegende Ufer zu erreichen. Er machte eher den Eindruck, als strecke er sich dem Himmel und nicht dem Wasser entgegen. Aber dann kam, was kommen musste, da auch Armand Gamache nicht fliegen konnte. Er klatschte ins Wasser. Es war so kalt, dass ihm einen Moment lang die Luft wegblieb, aber als er an die Wasseroberfläche kam, fühlte er sich erfrischt und hellwach.
Reine-Marie sah zu, wie er das Wasser aus seinen Phantomhaaren schüttelte, genau so, wie er es schon bei ihrem allerersten Aufenthalt hier getan hatte, damals noch mit richtigen Haaren. Und all die Jahre danach, als dazu eigentlich keine Notwendigkeit mehr bestand. Aber er tat es nach wie vor, und sie sah ihm nach wie vor zu und spürte, wie ihr Herz vor Liebe einen Moment aussetzte.
»Komm rein!«, rief er, und sie machte einen eleganten Kopfsprung, obwohl sie die Beine nicht zusammenpresste und es auch nicht schaffte, die Zehenspitzen zu strecken, sodass sie beim Eintauchen der Füße immer einen Schwanz von Blasen hinter sich herzog. Er wartete, bis sie wieder auftauchte und das Gesicht, umrahmt von glänzenden Haaren, der Sonne entgegenhielt.
»Hat es gespritzt?«, fragte sie und paddelte mit den Beinen, umspült von Wellen, die zum Ufer drängten.
»Du bist wie ein Messer eingetaucht. Ich habe kaum mitbekommen, wie du die Wasseroberfläche durchschnitten hast.«
»Zeit fürs Frühstück«, sagte Reine-Marie, als sie zehn Minuten später die Leiter zum Steg hochkletterten.
Gamache reichte ihr ein sonnengewärmtes Handtuch. »Was nimmst du?«
Auf dem Weg ins Haus beschrieben sie sich die enormen Berge von Essen, die sie bestellen würden. Am Manoir angelangt, ergriff er ihren Arm und dirigierte sie zum Wald.
»Ich möchte dir etwas zeigen.«
Sie lächelte. »Das kenn ich doch schon.«
»Das doch nicht.« Er kicherte und blieb dann abrupt stehen. Sie waren nicht mehr allein. Dort kauerte eine Gestalt und grub in der Erde. Sie hielt inne und drehte sich langsam zu ihnen um.
Es war eine junge Frau, über und über verdreckt.
»Oh, hallo.« Sie schien erstaunter als die beiden Gamaches. So erstaunt, dass sie Englisch sprach statt Französisch, wie es im Manoir Tradition war.
»Hallo«, erwiderte Reine-Marie auf Englisch und lächelte beruhigend.
»Désolée«, sagte die junge Frau und schmierte sich noch mehr Erde in ihr feucht glänzendes Gesicht. Dort verwandelte sich der Dreck augenblicklich in etwas Schlammähnliches, sodass sie ein wenig wie eine lebendige Tonfigur aussah. »Ich habe nicht damit gerechnet, dass schon jemand wach ist. Zum Arbeiten ist das die beste Zeit. Ich gehöre zu den Gärtnern.«
Sie wechselte ins Französische, das sie fließend mit einem winzigen Akzent sprach. Der leichte Wind trug den Duft von etwas Süßem, Chemischem, Vertrautem zu ihnen. Insektenspray. Die junge Frau musste darin gebadet haben. Die Gerüche des Québecer Sommers. Rasenschnitt und Insektenspray.
Gamache und Reine-Marie sahen zu Boden und entdeckten frisch gegrabene Löcher. Die Augen der jungen Frau folgten ihrem Blick.
»Ich will sie setzen, bevor es zu heiß wird.« Sie deutete auf ein paar welke Pflänzchen. »Aus irgendeinem Grund sterben alle Pflanzen in diesem Beet.«
»Was ist denn das?«, fragte Reine-Marie, die sich von den Löchern abgewandt hatte.
»Genau das wollte ich dir gerade zeigen«, sagte Gamache.
Seitlich von ihnen und halb hinter dem Gebüsch verborgen stand der große Marmorblock. Jetzt konnte er wenigstens jemanden danach fragen.
»Keine Ahnung«, antwortete die Gärtnerin. »Der ist vor ein paar Tagen mit einem riesigen Laster gebracht worden.«
»Aus was ist er denn?« Reine-Marie berührte ihn.
»Marmor«, sagte die Gärtnerin und stellte sich neben sie.
»Da stehen wir also«, sagte Reine-Marie schließlich, »umgeben von Wäldern und Seen im Garten des Manoir und«, dabei nahm sie die Hand ihres Mannes, »staunen das einzige widernatürliche Ding weit und breit an.«
Er lachte. »Ja, so ist das.«
Sie nickten der Gärtnerin zu und verschwanden im Manoir, um sich fürs Frühstück umzuziehen. Gamache fand es interessant, dass Reine-Marie genauso wie er den Abend zuvor auf den Marmorblock reagiert hatte. Was es auch war, es war widernatürlich.
Die Terrasse lag zu dieser Stunde im Schatten, und es war noch nicht so sengend heiß; zu Mittag würden die Steinplatten dann glühen. Reine-Marie und Gamache trugen beide ihre Sonnenhüte.
Elliot servierte ihnen ihren Café au Lait und das Frühstück. Reine-Marie goss Ahornsirup, der hier aus der Gegend stammte, auf ihr Crêpe mit wilden Heidelbeeren, und Gamache stach in seine Eier Benedict und sah zu, wie das Eigelb in die Sauce hollandaise floss. Mittlerweile füllte sich die Terrasse mit Finneys.
»Es ist nicht so wichtig«, hörten sie hinter sich eine Stimme, »aber wenn wir den Tisch unter dem Ahornbaum haben könnten, wäre das sehr schön.«
»Ich glaube, der ist schon besetzt, Madame«, sagte Pierre.
»Ach ja? Tja, da kann man wohl nichts machen.«
Bert Finney war schon unten und auch Bean. Sie lasen beide Zeitung. Bert studierte den Cartoon, Bean die Todesanzeigen.
»Du wirkst besorgt, Bean«, sagte der alte Mann und ließ die Zeitung sinken.
»Ist dir schon mal aufgefallen, dass offenbar mehr Leute sterben als geboren werden?«, fragte Bean und reichte Finney ihren Teil der Zeitung, der ihn nahm, betrachtete und mit ernster Miene nickte.
»Das bedeutet, dass wir Übrigen mehr bekommen.« Er gab ihr den Teil zurück.
»Ich will aber gar nicht mehr haben«, sagte Bean.
»Wart’s nur ab.« Und Finney widmete sich wieder dem Comic.
»Armand.« Reine-Marie berührte sanft seinen Arm. Dann senkte sie die Stimme zu einem kaum vernehmbaren Flüstern. »Ist Bean eigentlich ein Junge oder ein Mädchen?«
Gamache, der sich das selbst schon gefragt hatte, sah noch einmal hin. Das Kind trug eine billige Brille, zumindest sah sie billig aus, und die Haare um sein hübsches, gebräuntes Gesicht reichten ihm bis an die Schultern.
Er schüttelte den Kopf.
»Das ist wie bei Florence«, sagte er. »Bei ihrem letzten Besuch bin ich mit ihr den Boulevard Laurier entlangspaziert, und alle haben unseren hübschen Enkelsohn bewundert.«
»Trug sie ihren Sonnenhut?«
»Ja.«
»Und haben die Leute auch die Ähnlichkeit zwischen euch bewundert?«
»Ja, stimmt, das haben sie.« Gamache bedachte sie mit einem anerkennenden Blick, so als wäre sie ein Genie.
»Komisch, was?«, sagte sie. »Allerdings ist Florence gerade mal ein Jahr. Für wie alt schätzt du Bean?«
»Schwer zu sagen. Neun, zehn? Kinder wirken immer älter, wenn sie Todesanzeigen lesen.«
»Das muss ich mir merken. Todesanzeigen machen älter.«
»Noch etwas Konfitüre?« Pierre tauschte ihre fast leer gegessenen Schüsselchen gegen frische aus, die mit hausgemachter Konfitüre aus Walderdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren gefüllt waren. »Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«, fragte er.
»Nein, danke, aber ich hätte eine Frage«, sagte Gamache und deutete mit seinem Croissant auf die Ecke des Manoir. »Da hinten steht ein Marmorblock. Können Sie mir vielleicht sagen, wozu er da ist, Pierre?«
»Ah, dann haben Sie ihn also bemerkt.«
»Der wäre selbst vom Weltall aus kaum zu übersehen.«
Pierre nickte. »Madame Dubois klärte Sie also nicht auf, als Sie eingecheckt haben?«
Reine-Marie und Gamache wechselten einen Blick und schüttelten den Kopf.
»Nun.« Der Maître d’ machte den Eindruck, als wäre ihm die Sache etwas peinlich. »Ich fürchte, Sie werden sie selbst fragen müssen. Es ist eine Überraschung.«
»Hoffentlich eine schöne Überraschung«, sagte Reine-Marie.
Pierre überlegte kurz. »Das wissen wir noch nicht. Aber es wird sich bald zeigen.«