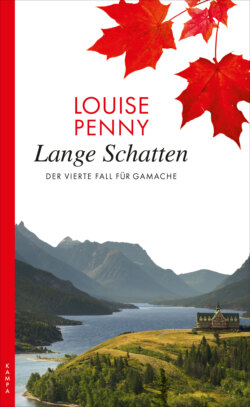Читать книгу Lange Schatten - Louise Penny - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеNach dem Mittagessen, das sich eine halbe Ewigkeit hin- zog, wollte sich Clara umgehend auf die Suche nach den Gamaches machen.
»Ich glaube, Mutter wäre es lieber, wenn wir hierbleiben.« Peter blieb unschlüssig auf der Terrasse stehen.
»Jetzt komm schon.« Sie zwinkerte ihm verschwörerisch zu und streckte die Hand aus. »Wer wagt, gewinnt.«
»Aber es ist doch ein Familientreffen.« Peter wäre nur zu gerne mit ihr gegangen, hätte ihre Hand genommen, wäre mit ihr über den perfekt getrimmten Rasen gelaufen und hätte nach den Freunden gesucht. Während des Mittagessens, als die Familie entweder schweigend aß oder über die Entwicklung auf dem Aktienmarkt diskutierte, hatten sich Peter und Clara in aufgeregtem Flüsterton über die Gamaches unterhalten.
»Du hättest dein Gesicht sehen sollen«, sagte Peter und bemühte sich, leise zu sprechen. »Du hast ausgesehen wie Dorothy, als sie dem mächtigen Zauberer von Oz gegenübersteht. Völlig verdattert.«
»Ich glaube, du verbringst zu viel Zeit mit Olivier und Gabri«, erwiderte Clara und lächelte. Sie hatte noch nie bei einem Familientreffen gelächelt. Merkwürdiges Gefühl. »Abgesehen davon hast du genauso ausgesehen, total perplex. Aber es ist doch wirklich kaum zu fassen, dass die Gamaches hier sind, oder? Meinst du, wir können uns heute Nachmittag wegschleichen und sie treffen?«
»Warum nicht?«, flüsterte Peter hinter einem warmen Brötchen hervor. Die Aussicht, ein paar Stunden mit ihren Freunden zu verbringen, statt seine Familie ertragen zu müssen, war ungemein verlockend.
Clara hatte auf ihre Uhr gesehen. Zwei. Noch zwanzig Stunden. Wenn sie um elf ins Bett ging und morgen früh um neun aufwachte, dann blieben nur noch – sie versuchte es im Kopf auszurechnen – elf Stunden, die sie im Wachzustand mit Peters Familie zusammen sein musste. Das würde sie irgendwie schaffen. Davon noch zwei Stunden mit den Gamaches abgezogen, blieben neun. Lieber Gott, das Ende war ja praktisch bereits in Sicht. Dann konnten sie in ihr kleines Dorf zurückkehren, bis nächstes Jahr wieder eine Einladung eintrudelte.
Bloß nicht daran denken.
Doch in diesem Moment blieb Peter zögernd auf der Terrasse stehen, wie sie es eigentlich schon vorausgesehen hatte. Schon beim Mittagessen hatte sie gewusst, dass er es nicht fertigbringen würde. Trotzdem hatte es Spaß gemacht, so zu tun als ob. Es war, als würde man sich innerlich verkleiden. So tun, als gehöre man dieses eine Mal zu den Mutigen.
Aber letzten Endes brachte er es natürlich nicht über sich. Und Clara konnte ihn nicht allein lassen. Deshalb ging sie langsam zurück ins Haus.
»Warum hast du deiner Familie von meiner Ausstellung erzählt?«, fragte sie und überlegte, ob sie gerade versuchte, einen Streit vom Zaun zu brechen. Um Peter dafür zu bestrafen, dass er sie beide zwang hierzubleiben.
»Ich fand, sie sollten es wissen. Sie tun immer so, als würde deine Arbeit nichts gelten.«
»Du doch auch.« Clara war sauer.
»Wie kannst du so etwas sagen!« Er wirkte verletzt, und ihr war klar, dass sie das nur gesagt hatte, um ihm wehzutun. Sie wartete darauf, dass er mit dem Argument kam, er hätte sie all die Jahre unterstützt. Er hätte dafür gesorgt, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und dass etwas zu essen auf dem Tisch stand. Aber er schwieg, was sie nur noch mehr ärgerte.
Als er sich zu ihr umdrehte, entdeckte sie einen Klecks Schlagsahne auf seiner Wange, der aussah wie ein großer Pickel. Es hätte genauso gut ein Flugzeug sein können, so merkwürdig war es, an ihrem Mann etwas zu sehen, das nicht dorthin gehörte. Er sah immer gepflegt aus, immer ordentlich. Seine Sachen waren nie zerknittert, seine Bügelfalten messerscharf, nie war da ein Fleck oder ein fehlender Knopf. Wie hieß dieses Dings bei Star Trek? Traktorstrahl? Nein, nicht das. Der Schutzschild. Peter ging mit einem aktivierten Schutzschild durchs Leben, der jeden Angriff durch Essen, Getränke oder Menschen abschmetterte. Clara fragte sich, ob es in seinem Kopf eine Stimme gab, die genau in diesem Moment mit schottischem Akzent rief: »Capt’n, der Schutzschild ist ausgefallen. Ich kann ihn nicht aktivieren.«
Peter, der liebe, gute Peter, bekam von dem kleinen, außerirdischen weißen Etwas in seinem Gesicht jedoch nichts mit.
Sie wusste, dass sie etwas sagen oder es wenigstens wegwischen sollte, aber sie hatte die Nase voll.
»Was ist?«, fragte Peter und sah gleichzeitig besorgt und ein bisschen ängstlich aus. Auseinandersetzungen machten ihn immer völlig hilflos.
»Du hast deiner Familie das mit Fortin erzählt, um sie zu ärgern. Vor allem Thomas. Es hatte nichts mit mir zu tun. Du hast meine Arbeit als Waffe benutzt.«
Capt’n, sie bricht auseinander.
»Wie kannst du so etwas nur sagen?«
Aber er klang unsicher, und auch das war sie nicht gewohnt.
»Bitte sprich mit ihnen nicht mehr über meine Arbeit. Besser gesagt, sprich über nichts, was mich angeht, mit ihnen. Es interessiert sie nicht, und mir tut es nur weh. Das sollte es vermutlich nicht, ist aber so. Wäre das möglich?«
Sie bemerkte, dass seine Hosentasche immer noch nach außen hing. Es gab wenig, was sie an ihm jemals so beunruhigt hatte.
»Es tut mir leid«, sagte er schließlich. »Aber das hatte nichts mit Thomas zu tun. Nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile an ihn gewöhnt. Es war wegen Julia. Das Wiedersehen mit ihr hat mich irgendwie aus dem Gleis gebracht.«
»Sie macht doch einen ganz netten Eindruck.«
»Das trifft auf uns alle zu.«
»Noch zwanzig Stunden«, sagte Clara und sah auf ihre Uhr, dann hob sie die Hand und wischte die Sahne von seiner Wange.
Auf ihrem Weg zum Haus hörten die Gamaches jemanden nach ihnen rufen und blieben stehen.
»Hier sind Sie!«, keuchte Madame Dubois, in der Hand einen Korb mit Gartenkräutern. »Ich habe am Empfang eine Nachricht hinterlassen. Ihr Sohn hat aus Paris angerufen. Er sagte, er wäre heute Abend nicht zu Hause, würde es aber später noch einmal versuchen.«
»Schade«, sagte Gamache. »Nun, irgendwann wird es schon klappen. Vielen Dank. Darf ich Ihnen das abnehmen?« Er streckte die Hand aus, und nach kurzem Zögern überließ ihm die alte Frau den Korb mit einem dankbaren Lächeln.
»Es wird langsam heiß«, sagte sie, »und die Schwüle macht mir zu schaffen.« Sie drehte sich um und marschierte in einem verblüffenden Tempo den Pfad hinauf.
»Madame Dubois.« Gamache ertappte sich dabei, wie er hinter einer Frau von mindestens hundertzwanzig Kilo herhechelte. »Wir haben eine Frage.«
Sie blieb stehen und wartete auf ihn.
»Wir haben uns gefragt, wofür der Marmorblock ist.«
»Welcher Marmorblock?«
»Pardon?«, sagte Gamache.
»Pardon?«, sagte Madame Dubois.
»Na, dieses große Ding aus Marmor da hinten, auf der anderen Seite des Manoir. Ich habe es vergangene Nacht dort stehen sehen und heute Morgen wieder. Ihre junge Gärtnerin wusste nicht, wofür es ist, und Pierre meinte, wir sollten Sie fragen.«
»Ach so, dieser Marmorblock«, sagte sie, als gäbe es noch andere. »Nun ja, wir hatten großes Glück. Wir …«, sie murmelte irgendetwas und eilte weiter.
»Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt?«
»Na schön, na schön.« Sie tat gerade so, als ginge es um ein Staatsgeheimnis. »Er ist für eine Statue.«
»Eine Statue? Tatsächlich?«, sagte Reine-Marie. »Was für eine Statue denn?«
»Die von Madame Finneys Mann.«
Armand Gamache sah am Rande des wunderbaren Gartens des Manoir Bellechasse einen marmornen Bert Finney stehen. Für alle Zeiten. Sein hässliches Gesicht in Stein gehauen und sie und alle zukünftigen Besucher mit irrem Blick beobachtend.
Ihre Gesichter schienen Bände zu sprechen.
»Natürlich nicht der jetzige«, sagte Madame Dubois. »Der erste. Charles Morrow. Ich kannte ihn, wissen Sie. Ein vornehmer Herr.«
Den Gamaches, die daran bisher nicht sehr viele Gedanken verschwendet hatten, wurde mit einem Schlag einiges klar. Wie aus Spot Finney Peter Morrow geworden war. Seine Mutter hatte wieder geheiratet. Sie hatte ihren Namen von Morrow in Finney geändert, aber außer ihr niemand. Automatisch hatten sie alle Familienmitglieder als Finneys betrachtet, aber das stimmte nicht. Sie waren Morrows.
Das erklärte auch, wenigstens zum Teil, warum Bert Finney bei einer Familienfeier zu Ehren des Vaters eine Nebenrolle spielte.
»Charles Morrow ist vor etlichen Jahren gestorben«, fuhr Clementine Dubois fort. »Das Herz. Die Familie veranstaltet heute Nachmittag vor der Cocktailstunde eine Art feierliche Enthüllung. Die Statue wird in etwa einer Stunde gebracht. Sie wird eine wundervolle Bereicherung für den Garten darstellen.«
Sie warf ihnen einen raschen Blick zu.
Der Größe des Marmorsockels nach zu urteilen, musste es sich um eine gewaltige Statue handeln, dachte Gamache. Größer als einige der Bäume, obwohl die glücklicherweise noch wachsen würden und die Statue vermutlich nicht.
»Haben Sie die Skulptur schon gesehen?«, erkundigte sich Gamache und versuchte, es möglichst beiläufig klingen zu lassen.
»O ja. Ein gewaltiges Ding. Nackt, mit einem Blumenkranz auf dem Kopf und kleinen Flügelchen. Wirklich ein Glück, dass sie diesen roten Marmor gefunden haben.«
Gamache sah sie entgeistert an. Dann bemerkte er ihr Lächeln.
»Sie sind wirklich durchtrieben.« Er lachte, und sie kicherte.
»Glauben Sie, ich würde Ihnen oder mir das antun? Ich liebe dieses Fleckchen Erde«, sagte Madame Dubois, während sie gemeinsam den restlichen Weg bis zu der grünen Fliegengittertür zurücklegten, die ins Innere des kühlen Manoir führte. »Aber der Unterhalt des Hauses verschlingt immer mehr Geld. Dieses Jahr haben wir einen neuen Heizkessel gebraucht, und das Dach muss auch bald repariert werden.«
Die Gamaches legten den Kopf in den Nacken, um zu dem Kupferdach hinaufzusehen, das im Lauf der Zeit Grünspan angesetzt hatte. Schon bei dem Gedanken daran wurde Gamache ganz schwindlig. Er hätte niemals Dachdecker werden können.
»Ich habe wegen der Reparaturarbeiten mit einem Abinaki-Handwerker gesprochen. Wussten Sie, dass das Manoir ursprünglich von den Abinaki gebaut worden ist?«
»Nein, das habe ich nicht gewusst«, sagte Gamache, der eine Schwäche für die Geschichte von Québec hatte. »Ich dachte, es wären die Geldmagnaten gewesen.«
»Sie haben es bezahlt, aber gebaut haben es die Ureinwohner und die Québecer. Es diente als Jagdhaus. Als mein Mann und ich es vor fünfzig Jahren kauften, stand es leer. Der Dachboden war voll mit ausgestopften Tierköpfen. Da oben sieht es noch immer aus wie in einem Schlachthaus. Ekelhaft.«
»Es war klug von Ihnen, den Vorschlag der Finneys anzunehmen.« Er lächelte. »Und ihr Geld. Besser, einen Morrow im Garten und ein dichtes Dach, als alles zu verlieren.«
»Hoffen wir, dass er nicht nackt ist. Ich habe die Statue noch nicht gesehen.«
Die Gamaches blickten ihr nach, wie sie in Richtung Küche verschwand.
»Na ja, wenigstens werden die Vögel ein Plätzchen mehr zum Ausruhen haben«, sagte Gamache.
»Wenigstens«, sagte Reine-Marie.
Als die Gamaches zum Schwimmen hinunter an den See gingen, trafen sie am Steg Peter und Clara.
»Also, jetzt erzählen Sie mal, was es Neues bei Ihnen gibt, angefangen bei Denis Fortin und Ihren Bildern.« Reine-Marie klopfte auf einen Liegestuhl. »Und lassen Sie ja nichts aus.«
Peter und Clara brachten sie auf den neuesten Stand, was das Dorf anging, und nach einer weiteren Ermunterung berichtete Clara ihnen von der Begegnung mit dem bedeutenden Kunsthändler, der sie in ihrem bescheidenen Heim in Three Pines aufgesucht hatte, von seinem zweiten Besuch zusammen mit seinen Kuratoren, von der zermürbenden Warterei, während sie darüber entschieden hatten, ob Clara Morrow mit ihren achtundvierzig Jahren noch eine aufstrebende Künstlerin war. Jemand, den sie fördern wollten. Denn jeder in der Kunstwelt wusste, wenn Denis Fortin jemanden gut fand, dann fand ihn die gesamte Kunstwelt gut. Und dann war alles möglich.
Endlich traf die nahezu unglaubliche Nachricht ein, dass Clara im nächsten Jahr tatsächlich eine Einzelausstellung in der Galerie Fortin bekommen würde, nachdem sie schon eine Ewigkeit vergeblich versucht hatte, irgendjemanden für ihre Arbeit zu interessieren.
»Und wie geht es Ihnen damit?«, fragte Gamache leise, der inzwischen mit Peter ans Ende des Stegs geschlendert war.
»Großartig.«
Gamache nickte, kreuzte die Hände auf dem Rücken, blickte ans gegenüberliegende Ufer und wartete. Er kannte Peter Morrow. Er wusste, dass er ein anständiger und gutherziger Mann war, der seine Frau über alles auf der Welt liebte. Allerdings wusste er auch, dass Peters Ego fast ebenso groß war wie seine Liebe. Und die war sehr groß.
»Was ist?«, fragte Peter, als das Schweigen nach seiner Antwort weiter anhielt.
»Bisher waren immer Sie derjenige, der Erfolg hatte«, sagte Gamache schlicht. Es hatte keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden. »Es wäre völlig normal, wenn Sie …«, er suchte nach dem richtigen Wort, einem freundlichen Wort, »Mordgelüste hätten.«
Peter lachte und war überrascht, als sein Lachen als Echo vom anderen Ufer zurückgeworfen wurde.
»Sie wissen ja, wie das mit Künstlern ist. Es ist mir nicht ganz leichtgefallen, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, aber als ich gesehen habe, wie glücklich Clara ist, na ja …«
»Ich bin mir nicht sicher, ob Reine-Marie erfreut wäre, wenn ich ihr nacheifern und Bibliothekar werden würde«, sagte Gamache und blickte zu seiner Frau, die in eine angeregte Unterhaltung mit Clara vertieft war.
»Ich kann Sie geradezu vor mir sehen, wie Sie beide in der Bibliothèque Nationale in Montréal arbeiten und sich zwischen den Bücherregalen böse Blicke zuwerfen. Vor allem, wenn man Sie befördern würde.«
»So weit käme es nicht. Ich kann nicht buchstabieren. Jedes Mal, wenn ich eine Nummer im Telefonbuch nachschlagen will, muss ich mir laut das Alphabet vorsagen. Reine-Marie treibt das in den Wahnsinn. Aber wenn Sie mehr über Mordgelüste erfahren wollen, müssen Sie sich an Bibliothekare halten«, sagte Gamache in vertraulichem Ton. »Diese Stille die ganze Zeit. Das bringt die Leute auf seltsame Ideen.«
Sie lachten und gingen zurück. Als sie sich den beiden Frauen näherten, hörten sie, wie Reine-Marie gerade aufzählte, was die Gamaches an diesem Tag noch vorhatten.
»Schwimmen, dösen, schwimmen, Weißwein, Abendessen, schwimmen, schlafen.«
Clara war beeindruckt.
»Na ja, wir hatten ja die ganze Woche Zeit, unseren Tagesablauf zu perfektionieren«, gestand Reine-Marie. »An solchen Dingen muss man arbeiten. Was haben Sie beide vor?«
»Boot fahren, Statue enthüllen, betrinken, ins Fettnäpfchen treten, um Entschuldigung bitten, schmollen, essen, schlafen«, sagte Clara. »Ich hatte zwanzig Jahre Familienfeiern Zeit, das zu perfektionieren. Wobei Statuen enthüllen neu ist.«
»Es ist eine Statue Ihres Vaters, oder?«, fragte Gamache Peter.
»Der Pater Familias. Besser hier als in unserem Garten.«
»Peter«, sagte Clara sanft.
»Würdest du das etwa wollen?«, fragte Peter.
»Nein, andererseits habe ich deinen Vater ja gar nicht richtig gekannt. Ich weiß nur, dass er wie sein Sohn ein gut aussehender Mann war.«
»Ich bin ganz anders als er«, stieß Peter in einem völlig ungewohnten Ton hervor, der alle überraschte.
»Mochten Sie Ihren Vater nicht?«, fragte Gamache, es schien ein naheliegender Schluss zu sein.
»Ich mochte ihn ungefähr genauso sehr, wie er mich mochte. Ist das nicht immer so? Dass man das bekommt, was man selbst gibt? Das waren seine Worte. Und er hat nichts gegeben.«
Daraufhin schwiegen alle eine Weile.
»Nach dem Tod von Peters Vater hat seine Mutter wieder geheiratet«, erklärte Clara schließlich. »Bert Finney.«
»Er war Angestellter in der Firma meines Vaters«, sagte Peter und warf Kieselsteine in den stillen See.
Er war etwas mehr als ein Angestellter gewesen, wie Clara wusste. Aber sie wusste auch, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, um ihren Mann zu verbessern.
»Ich bin jedenfalls froh, wenn die Sache vorbei ist. Mutter will nicht, dass wir die Statue vor der Enthüllung sehen, deshalb hat Thomas vorgeschlagen, dass wir alle eine Bootsfahrt machen.« Er deutete mit dem Kopf auf ein grün gestrichenes Ruderboot, das am Steg vertäut war. Es war ungewöhnlich lang und hatte zwei Ruderdollen auf jeder Seite.
»Das ist ja eine verchère«, sagte Reine-Marie erstaunt. Ein solches Boot hatte sie seit Jahren nicht mehr gesehen.
»Stimmt«, sagte Peter. »Wir haben früher immer mit einer verchère an der örtlichen Ruderregatta teilgenommen. Thomas hielt es für eine gute Idee, um die Zeit totzuschlagen. Eine Art Hommage an Vater.«
»Thomas nennt Sie Spot«, sagte Gamache.
»Das tut er schon immer.« Peter hielt ihnen seine Hände entgegen. Reine-Marie und Gamache beugten sich darüber, als hätten sie vor, seinen Ring zu küssen. Doch statt eines Rings entdeckten sie Flecken. Spots eben.
»Farbe«, sagte Reine-Marie und richtete sich wieder auf. »Das kriegen Sie mit Terpentin weg.«
»Ach wirklich?«, fragte Peter mit gespieltem Erstaunen, dann lächelte er. »Die sind neu. Von heute Morgen in meinem Atelier. Aber schon früher hatte ich immer welche an den Händen, im Gesicht, an der Kleidung, den Haaren, überall. Irgendwann fiel Thomas das auf, und er fing an, mich Spot zu nennen.«
»Ich vermute, dass Thomas nichts entgeht«, sagte Gamache.
»Er ist der Meister des Recyclings«, erwiderte Peter. »Er sammelt Gespräche und Ereignisse und verwendet sie Jahre später gegen einen. Recycling, Revanche, Ressentiments. Thomas lässt nichts verkommen.«
»Das erklärt den Spitznamen Spot«, sagte Reine-Marie. »Aber was ist mit Ihrer Schwester Mariana? Warum wird sie Magilla genannt?«
»Das hat mit einer Zeichentrickserie zu tun, die sie sich als Kind jeden Tag angesehen hat. Magilla Gorilla. Sie war ganz verrückt danach. Die Sendung lief Frühabends, wenn Vater von der Arbeit nach Hause kam. Er bestand darauf, dass wir ihn alle an der Tür begrüßen, wie eine große glückliche Familie, aber Mariana war unten im Keller und sah fern. Er musste immer erst nach ihr rufen. Jeden Abend kam sie heulend die Treppe heraufgestampft.«
»Thomas hat sie also Magilla nach einem Gorilla genannt?« Gamache begann sich allmählich ein Bild von dem Mann zu machen. Peter nickte.
»Und wie haben Sie ihn genannt?«
»Thomas. Ich war in unserer Familie schon immer der Kreative.«
Sie saßen auf dem Steg und genossen die leichte Brise, die hier wehte. Peter hörte zu, während Clara noch einmal erzählte, wie sie Fortin bei seinem Besuch in ihrem Atelier im vergangenen Frühjahr das Porträt ihrer Freundin Ruth, der hageren alten Dichterin, gezeigt hatte. Verbittert, streitlustig und brillant. Aus irgendeinem Grund, den Peter niemals begreifen würde, hatte Clara sie als Madonna gemalt. Natürlich nicht als die unschuldige Jungfrau. Sondern als alte, allein gelassene Frau, die voller Furcht ihren letzten Lebensjahren entgegensah.
Es war das schönste Bild, das Peter jemals gesehen hatte, und er hatte schon vor einigen Meisterwerken gestanden. Aber noch nie war ihm ein außergewöhnlicheres Werk unter die Augen gekommen als dieses Bild in Claras kleinem Atelier. Ihr Atelier befand sich im hinteren Teil des Hauses, an den Wänden lehnten die unverkäuflichen Bilder, dazwischen lagen Zeitschriften und alte verschrumpelte Orangenschalen, und direkt nebenan befand sich sein blitzblankes, ordentlich aufgeräumtes, übersichtliches Atelier.
Aber während er sich ein weiteres Mal einen Alltagsgegenstand vorgenommen hatte, so nahe an ihn herangegangen war, bis man ihn nicht mehr als solchen erkannte, und damit ein abstraktes Bild schuf, dem er dann einen Titel wie Der Vorhang oder Grashalm oder Beförderung gab, hatte Clara in ihrem kleinen Atelier das Göttliche im Gesicht ihrer weißhaarigen, hageren, boshaften Nachbarin eingefangen. Mit ihren von dicken Adern überzogenen Händen hielt sie vor dem faltigen Hals einen blauen Schal zusammen. Ihr Gesicht zeigte Kummer und Enttäuschung, Wut und Verzweiflung. Mit Ausnahme ihrer Augen. Es sprang einem nicht entgegen. Es war eher eine Andeutung, ein zarter Hinweis.
Aber es war da, in einem winzigen Fleck in ihrem Auge. Clara hatte auf die riesige Leinwand einen einzelnen Fleck, einen Tupfer gemalt. Und in diesen Tupfer hatte sie die Hoffnung gesetzt.
Es war großartig.
Er freute sich für sie. Wirklich.
Da riss sie ein schriller Schrei aus ihren Betrachtungen, und im Nu waren sie alle auf den Beinen und drehten sich zum Manoir um. Armand Gamache wollte sich gerade in Bewegung setzen, als eine kleine Gestalt aus dem Garten geschossen kam.
Bean.
Mit dem hinter ihm herflatternden Badetuch um den Hals rannte das Kind schreiend auf sie zu, und seine Panik schien mit jedem Schritt größer zu werden. Es wurde von jemandem verfolgt. Als die beiden Gestalten näher kamen, erkannte Gamache die junge Gärtnerin.
Peter, Clara, Gamache und Reine-Marie rannten los und breiteten die Arme aus, um das flüchtende Kind aufzuhalten, das es ihnen offenbar so schwer wie möglich machen wollte, aber schließlich gelang es Peter, Bean einzufangen.
»Lass mich los«, jammerte Bean und wand sich in seinen Armen, als ginge die Gefahr von Peter aus. Mit weit aufgerissenen Augen blickte das erschrockene Kind zurück zum Manoir.
Inzwischen näherten sich von verschiedenen Seiten die Morrows, die Finneys und einige der jungen Leute vom Personal, die der Gärtnerin gefolgt waren.
»Wovor läufst du denn weg, Bean?« Gamache kniete sich hin und nahm die zitternden Hände des Kindes zwischen seine. »Sieh mich an«, sagte er freundlich, aber bestimmt, und Bean gehorchte. »Hat dir jemand wehgetan?«
Er wusste, dass er versuchen musste, eine Antwort von Bean zu bekommen, bevor die anderen da waren, und das würde nicht mehr lange dauern. Er sah dem verängstigten Kind in die Augen.
Bean streckte einen Arm aus. Auf der zarten Haut bildeten sich Schwellungen.
»Was haben Sie mit meinem Enkelkind gemacht?«
Es war zu spät. Sie waren da, und als Gamache den Kopf hob, blickte er in das vorwurfsvolle Gesicht von Irene Finney. Sie war eine Ehrfurcht gebietende Frau. Gamache brachte starken Frauen Bewunderung, Respekt und Vertrauen entgegen. Er war von einer solchen Frau großgezogen worden und hatte eine geheiratet. Aber er wusste, dass Stärke nicht gleich Härte war und dass ein Unterschied zwischen einer Ehrfurcht einflößenden Frau und einer Furcht einflößenden Frau bestand. Was von beiden war sie?
Die alte Dame erwiderte seinen Blick, streng, unnachgiebig, nach einer Antwort verlangend.
»Lassen Sie Bean los«, befahl sie, aber Gamache reagierte nicht darauf.
»Was ist passiert?«, fragte er das Kind leise.
»Es war nicht meine Schuld«, hörte er jemanden hinter sich sagen, er drehte sich um, es war die junge Gärtnerin.
»Normalerweise bedeutet das genau das Gegenteil«, erklärte Mrs. Finney.
»Irene, lass die junge Frau doch reden. Wie heißen Sie?«, fragte Bert Finney mit sanfter Stimme.
»Colleen«, sagte die Gärtnerin und wich vor dem alten Mann mit dem irren Blick einen Schritt zurück. »Es waren Wespen.«
»Es waren Bienen«, schniefte Bean. »Ich bin gerade um den Olymp herumgeritten, als sie mich gestochen haben.«
»Um den Olymp?«, stieß Mrs. Finney hervor.
»Der Marmorblock«, sagte Colleen. »Und es waren Wespen, die fliegen in letzter Zeit ständig hier herum. Keine Bienen. Das Kind kennt den Unterschied nicht.«
Gamache wandte sich wieder Bean zu und streckte seine große Hand aus. Das Kind zögerte, dann musterte Gamache die drei Schwellungen. Sie waren gerötet und fühlten sich heiß an. Als er sie näher untersuchte, entdeckte er die Stacheln mit den winzigen Giftblasen daran, die in der Haut steckten.
»Könnten Sie mir etwas Calaminlotion besorgen?«, bat er einen der Kellner, der daraufhin zum Haus spurtete.
Gamache hielt Beans Arm fest und entfernte rasch die Stacheln und die Giftblasen, dann suchte er nach Anzeichen für eine allergische Reaktion. Falls nötig, würde er das Kind ins Auto packen und sofort nach Sherbrooke ins Krankenhaus fahren. Er sah zu Reine-Marie, die offensichtlich dieselbe Sorge hatte.
Einmal Eltern, immer Eltern.
Die Stiche sahen zwar schmerzhaft aus, aber nicht lebensbedrohlich.
Reine-Marie nahm die Flasche mit der pfirsichfarbenen Lotion und hauchte einen Kuss auf jede der Schwellungen, bevor sie sie damit einrieb, dann richtete sie sich wieder auf. Rings um sie herum stritt die Familie inzwischen darüber, ob Calaminlotion wirklich etwas nutzte.
»Nun seid schon still, die Aufregung ist doch vorbei«, erklärte Mrs. Finney. Sie sah sich um, erspähte das Ruderboot und steuerte auf den Steg zu. »Also, wer sitzt wo?«
Nach einigem Hin und Her begannen Peter und Thomas, den anderen Morrows beim Einsteigen in die verchère zu helfen. Peter stellte sich in das Boot, Thomas auf den Steg, und zwischen ihnen nahmen Mrs. Finney, Mariana und Julia Platz. Bean kletterte vorsichtig, aber ohne jede Hilfe ins Boot.
»Jetzt komm ich!«, rief Sandra und streckte den Arm aus. Thomas reichte sie an Peter weiter.
Clara trat vor und hielt Peter die Hand entgegen. Peter zögerte.
»Entschuldige«, sagte Thomas und stieg an Clara vorbei ins Boot. Er setzte sich, und alle starrten Peter an, der vor dem einzigen noch freien Platz stand.
»Setz dich, bevor das Boot deinetwegen noch umkippt«, sagte Mrs. Finney.
Peter setzte sich.
Clara ließ die Arme sinken. Auf der spiegelnden Wasseroberfläche sah sie den hässlichsten Mann der Welt neben sich stehen.
»Nicht jeder schafft es ins Boot«, sagte Bert Finney, als die verchère vom Steg ablegte.