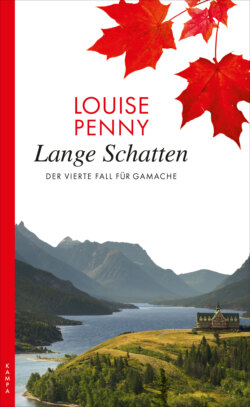Читать книгу Lange Schatten - Louise Penny - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеPierre Patenaude drückte die Schwingtür zur Küche in dem Augenblick auf, als drinnen lautes Gelächter ertönte. Kaum war er eingetreten, hörte es schlagartig auf, und er fragte sich, was ihn mehr ärgerte, das Lachen oder sein unvermitteltes Abbrechen.
Elliot stand in der Mitte des Raums, eine Hand auf die schmale Hüfte gestützt, die andere leicht erhoben, der gestreckte Zeigefinger in der Luft erstarrt, mit einem begehrlichen und zugleich säuerlichen Ausdruck im Gesicht. Er äffte außerordentlich treffend einen der Gäste nach.
»Was ist hier los?«
Pierre konnte den strengen, missbilligenden Ton in seiner Stimme selbst nicht leiden. Und er konnte den Ausdruck auf ihren Gesichtern nicht leiden. Furcht. Außer auf dem von Elliot. Der wirkte zufrieden.
Das Personal hatte sich noch nie vor ihm gefürchtet, und es gab auch keinen Grund, warum sie es jetzt tun sollten. Es lag nur an diesem Elliot. Vom ersten Tag an hatte er die anderen gegen den Maître d’ aufgewiegelt. Er spürte es. Dass auf einmal nicht mehr alle Fäden bei ihm zusammenliefen und er sich wie ein Außenseiter im Manoir vorkam.
Wie hatte der junge Mann das nur geschafft?
Im Grunde wusste Pierre es genau. Elliot hatte die schlimmsten Seiten an ihm zum Vorschein gebracht, hatte ihn verhöhnt, sämtliche Regeln übertreten und Pierre dazu gezwungen, den Zuchtmeister zu spielen, der er gar nicht war. Die anderen jungen Leute waren alle lernwillig, sie waren bereit, zuzuhören und sich etwas beibringen zu lassen, sie waren dankbar für den geregelten Tagesablauf und die Führung durch den Maître d’. Er brachte ihnen bei, die Gäste zu respektieren, höflich und freundlich zu sein, selbst wenn man sie schikanierte. Er erklärte ihnen, dass die Gäste gutes Geld dafür bezahlten, verwöhnt zu werden, aber es ging noch um mehr. Sie kamen ins Manoir, damit sich jemand um sie kümmerte.
Pierre fühlte sich manchmal wie ein Arzt in der Notaufnahme. Die Leute strömten durch die Tür, Opfer des Stadtlebens, niedergedrückt von der Bürde des Alltags. Zu viele Forderungen, zu wenig Zeit, zu viele Rechnungen, E-Mails, Meetings, Telefonate, zu wenig Dankbarkeit und viel zu viel, wirklich viel zu viel Druck – das alles hatte sie gebrochen. Er erinnerte sich, wie erschöpft sein Vater immer aus dem Büro nach Hause gekommen war, völlig geschafft.
Sie verrichteten im Manoir Bellechasse keine niedrigen Arbeiten, das wusste Pierre. Diese Arbeit war ehrenvoll und wichtig. Sie sorgten dafür, dass Leute geheilt wurden. Wobei manche natürlich schwerer verletzt waren als andere.
Nicht jeder eignete sich für diese Art Arbeit.
Elliot zum Beispiel.
»Ich habe nur Spaß gemacht.«
Das sagte Elliot, als wäre es das Normalste von der Welt, mitten in der engen, vollbesetzten Küche zu stehen und die Gäste nachzuäffen, und der Maître d’ wäre derjenige, der nicht ganz normal war. Pierre spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Er sah sich um.
Die große, alte Küche bot sich als Treffpunkt für das Personal an. Selbst die Gärtner waren da, aßen Kuchen und tranken Tee und Kaffee. Und sahen zu, wie er sich von einem Neunzehnjährigen demütigen ließ. Pierre sagte sich, dass Elliot noch jung sei. Aber das hatte er sich schon so oft gesagt, dass es seine Bedeutung verloren hatte.
Er wusste, dass er es aufgeben sollte.
»Du hast unsere Gäste lächerlich gemacht.«
»Nur einen. Außerdem macht sich die Frau doch selbst total lächerlich. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, er hat mehr Kaffee als ich bekommen. Entschuldigen Sie, aber ist das wirklich der beste Platz? Ich habe ausdrücklich um den besten Platz gebeten. Entschuldigen Sie, ich will mich gewiss nicht beschweren, aber ich habe vor Ihnen bestellt. Wo bleiben meine Selleriestangen?«
Einen Moment lang ging ein Kichern durch die gemütliche Küche.
Er hatte sie sehr gut nachgeahmt. Trotz seiner Wut erkannte der Maître d’ Sandra Morrows glattzüngig vorgebrachte Klagen sofort wieder. Nie war sie zufrieden. Elliot mochte kein guter Kellner sein, aber er besaß eine geradezu unheimliche Fähigkeit, die Fehler anderer aufzudecken. Und sie zu vergrößern. Und sich über sie lustig zu machen. Diese Begabung fand allerdings nicht jeder attraktiv.
»Sehen Sie mal, wen ich draußen gefunden habe!«, rief Julia, als sie in den Salon traten.
Reine-Marie lächelte und stand auf, um ihrem Mann einen Kuss zu geben und ihm einen bauchigen Cognacschwenker zu reichen. Die anderen sahen auf, lächelten und wandten sich wieder ihrer jeweiligen Beschäftigung zu. Julia stand unsicher in der Tür, dann nahm sie sich eine Zeitschrift und ließ sich in einem Ohrensessel nieder.
»Geht’s dir besser?«, flüsterte Reine-Marie.
»Viel besser«, sagte Gamache wahrheitsgemäß, nahm das von ihren Händen erwärmte Glas und folgte ihr zum Sofa.
»Wie wäre es nachher mit einer Runde Bridge?« Thomas unterbrach sein Klavierspiel und gesellte sich zu den Gamaches.
»Wunderbar, gute Idee«, sagte Reine-Marie. Sie hatten auch die letzten Abende mit Thomas und Sandra Bridge gespielt. Es war eine angenehme Art, den Tag ausklingen zu lassen.
»Na, Rosen gefunden?«, fragte Thomas Julia, als er zurück zu seiner Frau ging. Sandra ließ ein Lachen wie eine Maschinengewehrsalve los, so als hätte er etwas unglaublich Kluges und Witziges von sich gegeben.
»Du meinst wohl ein paar Eleanor-Rosen?«, fragte Mariana höchst belustigt vom Fenster her, wo sie mit Bean saß. »Die magst du doch am liebsten, oder, Julia?«
»Ich finde eigentlich, dass sie zu dir besser passen würden.« Julia lächelte.
Mariana erwiderte das Lächeln und stellte sich dabei vor, wie einer der Holzbalken sich löste und ihre ältere Schwester unter sich begrub. Es war doch längst nicht so lustig, dass sie wieder dabei war, wie Mariana gehofft hatte. Ganz im Gegenteil sogar. »Zeit, ins Bett zu gehen, mein Beanchen«, sagte Mariana und legte ihren fleischigen Arm um das lesende Kind. Bean war das ruhigste zehnjährige Kind, das Gamache kannte, schien dabei aber ganz zufrieden zu sein. Als das Kind an ihm vorbeiging, sah er ihm in die strahlend blauen Augen.
»Was liest du denn da?«, fragte Gamache.
Bean blieb stehen und blickte den großen fremden Mann an. Sie waren zwar schon drei Tage zusammen im Manoir, hatten aber noch kein Wort miteinander gewechselt.
»Nichts.« Gamache bemerkte, wie die kleinen Hände sich fester um das Buch schlossen und es gegen die Brust pressten, sodass das weite T-Shirt sich nach oben schob. Durch die dünnen, gebräunten Finger konnte Gamache ein Wort des Titels entziffern.
Sagen.
»Komm schon, Schnecke. Ab ins Bett. Mommy will sich endlich betrinken, und das kann sie erst, wenn du schläfst, das weißt du genau.«
Bean lächelte unvermittelt, ohne dabei den Blick von Gamache zu wenden. »Einen letzten Martini, Mommy? Bitte, bitte«, sagte Bean, bevor sie den Raum verließen.
»Du weißt genau, dass du mit dem Martini noch warten musst, bis du zwölf bist. Entweder Scotch oder gar nichts«, hörten sie Mariana sagen, dann nur noch Schritte auf der Treppe.
»Ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob sie Spaß macht«, sagte Madame Finney.
Gamache warf ihr ein Lächeln zu, aber es verging ihm, als er ihre strenge Miene sah.
»Warum lässt du dich nur immer von ihm ärgern, Pierre?«
Die Köchin verteilte handgemachte Trüffel und kandierte Früchte mit Schokoladenüberzug auf kleinen Tellern. Ihre wurstförmigen Finger ordneten das Konfekt wie von selbst an. Sie nahm einen Minzezweig aus dem Glas, schüttelte das Wasser ab und knipste mit den Nägeln ein paar Blätter weg. Gedankenverloren wählte sie dann noch einige essbare Blüten aus einer Vase, und schon war aus ein paar Konfektstücken ein kleines Kunstwerk entstanden. Sie streckte den Rücken und blickte den Maître d’ an.
Seit Jahren arbeiteten sie zusammen. Nein, seit Jahrzehnten. Sie fand es erstaunlich, dass sie bereits über sechzig war, und sie wusste, dass sie keinen Tag jünger aussah, was hier in den Wäldern allerdings egal war.
Sie hatte Pierre kaum jemals wegen eines seiner jungen Helfer so aufgebracht gesehen. Sie für ihren Teil mochte Elliot. Wie alle anderen auch, soweit sie wusste. War der Maître d’ deshalb so wütend? Weil er eifersüchtig war?
Einen Moment sah sie dabei zu, wie seine schmalen Hände das Tablett vorbereiteten.
Nein, dachte sie. Es war nicht Eifersucht. Es war etwas anderes.
»Er will einfach nicht hören«, sagte Pierre, schob das Tablett zur Seite und setzte sich gegenüber von Veronique hin. Sie waren jetzt allein in der Küche. Der Abwasch war erledigt, das Geschirr aufgeräumt, die Arbeitsflächen geschrubbt. Es roch nach Espresso und Minze und Früchten. »Er ist hergekommen, um etwas zu lernen, und dann will er nicht hören. Ich verstehe das nicht.« Er zog den Korken aus der Cognacflasche und goss zwei Gläser ein.
»Er ist jung. Er ist das erste Mal von zu Hause weg. Und du machst es nur schlimmer, wenn du solchen Druck auf ihn ausübst. Lass ihn einfach in Ruhe.«
Pierre nippte an dem Cognac und nickte. Die Köchin wirkte beruhigend auf ihn, auch wenn sie den Neuankömmlingen am Anfang immer eine Heidenangst einjagte, wie er wusste. Sie war groß und kräftig, ihr Gesicht rund wie ein Kürbis, und ihre Stimme klang wie eine Gießkanne. Und sie hatte Messer. Eine Menge Messer. Und ein Hackbeil und schmiedeeiserne Pfannen.
Verständlicherweise dachten einige der neuen Mitarbeiter, die sie zum ersten Mal sahen, dass sie auf der Schotterstraße eine falsche Abzweigung in den Wald genommen hatten und in einer Holzfällersiedlung statt in dem schicken Manoir Bellechasse gelandet waren. Véronique sah aus wie die Küchenhilfe in einer schlechten Kantine.
»Er muss wissen, wer hier das Sagen hat«, sagte Pierre.
»Das tut er doch auch. Es passt ihm nur nicht.«
Der Maître d’ hatte einen harten Tag hinter sich, das war unverkennbar. Deshalb nahm sie den größten Trüffel von dem Tablett und reichte ihn ihm.
Geistesabwesend steckte er ihn in den Mund.
»Ich habe erst in fortgeschrittenem Alter Französisch gelernt«, erklärte Mrs. Finney und musterte die Karten ihres Sohnes.
Sie hatten sich in die Bibliothek zurückgezogen und waren zu Französisch gewechselt, und die alte Frau umrundete den Kartentisch und sah sich jedes Blatt genau an. Gelegentlich streckte sie einen ihrer verkrümmten Finger aus und tippte auf eine Karte. Die ersten Abende hatte sie nur ihrem Sohn und seiner Frau geholfen, aber heute ließ sie auch die Gamaches ihres Beistands teilhaftig werden. Es war ein Spiel in aller Freundschaft, und die Einmischung schien niemanden zu stören, als Allerletztes Armand Gamache, der die Unterstützung gut brauchen konnte.
Die Wände waren von Regalen gesäumt, unterbrochen nur von dem Kamin, der aus großen Flusssteinen gemauert war, und den Terrassentüren, die in die Dunkelheit hinaussahen. Sie standen weit offen, um die leider allzu leichte Brise hereinzulassen, die der heiße Québecer Sommerabend zu bieten hatte. Was sie dagegen in Hülle und Fülle hereinließen, war das Trillern und Rufen aus dem Wald.
Alte Perserteppiche bedeckten den Parkettboden, und bequeme Sessel und Sofas waren für trauliche Gespräche oder gemütliche Lektürestunden zu Grüppchen aufgestellt. Dazwischen verteilt standen schöne Blumensträuße. Das Manoir Bellechasse schaffte den Spagat zwischen rustikal und raffiniert. Außen grob behauene Baumstämme, innen feines Kristall.
»Sie leben in Québec?« Reine-Marie sprach langsam und deutlich.
»Ich bin in Montréal geboren, lebe inzwischen aber in Toronto. Näher bei meinen Freunden. Die meisten haben Québec vor Jahren verlassen, aber ich bin geblieben. Damals brauchte kein Mensch Französisch. Nur so viel, dass man den Hausmädchen Anweisungen geben konnte.«
Mrs. Finney sprach fließend Französisch, hatte aber einen starken Akzent.
»Mutter.« Thomas wurde rot.
»Ich erinnere mich noch gut an die Zeit«, sagte Reine-Marie. »Meine Mutter war als Putzfrau beschäftigt.«
Mrs. Finney und Reine-Marie plauderten über schwere Arbeit und Kindererziehung, über die stille Revolution in den Sechzigerjahren, als die Québecer schließlich maîtres chez nous wurden. Herren im eigenen Haus.
»Wobei meine Mutter auch später noch die Häuser der Engländer in Westmount putzen ging«, sagte Reine-Marie und steckte ihre Karten in die richtige Reihenfolge. »Eins ohne.«
Madame Finney reckte den Hals, um besser sehen zu können, und nickte bestätigend. »Ich hoffe, die Leute, für die sie putzte, waren freundlicher zu ihr. Zu meiner eigenen Beschämung muss ich sagen, dass ich auch das erst lernen musste. Es fiel mir fast so schwer wie der Subjonctif.«
»Es war eine interessante Zeit«, sagte Gamache. »Die meisten Frankokanadier waren begeistert, aber ich bin mir bewusst, dass die Anglokanadier einen schrecklichen Preis zu zahlen hatten.«
»Wir haben unsere Kinder verloren«, sagte Mrs. Finney und nahm ihre Umrundung des Tischs wieder auf. »Sie gingen fort, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo man ihre Sprache sprach. Sie mögen Herren im eigenen Haus geworden sein, aber wir wurden zu Fremden, in der eigenen Heimat nicht mehr willkommen. Sie haben recht. Es war schrecklich.«
Sie tippte auf die Kreuz zehn in seiner Hand, die höchste Karte. In ihrer Stimme schwangen weder Wehmut noch Selbstmitleid mit. Nur ein gewisser Tadel vielleicht.
»Passe«, sagte Gamache. Er spielte mit Sandra zusammen und Reine-Marie mit Thomas.
»Ich verlasse Québec«, sagte Thomas, der Französisch besser zu verstehen als zu sprechen schien, was allerdings besser war als andersherum. »Ich ging weit weg zur Universität und siedle nach Toronto. Québec ist schwer.«
Erstaunlich, dachte Gamache, während er Thomas zuhörte. Wenn er des Französischen nicht mächtig gewesen wäre, hätte er geschworen, dass der Mann zweisprachig war, da er fast akzentfrei sprach. Aber inhaltlich und grammatikalisch, da fehlte ihm ein gewisses je ne sais quoi.
»Drei ohne«, sagte Thomas.
Seine Mutter schüttelte den Kopf und sagte: »Tststs.«
Thomas lachte. »Oh, die scharfe mütterliche Zunge.« Gamache lächelte. Er mochte den Mann, wie wahrscheinlich jeder, dachte er.
»Ist eines Ihrer Kinder in Québec geblieben?«, fragte Reine-Marie Mrs. Finney. Die Gamaches hatten wenigstens ihre Tochter Annie, die nach wie vor in Montréal lebte, aber sie vermisste Daniel tagtäglich und fragte sich, wie diese Frau und so viele andere mit dem Weggehen ihrer Kinder fertig geworden waren. Kein Wunder, dass sie nicht immer gut auf die Québecer zu sprechen waren. Weil sie das Gefühl hatten, einer Sprache wegen ihre Kinder verloren zu haben. Ohne dass es ihnen gedankt worden war. Oft genug war sogar das Gegenteil der Fall. Unter den Québecern blieb der leise Verdacht bestehen, dass die Engländer nur darauf warteten, dass ihre Zeit kam, um sie wieder unters Joch zu zwingen.
»Eines. Mein anderer Sohn.«
»Spot. Er und seine Frau Claire kommen morgen«, sagte Thomas auf Englisch. Gamache blickte von seinen Karten auf, die ohnehin nicht besonders vielversprechend aussahen, und musterte seinen Sitznachbarn.
Thomas hatte wie vorhin seine Schwester Julia ganz heiter geklungen, als er auf seinen Bruder zu sprechen kam. Aber da war irgendein merkwürdiger Unterton.
Er spürte, wie sich in dem Teil seines Hirns etwas zu regen begann, den er im Manoir eigentlich überhaupt nicht hatte benutzen wollen.
Jetzt war Sandra mit dem Bieten an der Reihe. Gamache warf seiner Partnerin einen eindringlichen Blick zu.
Passen, passen, dachte er verzweifelt. Ich kann nicht. Sie werden uns fertigmachen.
Er wusste, dass Bridge sowohl ein Kartenspiel als auch eine Übung in Telepathie war.
»Spot«, schnaubte Sandra. »Typisch. Kommt wieder mal in letzter Minute. Wie immer nur zum absolut Nötigsten bereit. Vier, ohne.«
Reine-Marie rekontrierte.
»Sandra«, sagte Thomas mit einem Lachen, das den Tadel in seiner Stimme kaum überdeckte.
»Stimmt doch. Alle anderen kommen schon Tage vorher, um deinen Vater zu ehren, und er trudelt in allerletzter Minute ein. Furchtbarer Mann.«
Schweigen. Sandras Blick wanderte von ihrer Hand zu dem Konfektteller, den der Kellner auf den Tisch gestellt hatte.
Gamache sah zu Madame Finney, aber sie schien nicht auf das Gespräch zu achten, auch wenn er überzeugt war, dass ihr kein Wort entging. Dann schaute er zu Monsieur Finney, der auf einem Sofa saß. Finneys krankes Auge irrte durch das Zimmer, und seine Haare standen in alle Richtungen, sodass sein Kopf wie ein kaputter Sputnik aussah, der in einem Affenzahn auf dem Erdboden aufgeschlagen war. Für einen Mann, der gefeiert werden sollte, wirkte er merkwürdig verloren. Finneys Auge blieb an einem riesigen Gemälde von Krieghoff über dem Kamin hängen, einer ländlichen Szene. Québecer Bauern beluden einen Karren, und vor einer Kate stand eine dicke Frau, die einen Korb mit Essen unter dem Arm trug und lachte.
Es war eine anheimelnde und einladende Szene aus dem Dorfleben längst vergangener Zeiten. Finney schien sie der Szene um ihn herum vorzuziehen.
Mariana stand auf und schlenderte zu den Kartenspielern.
Thomas und Sandra pressten ihre Karten an die Brust. Sie nahm eine Ausgabe der Châtelaine. »Laut einer Studie«, las sie vor, »finden die meisten Kanadier, dass sich Banane am besten für Schokoladenfondue eignet.«
Erneutes Schweigen.
Mariana stellte sich vor, wie ihre Mutter an dem Trüffel erstickte, den sie gerade in den Mund gesteckt hatte.
»So ein Quatsch«, sagte Sandra, deren Blick ebenfalls an Madame Finney hängen geblieben war. »Erdbeeren sind doch viel besser.«
»Ich mochte immer Birnen und Schokolade. Ungewöhnlich vielleicht, aber wirklich fein, oder was meinen Sie?«, fragte Thomas Reine-Marie, die nichts darauf erwiderte.
»Ach, hier seid ihr. Keiner hat mir Bescheid gesagt.« Julia schwebte durch die Terrassentür. »Worüber redet ihr?«
Aus irgendeinem Grund sah sie zu Gamache.
»Passe«, sagte er. Er hatte das Gespräch seit einiger Zeit nicht mehr verfolgt.
»Dass Magilla ein echter Fan von Bananen mit geschmolzener Schokolade ist.« Thomas deutete mit dem Kinn zu Mariana. Dafür erntete er wieherndes Gelächter, und die Gamaches sahen sich amüsiert, wenn auch etwas verwirrt an.
»Verkaufen die Mönche hier nicht Blaubeeren in Schokolade?«, fragte Julia. »Ich muss mir unbedingt welche besorgen, bevor wir fahren.«
Für die nächsten paar Minuten war das Spiel vergessen, während sie über das Thema Obst und Schokolade debattierten. Schließlich zogen sich Julia und Mariana in zwei verschiedene Ecken zurück.
»Ich passe«, erklärte Thomas, nachdem er sich erneut in sein Blatt versenkt hatte.
Bitte passen. Gamache starrte Sandra intensiv an, damit sie seine Botschaft auch ja empfing. Bitte, bitte passen.
»Ich rekontriere.« Sandra funkelte Thomas an.
Hier haben wir es ganz eindeutig mit schweren Kommunikationsstörungen zu tun, dachte Gamache.
»Also wirklich, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?«, fragte Sandra und verzog ihre dicken Lippen zu einem Schmollmund, als sie die Karten sah, die Gamache auf den Tisch legte.
»Ja, wirklich, Armand.« Reine-Marie lächelte. »Sechs ohne mit diesem Blatt? Was hast du dir dabei nur gedacht?«
Gamache erhob sich und verbeugte sich leicht. »Die Schuld liegt ganz bei mir.« Er wechselte einen höchst amüsierten Blick mit seiner Frau.
Das Dummerchen zu sein hatte auch seine Vorteile. Er streckte die Beine, nippte an seinem Cognac und ging ein wenig im Zimmer herum. Es wurde immer heißer. Normalerweise kühlte es hier in der Gegend an den Abenden ab, aber heute nicht. Er spürte regelrecht, wie die schwüle Luft heraufzog, und lockerte Krawatte und Hemdkragen.
»Sehr gewagt«, sagte Julia, die sich neben ihn gestellt hatte, während er erneut den Krieghoff betrachtete. »Legen Sie ab?«
»Ich denke, eine peinliche Vorstellung pro Tag reicht.« Er nickte zu dem Tisch, wo die drei Bridgespieler sich auf ihre Karten konzentrierten.
Er beugte sich vor und roch an den Rosen auf dem Kaminsims.
»Sind sie nicht bezaubernd? So wie alles hier.« Sie klang wehmütig, so als vermisse sie diesen Ort schon jetzt. Dann erinnerte er sich an Spot und dachte, dass es vielleicht der letzte nette Abend für die Finneys war.
»Das verlorene Paradies«, murmelte er.
»Pardon?«
»Nichts, ich habe nur laut gedacht.«
»Haben Sie überlegt, ob es besser ist, in der Hölle zu herrschen oder im Himmel zu dienen?«, fragte Julia mit einem Lächeln. Er lachte. So wie ihrer Mutter entging auch ihr nichts, selbst ein Milton-Zitat nicht. »Denn darauf wüsste ich die Antwort. Da ist ja die Eleanor«, sagte sie und deutete auf eine leuchtend rosa Rose in dem Strauß. »Wie schön.«
»Irgendjemand hat heute Abend schon einmal von dieser Rose gesprochen«, erinnerte sich Gamache.
»Thomas.«
»Stimmt. Er wollte wissen, ob Sie eine im Garten gefunden haben.«
»Das ist ein kleiner Witz zwischen uns Geschwistern. Sie ist nach Eleanor Roosevelt benannt, wie Sie vielleicht wissen.«
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Ja«, sagte Julia, betrachtete gedankenverloren die Rose und nickte. »Sie hat erklärt, dass sie zuerst sehr geschmeichelt gewesen sei, bis sie die Beschreibung im Katalog gelesen habe. Die Rose Eleanor Roosevelt: kräftige Triebentwicklung, robust und handfest.«
Sie lachten, und Gamache sprach der Rose und dem Zitat sein Kompliment aus, fragte sich aber, was es mit Julia zu tun hatte.
»Noch jemand Kaffee?«
Julia zuckte zusammen.
Pierre stand mit einer silbernen Kaffeekanne in der Tür. Er hatte die Frage zwar an alle Anwesenden gerichtet, sah dabei aber Julia an und errötete auch noch leicht. Am anderen Ende des Raums murmelte Mariana: »Da haben wir es mal wieder.« Jedes Mal, wenn der Maître d’ im selben Zimmer wie Julia war, errötete er. Sie kannte das. Sie hatte von frühester Jugend an damit gelebt. Mariana war das nette Mädchen von nebenan. Diejenige, mit der man im Auto knutschen und herumfummeln konnte. Aber Julia war diejenige, die alle heiraten wollten, selbst der Maître d’.
Während Mariana ihre Schwester beobachtete, merkte sie, dass ihr das Blut ins Gesicht schoss, was allerdings nichts mit dem Maître d’ zu tun hatte. Sie sah zu, wie Pierre den Kaffee einschenkte, und stellte sich dabei vor, wie der riesige gerahmte Krieghoff von der Wand fiel und Julias Kopf zerschmetterte.
»Sehen Sie nur, was Sie angerichtet haben«, maulte Sandra in Gamaches Richtung, während Thomas ihr Karte um Karte wegstach. Schließlich standen sie vom Tisch auf, und Thomas gesellte sich zu Gamache, der inzwischen die anderen Gemälde in dem Zimmer betrachtete.
»Das ist ein Brigite Normandin, oder?«, fragte Thomas.
»Ja. Phantastisch. Sehr aufregend, sehr modern. Eine gute Ergänzung zu dem Molinari und dem Riopelle. Und sie alle passen ausgezeichnet zu dem Krieghoff.«
»Sie kennen sich gut aus, was?«, fragte Thomas leicht erstaunt.
»Ich interessiere mich sehr für die Geschichte Québecs«, sagte Gamache und deutete auf die Dorfszene.
»Das erklärt allerdings nicht, warum Sie die anderen Bilder kennen, oder?«
»Unterziehen Sie mich hier etwa einer kleinen Prüfung, Monsieur?« Gamache beschloss, sich aus der Defensive zu begeben.
»Vielleicht«, gestand Thomas. »Autodidakten sind selten.«
»Vor allem in Gefangenschaft«, sagte Gamache, und Thomas lachte. Das Gemälde, vor dem sie standen, war zurückhaltend, schlichte Linien in verschiedenen Beigetönen.
»Sieht aus wie eine Wüste«, sagte Gamache. »Öde und verlassen.«
»Ach, das stimmt doch gar nicht«, sagte Thomas.
»Nicht schon wieder!«, sagte Mariana.
»Bitte nicht die Geschichte von der Pflanze«, sagte Julia und wandte sich an Sandra. »Tischt er die immer noch jedem auf?«
»Einmal täglich, so sicher wie das Amen in der Kirche. Nicht hinhören.«
»Nun, Zeit, ins Bett zu gehen«, sagte Madame Finney. Ächzend erhob sich ihr Mann, und die beiden Alten gingen.
»Die Dinge sind anders, als sie scheinen«, sagte Thomas, und Gamache sah ihn überrascht an. »In der Wüste, meine ich. Sie sieht öde und verlassen aus, aber dort ist überall Leben, man sieht es nur nicht. Es verbirgt sich aus Angst, gefressen zu werden. In der südafrikanischen Wüste gibt es eine Familie von Pflanzen, die Lebende Steine genannt werden. Können Sie sich vorstellen, wie sie für das eigene Überleben sorgt?«
»Lass mich überlegen. Indem sie so tut, als sei sie ein Stein?«, fragte Julia. Thomas warf ihr einen wütenden Blick zu, aber sofort glättete sich seine Miene wieder.
»Du hast die Geschichte offenbar nicht vergessen.«
»Ich habe nichts vergessen, Thomas«, sagte Julia und setzte sich. Gamache hörte genau zu. Die Finneys sprachen kaum miteinander, aber wenn sie es taten, dann steckten ihre Worte voller Hintersinn, den er nicht durchschaute.
Thomas zögerte, dann wandte er sich wieder Gamache zu, der sich nach seinem Bett sehnte, vor allem aber danach, dass diese Geschichte ein Ende nahm.
»Sie tun so, als seien sie Steine«, sagte Thomas, und sein Blick bohrte sich in Gamaches Augen. Dieser wurde sich plötzlich bewusst, dass das ganze Gerede nicht belanglos war. Irgendetwas wurde ihm mitgeteilt. Nur was?
»Um überleben zu können, muss sich die Pflanze verstecken. Vorschützen, etwas zu sein, was sie nicht ist«, sagte Thomas.
»Es ist nur eine Pflanze«, sagte Mariana. »Sie tut doch nichts mit Absicht.«
»Unheimlich«, sagte Julia. »Dieser Überlebensinstinkt.«
»Es ist eine Pflanze!«, wiederholte Mariana. »Sei doch nicht dumm.«
Genial, dachte Gamache. Sie wagte nicht, sich so zu zeigen, wie sie war, weil sie dann getötet werden könnte. Was hatte Thomas gerade gesagt?
Die Dinge sind nicht das, was sie scheinen. Langsam fing er an, es zu glauben.