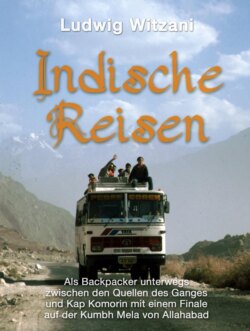Читать книгу Indische Reisen - Ludwig Witzani - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI Im Drahtkäfig
Ayodhya. Indiens offene Wunde
Gestern gingen Bomben hoch in Hyderabad. 14 Tote. Kein guter Tag, um nach Ayodhya zu fahren. Aber wenn ich jetzt nicht fahren würde, käme ich niemals dorthin. Und einmal im Leben sollte jeder, der sich für Indien interessiert, in Ayodhya gewesen sein.
Auf der Plattform 15 des Busbahnhofes in Lucknow wartete bereits der Bus nach Faizerbad. Der Fahrer trug einen Salafistenbart und war ein sympathischer Kerl, der mich gleich auf einen Sitz in der Fahrerkabine einlud. Von dort aus durfte ich zusehen, wie er anschließend die Frontscheibe seines Busses hingebungsvoll mit Zeitungspapier reinigte. Sauber wurde es nicht, aber immerhin wurde der Dreck auf diese Weise gut über die Fensterfläche verteilt. Fliegende Händler nutzten die Wartezeit, um im Minutenabstand zuzusteigen und ihre Waren anpriesen. Der erste war ein Textilverkäufer, der es sich nach einer kurzen Ansprache nicht nehmen ließ, seine Tischdecken im Eingangsbereich des Busses auszupacken und wild an ihnen wild herumzureißen, um zu demonstrieren, wie stabil sie waren. Als nächster erschien ein dürrer Mensch, der Zahnbürsten anpries und zur Demonstration mit ihnen in seinem eigenen Mund herumputzte. Leider wurden dabei sehr schadhafte Zähne sichtbar, was dem Verkauf wenig förderlich war, sodass er sich schließlich ohne Absatz trollte. Der dritte, der es noch in den Bus schaffte, ehe die Frontscheibe fertig geputzt war, entpuppte sich als ein Parfümhändler. Er öffnete eine grell bemalte Flasche, und sofort entströmte dem Gefäß ein regelrechter Freudenhausgeruch, so intensiv, dass die Gespräche in den ersten Reihen erstarben. Ein Inder mit verschwitztem Gesicht und einer fleckigen Jacke roch an der Flaschenöffnung und erwarb das Produkt.
Dann ging es endlich los, doch es dauerte fast eine geschlagene Stunde, ehe der Bus den Großraum Lucknow verlassen hatte. Ich notierte: Wie groß eine indische Stadt ist, erkennt man immer erst, wenn man versucht, sie mit einem Bus zu verlassen. Straßenschlucht folgte auf Straßenschlucht, vor den Kreisverkehrsrondellen krachten die Fahrzeuge in karrengroße Schlaglöcher, und vor jedem Bahnübergang gab es einen Stau. Wenn es dann einmal auf einer Geraden etwas schneller voranging, schossen Mofas, Rikschas und Kleinwagen pfeilschnell links und rechts am Bus vorüber, behinderten, schnitten oder gefährdeten sich gegenseitig, als wäre die Gefahr eines Zusammenstoßes nur eine theoretische Eventualität, mit der man nicht wirklich rechnen müsste. Jahrelange Schnibbelpraxis beim Überholen und hemmungsloses Gottvertrauen ermöglichen in Indien im Vergleich zu europäischen Ländern das Doppelte bis das Dreifache des normalen Verkehrsaufkommens auf einer gegebenen Fläche. Wenn es aber doch einmal kracht, geht es oft nicht ohne Tote ab.
Dann außerhalb von Lucknow die nächste Überraschung: ein Highway oder besser gesagt: eine zweispurige Schnellstraße auf dem Weg zur Autobahn, an deren Rändern zwar noch immer die Ziegen grasten, auf der aber immerhin Spitzengeschwindigkeiten von bis zu achtzig Stundenkilometern möglich waren. In einem so schnellen Gefährt sitzend hatte ich die Landschaft Uttar Pradeshs noch nie gesehen. Wie ein impressionistisches Gemälde, dessen Details an den Rändern verschwammen, huschte sie vorbei – eine flache Landschaft zwischen Verbuschung und Kultivierung, Heimat von insgesamt fast zweihundert Millionen Menschen im größten Bundesstaat der Indischen Union. Weite Felder, auf denen Menschen Salatköpfe zählten, überall Straßenarbeiten, aufgerissener Lehmboden, dann wieder lang gezogene Dörfer, die der Bus ohne anzuhalten durchraste – das war das ländliche Uttar Pradesh, das sich als eine flache Ebene über etwa 230.000 Quadratkilometer im indischen Norden erstreckte.
Nach drei Fahrtstunden war die Busfahrt in Faizerbad zu Ende, und ich stieg in ein Tempo, um nach Ayodhya zu gelangen. Ein Tempo trägt seinen Namen natürlich nur als Euphemismus - in Wahrheit handelt es sich um die Kollektivvariante einer Rikscha, die mit der doppelten Sitzfläche ein vierfaches Passagieraufkommen bewältigt. In dem Tempo, das mich von Faizerbad in das nur neun Kilometer entfernte Ayodhya bringen sollte, saßen bereits zehn Personen und ein Huhn. Zuunterst hockten auf der schmalen Pritsche drei würdige Matronen, auf ihnen vier Kinder und das besagte Huhn – neben ihnen drei Jugendliche, die je einen Teil ihres Hinterns aus dem Fenster heraushängen ließen und nur mit je einer Hinterbacke Kontakt zur Sitzfläche hielten. Ich hasse Tempos nicht so sehr wegen ihrer Enge, sondern weil man im Falle eines Unfalls in einem solchen Gedränge praktisch keine Überlebenschance besitzt. Außerdem ist für einen Westtouristen das Einsparpotenzial im Vergleich zu einer gewöhnlichen Rikscha nicht der Rede wert, allerdings befanden sich in Faizerbad die normalen Rikschas offenbar alle anderswo, sodass ich mich wohl oder übel in das offene Tempo-Fahrerhaus neben den Fahrer und seinen Kumpel quetschte.
Auf den ersten Blick sah es in Ayodhya nicht anders aus als in den meisten indischen Großstädten, die ich bis dahin besucht hatte. Für indische Verhältnisse handelte es sich sogar nur um eine relativ kleine Stadt - gerade einmal 40.000 Menschen lebten hier am Sarayu River. Ohrenbetäubender Lärm, Hupattacken, Staub und Hitze, Menschenmassen – zunächst das gewohnte Bühnenbild indischer Urbanität. Erst auf den zweiten Blick erkannte ich, dass Ayodhya anders war als andere Orte: Es gab kaum Banken, wenig Geschäftshäuser, dafür unzählige Pilger, die allein oder in Gruppen durch die Gassen gingen. Ich sah Bettler, Sadhus, Götterschreine und jede Menge Devotionalienbuden mit Skulpturen in allen Farben und Lebensgrößen. Ich befand mich in einer heiligen Stadt.
Natürlich gibt es in Indien jede Menge heiliger Städte. Heilig sind die vier Achsenstädte Rameswaram in Tamil Nadu, Puri in Orissa, Dwarka in Gujarat und Badrinath im Himalaja. In Allahabad, Haridwar, Ujjain und Nasik wird alle zwölf Jahre die Kumbh Mela gefeiert, das Fest des Kruges, und selbstverständlich sind auch diese Städte heilig. Daneben pilgern die Inder zusätzlich zu jenen Städten, die zu einer bestimmten Gottheit in einer besonderen Beziehung stehen – allen voran nach Varanasi, der heiligen Stadt Lord Shivas.
Längst nicht jedem Gott ist eine heilige Stadt zugeordnet, dafür gibt es einfach viel zu viele Götter. In der indischen Kolonialzeit wurde behauptet, es seien 330 Millionen, womit damals auf jeden Inder ein Gott gekommen wäre, was für das westliche Gemüt verwirrend ist, aber mehr als alles andere verdeutlicht, dass es sich mit den indischen Göttern ganz anders verhält als mit Jahwe, Jesus oder Allah. Vielleicht ist Ganesha auch deswegen bei den Touristen so beliebt, weil man ihn unter so vielen Göttern an seinem Elefantenrüssel immer unzweideutig identifizieren kann. Ganz anders verhält es sich zum Beispiel mit Vishnu, der neben Shiva alles überragenden Göttergestalt des Hinduismus. Vishnu ist der Schöpfer und Erretter der Welt, so liest man es immer wieder, aber wenn man der Überlieferung glauben darf, dann tat er das bereits sehr oft in den unterschiedlichsten Inkarnationen. In seinen ersten drei Inkarnationen erschien Vishnu in Tiergestalt auf der Erde. Als Fisch zog er vor der Erschaffung der Welt die große Arche, als Schildkröte trug er den heiligen Berg Meru, während der Milchozean gequirlt wurde, und als Rieseneber rettete er die gerade erst erschaffeneWelt vor den Tiefen des Urozeans. Als Löwe erschlug er sodann in seiner vierten Inkarnation die Dämonen, die die Welt bedrohten, um schließlich als Zwerg, der ins Unermessliche wachsen konnte, die Erde auszumessen und einzuteilen. Inzwischen war auch das Menschengeschlecht auf der Erde erschienen und mit ihm das Laster, sodass Vishnu in seiner sechsten Inkarnation als „Mann mit der Axt“ zum Schrecken der Verbrecher wurde. In seiner siebten Inkarnation erschien Vishnu schließlich in Ayodhya, und zwar in Gestalt Lord Ramas, der beispielgebenden Figur der altindischen Kultur. Deswegen ist Ayodhya Lord Ramas Stadt.
Davon konnte sich jeder überzeugen, der auch nur wenige Schritte abseits der Hauptstraße durch die Pilgerviertel schlenderte. Überall standen lebensgroße Skulpuren von Lord Rama, und auf den großen Bildern wurden Szenen und Motive seines Lebens in grellen Farben dargestellt: Rama mit seinem gewaltigen Bogen, Rama, der seinen Helfer Hanuman umarmt, Rama und seine Gattin Sita, Rama mit seinem tiaraartigen Helm. Die penetrante Allgegenwart des Gottes an jeder Ecke und Bude hatte etwas Beunruhigendes, ebenso wie die krasse Ärmlichkeit der Pilger, die durch die Gassen gingen.
Ayodhya war ein durch und durch innerindisches Pilgerzentrum. Nichts an seiner Erscheinung gehorchte ästethetischen Rücksichten, die Stadt war authentisch bis zu Schmerzgrenze, nur auf sich selbst bezogen und sich selbst genug. Die Verstümmelungen des Leprakranken an der Ecke, die Eiterwunden der bettelnden Kinder, die Glasknochen des Yogis, der unbeweglich in der Sonne saß, verdeutlichen eine Grunderfahrung der indischen Wirklichkeit: das Leben war ein Tal des Leidens, und nur in der Entsagung konnte es Erlösung geben.
Auch Lord Rama hatte in seiner irdischen Existenz viel leiden müssen – aber nicht nur. Denn Rama aber wäre nicht die Inkarnation Vishnus, die neben Krishna die höchste Verehrung genießt, wenn sich seine Wesenszüge nur im Leiden erschöpfen würden. Rama ist nicht Buddha, hatte mir einmal ein Inder erklärt. Wer ihm etwas nimmt, dem zieht er die Ohren lang.
Für den gläubigen Hindu wurde Rama vor undenklichen Zeiten als Sohn des Königs von Ayodhya in Nordindien geboren. Schon als Prinz stach er unter seinen Brüder durch Tapferkeit, Kraft, Wohlgestalt und Charakter hervor, lauter Eigenschaften, die dazu beitrugen, dass er die schöne Sita zur Frau gewann. Infolge einer Intrige am Hofe seines Vaters musste Rama allerdings mit seiner Frau Sita in die Verbannung gehen, in der er unerhörte Heldentaten beging, bevor ihm der Dämon Ravana seine Frau Sita raubte. Unterstützt vom Affenkönig Sugriva und seinem Minister Hanuman verfolgte Rama den Ravana bis nach Sri Lanka, wo es ihm gelang, seinen Widersacher zu töten und seine Gattin Sita zu befreien. Diese Geschichte mit ihren kaum überschaubaren Einzelheiten und Nebenhandlungen gehört als „Ramayana“-Epos mit weit über 20.000 Zeilen zum Kernbestand der hinduistischen Kultur. Redlichkeit und Treue, Verlust und Wiedergewinn, Gerechtigkeit und Schuld, Entsagung und Reue – ein ganzer Kosmos ethischer Verhaltensweisen wird dem heranwachsenden Hindu anhand der Geschichten aus dem Ramayana-Epos als vorbildliches Verhalten vorgeführt.
So konnte es nicht ausbleiben, dass die Ramaverehrung mit einem kämpferischen Islam in Konflikt geriet, der seit dem 13. Jahrhundert immer größere Teile Indiens eroberte und für den die Hindugötter nichts weiter waren als widerliche Götzen, die es zur Ehre Gottes von der Erde auszutilgen galt. Die damit verbundene Gewaltanwendung und Zerstörung Hunderter hinduistischer Verehrungsstädten im ganzen Land hatte das Verhältnis von Islam und Hinduismus dauerhaft zerrüttet - doch nirgendwo hat der Konflikt eine derartige Intensität angenommen wie in Ayodhya. Lord Ramas Stadt ist zum Kristallisationspunkt eines gesamtindischen Religionskonfliktes geworden, der das Land zu zerreißen droht.
Die Ursprünge des Konfliktes reichten bis in das Jahr 1528 zurück, als der erste Großmogul Babur im Pilgerviertel von Ayodhya die Babri-Moschee errichteten ließ, ein Gotteshaus, das im Schatten des hinduistischen Pilgerbetriebes verblieb und nur wenig genutzt wurde. Obwohl immer wieder behauptet wurde, diese Moschee sei auf den Trümmern eines älteren Ramatempels und genau an dem Ort errichtet worden, an dem Lord Rama geboren worden war, blieben die Verhältnisse in Ayodhya unter der britischen Kolonialherrschaft jahrhundertelang ruhig und unaufgeregt.
Wirklich virulent wurde der Konflikte von heute aus betrachtet unmittelbar nach der indischen Unabhängigkeit durch das so genannte „Wunder von Ayodhya“, das sich am 22. Dezember 1949 ereignet haben soll. Umgeben von einer glühenden Aureole soll sich Lord Rama vor den Augen der Gläubigen in das Innere der Babri-Moschee von Ayodhya begeben und sich dort niedergelassen haben. Der damalige indische Ministerpräsident Nehru reagierte sofort und tat das einzig Richtige: Ehe sich die allgemeine Hysterie unter Hindus und Moslems voll entfalten konnte, ließ er die Moschee besetzen und sie für Moslems und Hindus gleichermaßen sperren.
Damit aber war das Problem in der Welt – die Hindus beklagten, das Lord Rama in einer Art Käfig in der Moschee gefangen sei und befreit werden müsse, die Moslems forderten die Räumung und Instandsetzung der besetzten Moschee, die von Jahr zu Jahr mehr verfiel. Und tatsächlich spross bald auf dem Moscheevorhof das Gras aus den Fugen, und die Risse im Gemäuer wurden immer bedrohlicher.
Trotzdem eskalierte der Konflikt zunächst nicht weiter. In der Fähigkeit, in unmöglichen Zuständen auf Dauer zu leben, macht dem Inder so schnell niemand etwas vor, und tatsächlich blieb es in Ayodhya fast dreißig Jahre lang relativ ruhig. Erst mit dem Erstarken des Hindunationalismus in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts erreichte der Konflikt die nächste Eskalationsstufe. Auf der Kumbh Mela von Allahabad im Jahre 1989, an der Millionen Hindus aus allen Teilen der indischen Welt teilnahmen, veröffentlichte der Weltrat der Hindus eine Liste von nicht weniger als 150 Moscheen, die allesamt auf den Ruinen zerstörter Hindutempel erbaut worden wären und die es folglich ihrerseits wieder abzureißen gelte. An erster Stelle auf dieser Liste stand die Babri-Moschee von Ayodhya mit der Begründung, dass sich genau an der Stelle, an der die Babri- Moschee errichtet worden sei, sich nicht nur ein älterer Ramatempel, sondern sogar der Geburtsort Lord Ramas lokalisieren ließe. In das Gesamtbild eines sich immer weiter verschärfenden Gegensatzes gehörte übrigens auch das herausragende Medienereignis des Jahres 1989: die landesweite Ausstrahlung einer erfolgreichen Fernsehbearbeitung des Ramayana-Epos, die von über 200 Millionen Menschen gesehen wurde.
So kochten die Emotionen auf beiden Seiten hoch, doch es war keine Lösung in Sicht. Ein Gerichtsverfahren folgte dem nächsten, und als ein Gerichtsurteil im Jahre 1992 endgültig entschied, dass alles beim Alten bleiben und die inzwischen fast verwaiste Moschee nicht abgerissen werden sollte, kam es zum Eklat. Ein schon vorher aus allen Teilen des Landes herangekarrter Hindumob stürmte am 6. Dezember 1992 die Moschee, schlug sie in kürzester Zeit kurz und klein und errichtete auf ihren Trümmern in aller Eile einen provisorischen Schrein, der als Ram-Janmabhumi-Tempel bezeichnet und nun ebenfalls als sakrosant erklärt wurde.
Damit war Indiens offene Wunde wieder aufgerissen. Obwohl in Ayodhya das Gelände der geschändeten Moschee sofort von einem großen Armeeaufgebot besetzt wurde, um alle weiteren Veränderungen des status quo zu verhindern, brachen unmittelbar nach der Stürmung der Moschee bürgerkriegsähnliche Unruhen im ganzen Land aus. Angeheizt von den Parolen verantwortungsloser Demagogen auf beiden Seiten gingen sich Moslems und Hindus an die Kehle, und Tausende Tote, vor allem in Maharashtra und Gujarat, waren die Folge.
Wie aber sollte es weitergehen? Niemals würden die über einhundertfünfzig Millionen Moslems in Indien dulden, dass auf den Ruinen einer mutwillig zerstörten Moschee ein Hindutempel errichtet werden würde. Ebenso wenig aber wollten die Hindus zulassen, dass der gerade erst etablierte Ramaschrein wieder abgebaut würde. Wie eine heiße Kartoffel wurde der Streitfall von Gericht zu Gericht gereicht, während die Armee ihre Präsenz an den Ruinen der Babri-Moschee immer mehr ausbaute. Schließlich erging das Urteil, dass der Ramatempel auf dem Gelände der zerstörten Moschee erbaut werden sollte, wenn der unzweifelhafte Nachweis gelänge, dass vor 1528 an der Stelle der Babri-Moschee auch tatsächlich ein Ramatempel gestanden hätte. Dieser Nachweis konnte nicht zwingend erbracht werden. Fundamentalistische Überzeugung und wissenschaftlicher Nachweis waren nicht zur Deckung zu bringen.
Seitdem gilt der ehemalige Moscheebezirk von Ayodhya als Indiens heikelster Platz, und ein Besuch auf dem Gelände der zerstörten Babri-Moschee lehrt mehr über die innerindischen Religionskonflikte als ein Dutzend Seminare. Es handelt sich allerdings um eine Sehenswürdigkeit der besonderen Art, um die alle großen Fernreiseanbieter einen großen Bogen machen. Zu angespannt ist die Stimmung, zu schnell kann aus nichtigen Anlässen eine Gewalt entstehen, die niemand mehr kontrollieren kann.
So weit ich sehen konnte, war ich tatsächlich der einzige Tourist in Lord Ramas Stadt, und so war es kein Wunder, dass ich immer wieder angesprochen wurde. Ein Inder, mit dem ich an einem Tschaistand ins Gespräch kam, stellte sich als Pilger aus Indore in Madhya Pradesh vor und erzählte, dass die Steinmetze in Ayodhya schon mit der Planung für den neuen Ramatempel begonnen hätten. Für ihn konnte es keinen Zweifel daran geben, dass in uralten Zeiten in Ayodhya ein großer Ramatempel gestanden hatte, und bald würde es wieder so sein, spätestens dann wenn die BJP die nächsten Wahlen gewänne. An einem Marktstand mit Rama- und Sitabildern in allen Größen und Preislagen wurden DVDs angeboten, auf denen der Angriff auf die Moschee als Filmdokumentation zu sehen war. Untermalt von martialischer Musik zeigten die Aufnahmen in verwackelten Bildern wie die fanatisierten Massen am 6. Dezember 1992 brüllend durch die Straßen Ayodhyas zogen, um sich mit den Polizisten zu prügeln, die nach kurzer Zeit Reißaus nahmen. Hindufahnen wehten im Wind, Umrisse einer Ramaskulptur wurden eingeblendet, dann erschienen Hindus mit Hacken, Spaten und Beilen und begannen damit, die Moschee zu demolieren.
Während ich mir diese Filmausschnitte ansah, bildete sich eine Zuschauergruppe von Jugendlichen um mich, die mit beifälligem Kopfnicken dem Geschehen auf dem Screen folgten. Die Stimmung war triumfalistisch, über die Kräfteverteilung vor Ort konnte es keine Zweifel geben.
Hinter dem Devotionalienmarkt befand sich der Bezirk der zerstörten Moschee, doch auf den ersten Blick war nichts anderes zu erkennen als ein mehrstöckiges Haus und eine hohe Mauer, die jeden Einblick in das Gelände verhinderte. Soldaten hatten den gesamten Bezirk weiträumig abgeriegelt und mehrere Kontrollposten errichtet, an denen alle Pilger intensiv gefilzt wurden. Meine Kamera, meinen Reiseführer, selbst mein Skizzenbuch musste ich bei einer wenig vertrauenserweckenden Gepäckaufbewahrung abgeben, und selbst danach war der diensthabende Offizier unsicher, ob ich als Ausländer ohne schriftliche Genehmigung irgendeiner Behörde Zutritt zum Gelände erhalten sollte. Er war klein und fett, schnauzbärtig und dunkelhäutig, alles in allem keine Heldengestalt, die an Lord Rama erinnerte, aber deutlich verärgert über die Scherereien, die ihm meine Anwesenheit bereiteten. Ein Rückruf in die Kommandozentrale ergab keine bündige Auskunft, sodass er sich erst einmal eine Zigarette ansteckte und rauchte. Dann geschah eine halbe Stunde nichts, während ich mich in den Schatten setzte und die indischen Pilger beobachtete, die die Kontrollen anstandslos passierten und in dem Haus verschwanden. Dann erschien ein zweiter Offizier, wechselte ein paar Worte mit seinem Mitstreiter, der eine wegwerfende Handbewegung in meine Richtung machte. Dann durfte ich hinein.
Zu meiner Überraschung begann nur wenige Meter hinter dem Eingang ein mannshoher, etwa einen Meter fünfzig breiter Käfiggang, der über eine Strecke von etwa zweihundert Metern aus dem Haus heraus auf das Gelände der zerstörten Moschee führte. Rechts und links von diesem schlauchartigen Käfigverhau standen schwer bewaffnete Soldaten und beobachten mit Argusaugen jede Regung innerhalb der Menschenmenge. Die Armeeangehörigen hatten automatische Waffen in den Händen und die meisten von ihnen standen hinter Sandsäcken, als sei jeden Augenblick der Ausbruch einer rasenden Menge aus dem Drahtverhau möglich. Aus der Luft gegriffen war diese Vorsicht nicht - seitdem im Oktober 2001 Hindufundamentalisten auf dem Gelände randaliert hatten und vor allem seitdem fünf schwer bewaffnete moslemische Selbstmordattentäter im Juli 2005 den Ramaschrein angegriffen hatten, mussten die Behörden jederzeit mit einer Attacke rechnen.
Niemand schaut in das Herz religiös ergriffener Mitmenschen hinein, doch als ich mich umblickte, kam mir diese Vorsorge übertrieben vor. Jugendliche in ihren besten Jeans und mit gefakten Marken-Shirts, alte Mütterlein in ihren Saris, aber auch Brahmanen in ihren weißen Umhängen bewegten sich brav und gottergeben im Entengang durch den Käfig. Neben mir ging ein älterer Hindu aus Kathmandu, der mir erzählte, dass er sein Leben lang für die Wallfahrt nach Ayodhya gespart hatte. Nun sei seine Frau überraschend gestorben, und er müsse Rama alleine seine Verehrung bezeugen.
Langsam änderte sich die Stimmung, je mehr wir uns dem Ramaschrein näherten. Von vorne hörte man die Gesänge und Parolen der Pilger, die den Schrein bereits erreicht hatten, die Skandierungen pflanzten sich fort bis in meine Umgebung, in der nun sogar die älteren Frauen zu zetern begannen. Die Körpersprache der Pilger um mich herum veränderte sich, plötzlich lag Spannung in der Luft, und die Jugendlichen im Käfiggang blickten mit düsteren Mienen auf die Soldaten jenseits der Käfiggitter. Es dauerte noch weitere zehn Minuten, ehe ich inmitten dieser aufgeregten Menschenmenge den Eingang der zerstörten Moschee erreichte und aus etwa vier Metern Entfernung einen Blick auf den Ramaschrein werfen konnte. Durch die hin- und herlaufenden Soldaten kaum zu sehen, erkannte ich ein winziges Murti, eine Götterdarstellung auf einem Unterstand, eingehüllt in rote Tücher und geschmückt mit zahlreichen Blumengirlanden. Das wars. Kaum zu glauben, dass ein derart kümmerliches Gebilde einen ganzen Subkontinent in Wallung bringen konnte. In meiner Umgebung aber brachen die meisten Pilger beim Anblick des Ramaschreins in laute Ram-Ram Rufe aus, manche schüttelten die Fäuste und einige rüttelten sogar an den Gitterstäben, als wollten sie aus dem Käfig ausbrechen. Ein Hauch von Hysterie lag in der Luft, die Mienen vieler Pilger schwankten zwischen Zorn und Schmerz, als gräme sie das Unrecht, dass ihrem Gott am Ort seiner Geburt von den Moslems angetan worden war. Der Käfig, in dem sie Lord Rama gefangen wähnten, umgab nun auch sie, die doch nichts anderes im Sinn hatten, als ihrem geschändeten Gott zu huldigen. Es war heiß, eng und nervig, die Gesichter der Soldaten mit ihren Gewehren im Anschlag jenseits des Drahtganges aber blieben unbewegt Gefühlsregung von ihrer Seite hätte die Situation eskalieren lassen können.
Jedem, der in die zwanghaft neutralen Gesichter der Soldaten und die kämpferischen Mienen der Pilger blickte, hätte an der Zukunft Indiens fast verzweifeln können, denn die Situation war ebenso artifiziell wie hoffnungslos. Gerade weil religiös fanatisierte Gruppen, wenn man ihnen in einem säkularen Staat freie Hand ließe, diesen Staat sprengen und das ganze Land in einen Bürgerkrieg stürzen würde, hatte man in Ayodhya diese religiösen Energien buchstäblich eingehegt. Man hatte sie in Gestalt der Pilger wie gefährliche Infektionsquellen hinter Draht gesperrt, sodass sie isoliert und kontrollierbar blieben. Der abstoßend hässliche Drahtverhau von Ayodhya war nicht mehr und nicht weniger als die mühsam bewachte Brandmauer, die den weltlichen indischen Staat davor bewahrte, auseinandergerissen zu werden. Sobald dieser Käfig hier oder anderswo fallen würde, wäre es um diesen Staat geschehen.
Vielleicht hatte dieser Zusammenbruch auch schon begonnen. Denn als die islamistischen Terroristen im Jahre 2007 das Massaker in Taj Mahal Hotel in Bombay anrichteten und mit ihren automatischen Waffen wehrlose Menschen niederschossen, schrien sie: „Remember Babri Masjid!“