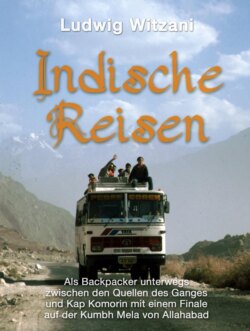Читать книгу Indische Reisen - Ludwig Witzani - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII Krishna wird die Yamuna retten
Mathura und Vrindaban
Sie kamen aus Etawah und Agra, von Tudna und Shikodabad, manche waren einige Tage, andere schon einige Wochen auf der Straße. Die meisten waren zu Fuß unterwegs, ihren Henkelmann in der Linken und in der Rechten einen Wanderstock, eine Fahne oder ein Plakat mit einem Götterbild. Schon lange bevor Mathura erreicht war, hatten sie den Verkehr behindert, Bahnübergänge blockiert und bereits die ersten Auseinandersetzungen mit der Polizei durchgestanden. „Bull Power“ stand auf einem großen Transparent über einem von zwei Rindern gezogenen Karren, und an beiden Seiten des Gefährts waren Bilder eines dunkelhäutigen Gottes befestigt. Es ging um Krishna, und das hieß: Es ging um Gerechtigkeit.
Niemand wird Indien je verstehen, der nicht weiß, wer Krishna ist. Ganz Indien ist voller Krishnas – Krishna der Hirte, der mit den Gopis scherzt, Krishna der Held, der den bösen König Kamsa tötet, Krishna der Liebhaber der wunderbaren Radha, Krishna, der Wagenlenker Arjunas und der Verkünder der Baghavad-Gita. Krishna ist allgegenwärtig - als Murti in den Tempelschreinen, als Idol auf dem Armaturenbrett unseres Busfahrers, als Götterbildchen in der Brieftasche des Teppichhändlers und als Parole aller Menschen, die sich gegen Unterdrückung wehren. Millionenfach abgebildet in allen nur denkbaren Erscheinungsformen gleichen die immer neu erzählten Krishna-Legenden kollektiven Beschwörungen einer idealen indischen Welt, in der die Wiederherstellung der Gerechtigkeit, der Gewinn der vollkommenen Liebe, aber auch die friedvolle Wiedervereinigung mit Gott endlich zur Deckung kommen.
Die Bauern, Händler, Mönche und Tagelöhner, die über Hunderte von Kilometern durch Uttar Pradesch nach Delhi wanderten, protestierten im Namen Krishnas gegen den Tod der Yamuna. Denn die Yamuna, einer der heiligsten Ströme Indiens, die im Himalaja entspringt, Delhi und Agra durchfließt und sich im Süden bei Allahabad mit dem Ganges vereinigt, war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Seitdem der Harikundh-Staudamm nördlich von Delhi das frische Wasser der Yamuna umleitete, war der einst so prachtvolle Strom zum Rinnsal geschrumpft, aufgefüllt nur noch durch den Regen und die Abwässer der Millionen, die an den Ufern des Flusses lebten. Das Wasser der Yamuna, von dem es hieß, es würde die Sünden abwaschen und das Karma verbessern, machte nun krank: Es transportierte eine katastrophale Fracht von Kolibakterien, die keine Kläranlage mehr eliminieren konnte. Schon seit Jahren wurde alles, was mit diesem Wasser in Berührung kam oder aus ihm bestand, beeinträchtigt, verdorben, unbrauchbar – die Salate, das Obst, das Trinkwasser - und alle Versprechungen der Regierung, endlich Abhilfe zu schaffen, waren nicht eingehalten worden.
Kurz vor Mathura brach der Verkehr unter dem Ansturm der Demonstranten endgültig zusammen. Es ging nur noch meterweise voran, der Busfahrer fluchte und hupte, ehe er resignierte, die Türen öffnete und die Fährgäste aufforderte, den Rest der Strecke bis zur Innenstadt zu Fuß zu gehen. Ich hatte nicht mehr als eine Reisetasche dabei, die ich bequem über der Schulter tragen konnte, und so machte es mir wenig aus, mich in die Menschenmenge einzureihen und ihr bis in die Innenstadt zu folgen. Links und rechts von mir gingen Jugendliche, die aussahen, als kämen sie geradewegs aus der Schule, zahlreiche Frauen waren unterwegs, grazil und entschlossen marschierten sie neben ihren Männern, kräftigen Kerlen mit Lederhaut und groben Knochen, die mit ihren unempfindlichen Sohlen über alle Unebenheiten der Straße hinwegschritten. Über der Menge, die sich wie eine zähflüssige Schlange aus Menschenleibern in die Innenstadt drängte, wehten die gelben Fahnen Krishnas, hin und wieder erklangen Gesänge, dann wurden Parolen rhythmisch skandiert, Trommel waren zu hören, Fäuste wurden geschwungen. Befand ich mich nun in einer Demonstration oder einer Prozession - oder ist das in Indien womöglich das Gleiche?
Anstatt die Umgehungsstraße zu benutzen, hatte der Großteil der Demonstranten den Weg mitten in die Altstadt von Mathura eingeschlagen, um vor dem Sri-Krishna-Janmaboouni-Tempel zu demonstrieren. Hatte nicht auch Lord Krishna in den altvorderen Zeiten die tyrannische Obrigkeit in Gestalt König Kamsas besiegt und die Stadt Mathura befreit? Vorher war er nach dem Glauben seiner Anhänger jedoch in einer Kerkerzelle geboren worden – jener Kerkerzelle, die als Sanktuarium heute das Herz des Sri-Krishna-Janamboouni-Tempel bildete. Deswegen wollte auch ich diesen Tempel besuchen, doch als ich die Massen erblickten, die sich in hoffnungsloser Verkeilung vor Treppe und Tempeleingang pulkten, drehte ich in eine der zahlreichen Seitengassen ab. Für den Tempel war später noch Zeit, nun stand mir erst einmal der Sinn nach einer vernünftigen Unterkunft.
Doch Mathura war kein typisches Travellerziel, und die Guesthäuser, von denen es in Agra und Delhi so reichlich gab, suchte man hier vergebens. Aber auch die normalen Hotels waren ausgebucht bis auf das letzte Bett, was mich nicht überraschte, als ich auf den Kalender blickte. Der indische Monat Phalguna war angebrochen, und übermorgen würde das gesamtindische Holifest beginnen, während dessen das ganze Land in eine temporäre Heiterkeitsraserei verfallen würde. Alle Familien, die es sich leisten konnten, begaben sich an diesen Tagen an einen prominenten Ort, um das Fest stilvoll zu begehen.
Beim Holifest handelt es um eines der zahlreichen Frühlingsfeste, die alljährlich in den unterschiedlichsten Formen in Indien begangen werden. Wo sich in Thailand die Menschen zum Frühjahresanfang gegenseitig mit Wasser begießen, wo in Rumänien die Jungen zur Osterzeit die Mädchen mit Parfüm einstäuben, bekleckern sich die Inder in den Tagen unmittelbar nach dem Vollmond des Monats Phalguna einige Tage lang mit möglichst knalligen Farben. Früher handelte es sich dabei um Pflanzenextrakte, heute wird vorwiegend synthetisch hergestelltes Farbpulver verwendet. Kennzeichnend für das indische Holifest ist der strikt kastenübergreifende und sogar religionsübergreifende Charakter des öffentlichen Treibens, das man sich als einen gesamtindischen Schabernack vorstellen muss, der vollkommen Fremde, aber auch Freunde und Bekannte mit einbezieht. Obwohl die oft überfallartigen Akte des Einfärbens etwas durchaus Offensives besitzen, läuft das Holifest meist friedlich ab – Touristen werden fast immer in Ruhe gelassen, und wenn sie partout darauf bestehen, an den heiteren Ausschreitungen teilzunehmen, nur sehr zurückhaltend eingepudert. Die religiöse Anbindung des Holifestes ist in den verschiedenen Teilen Indiens uneinheitlich - allgemein anerkannt allerdings ist eine Verbindung des Holifestes zu den Legenden über den jungen Krishna, der als einer der ersten auf den Wiesen des Braja Mandal im Umkreis von Mathura und Vrindaban seine Gefährten mit dergleichen Neckerei unterhalten haben soll. Deswegen waren die Unterkünfte in Mathura für dieses Wochenende schon seit langem ausgebucht.
In dieser Situation blieb nur noch ein letzter Ausweg, den man unter normalen Umständen tunlichst vermeiden sollte. Ich ging zu einem pfiffig dreinblickenden Rikschafahrer und fragte ihn: „Do you know a hotel?”, inständig hoffend, dass er neben der Intelligenz, die ihm aus den Augen blickte, auch ein Minimum an Mitgefühl für einen einsamen Reisenden würde aufbringen können und sein Angebot nicht gar so schrecklich wäre.
„Sure“, antwortete er in gebrochenem Englisch mit einem tückischen Blitzen in den Augen, das mir nicht entging. „Hotels in Mathura full, but I have a chance for you.”
Erwartungsgemäß führte die Rikschafahrt aus dem Zentrum Mathuras wieder heraus, weit weg von der Yamuna, deren Ghats ich doch eigentlich hatte besuchen wollen, in eine dicht bebaute Vorstadtgegend, in der sich die Häuser, die ich sah, in zwei Kategorien einteilen ließen – in die Häuser, welche noch nicht fertig waren und die, welche bereits dabei waren, zu verfallen. Vor einem Gebäude der zweiten Kategorie, einem großen Haus mit Hof, stoppte mein Guide, klopfte an einer massiven Holztüre und erklärte sein Anliegen einem Mann in mittleren Jahren, der mit einem langen weißen Gewand im Türrahmen erschienen war. Ich saß derweil in der Rikscha und musste mit ansehen, dass auf mich wie auf eine Jagdtrophäe immer aufs Neue gezeigt wurde. Offenbar verhandelten der Rikschafahrer und der Hausbesitzer über die Provision, und mutmaßten, wie viel man von mir würde abzapfen können. Als sie einig geworden waren, winkte mich der Hauseigentümer mürrisch herbei und öffnete ein Eisengatter zu einem Hof, in dem sich vier Räume befanden, die je ein Fenster zum Hof und ein Bett aufwiesen und von denen mir eines als Unterkunft angedient wurde. Das Bett bestand nichts weiter als aus einem Rost und einer dünnen Matratze neben der ein Bettlaken lag, das nur im Buchungsfall zum Einsatz kommen würde. Kissen, Handtücher oder Toilettenpapier waren natürlich nicht vorhanden. Der Boden war dreckig, die Wände bekritzelt, es befand sich noch nicht einmal ein Stuhl im Raum, von einem Tisch ganz zu schweigen. Eine einsame Birne hing an einem kümmerlichen Draht von der Decke, das Bad besaß keine Türe und bestand nur aus einem Loch im Boden und einem Loch in der Wand, aus dem bei Bedarf ein mickriges Wasserrinnsal träufelte. Immerhin besaß der Raum eine massive Holztüre mit einem gewaltigen Schloss - kräftig genug, all jene Schätze zu hüten, die in diesem Zimmer wohl niemals gelagert werden würden.
Auf der nach unten offenen Skala meiner katastrophalsten Unterkünfte besaß dieses Angebot sogar innerhalb eines asienweiten Rankings Seltenheitswert - aber das Zimmer schien ruhig zu sein, und am nächsten Morgen würde ich ohnehin so früh wie möglich verschwinden. Der Preis, der mir genannt wurde, war unverschämt, wurde aber, als ich mich zum Gehen wandte, halbiert. Nach der Entrichtung der Vorkasse erhielt ich den Schlüssel zu dem besagten monumentalen Schloss, mit dem ich meinen Raum und mein Gepäck sorgfältig zusperrte.
Mein jugendlicher Rikschafahrer, der mit der ihm angeborenen Dauerpfiffigkeit alle Stadien der Besichtigung und Buchung genau verfolgt hatte, fuhr mich zum Basarviertel zurück - nicht ohne vorher noch eine Ehrenrunde um den Busbahnhof zu drehen, als wolle er mich seinen Kumpels als einen Blöden vorführen, den er erfolgreich ausgenommen hatte.
In der Innenstadt war der Andrang der Demonstranten inzwischen etwas abgeklungen, und ich beschloss, den Sri Krishna-Janmabhoouni-Tempel zu besuchen. Das weiträumige und verschachtelte Gebäude war in seiner heutigen Gestalt ein Neubau, denn im Laufe der Jahrhunderte war der heilige Ort wie so viele Plätze in Indien immer wieder von den Moslems geschändet worden – natürlich auch vom Großmogul Aurangazeb, von dem es mir mittlerweile so vorkam, als hätte er den größten Teils seines langen Herrscherlebens damit verbracht, Hindutempel zu zerstören. Ihre eigene Moschee aber hatten die Moslems in Mathura gottlob nicht auf den Ruinen des Janmabhoouni-Tempels sondern daneben erbaut, sonst wäre womöglich in Mathura eine ähnlich brisante Situation entstanden wie in Ayodhya. Trotzdem war das Polizeiaufgebot beachtlich, ich musste alle meinen Taschen ausleeren, den Reisepass vorlegen und meine Fototasche an einer Gepäckaufbewahrung abgeben, ehe ich den Tempelinnenhof betreten durfte.
Innerhalb des Tempelbezirks fand sich hinter verschachtelten Zugängen, hinter Nischen und Treppen der Eingang zur vermeintlichen Kerkerzelle, in der Lord Krishna vor über fünftausend Jahren geboren worden sein soll. Das Gedränge war unbeschreiblich, immer neue Familien drängten sich mit robuster Ellbogenarbeit an mir vorüber, sodass ich nur einen kurzen Blick auf einen geschmückten Raum werfen konnte, dessen Leere wie ein Gefäß erschien, in das sich jedwede religiöse Fantasie ergießen konnte. Buddhisten hatten es gut, denn der Erleuchtete war auf den Wiesen von Lumbini an der frischen Luft geboren worden, da gab es keinerlei Gedränge.
Dass Krishna ausgerechnet in einer Kerkerzelle geboren worden sein soll, erklärt die Überlieferung durch die Angst des Tyrannen Kamsa, dem geweissagt worden war, dass das achte Kind seiner Schwester Devaki ihn dereinst töten würde, sodass er die bedauernswerte Devaki samt ihrem Gatten in den Kerker warf und alle Kinder, die sie gebar, kurzerhand töten ließ. Im Falle des kleinen Krishna aber soll dies misslungen sein, da anstelle des Babygottes den Häschern ein ordinäres Sklavenkind untergeschoben wurde, was sich aus heutiger Sicht allerdings etwas merkwürdig anhörte. Jedenfalls wurde der junge Krishna aus Mathura herausgeschmuggelt und in das benachbarte Vrindaban gebracht, wo er als vermeintlicher Hirte eine unbeschwerte Kindheit verlebt haben soll. Die Mordanschläge seines Onkels, der schließlich doch dahinter gekommen war, dass Krishna lebte, überstand der Götterknabe mit immer größerer Bravour, ehe er schließlich nach Mathura zurückkehrte, König Kamsa tötete und die Stadt befreite.
Nachdem ich den Tempel verlassen hatte, lief ich quer durch die Altstadt, vorbei an Garküchen und Märkten, passierte lange Menschenschlangen, in denen die Leute nach dem Segen von Gurus anstanden, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Ich besuchte Zelte, in denen vegetarische Gerichte an Bedürftige ausgegeben wurden, verlief mich zweimal und musste schließlich eine Fahrradrikscha mieten, die mich endlich an das Vishram Ghat an der Yamuna brachte.
Dafür, dass das Vishram-Ghat ein indienweit bekannter Pilgerplatz war, sahen die Treppen reichlich heruntergekommen aus. Die Affen zankten sich um herumliegende Essensreste, Unrat lag in den Ecken, und die kleinen Hunde erledigten ihr Geschäft ungeniert auf den Treppen. Winzige Plätze mit nischenartigen Ausblicken auf den Fluss, schräge Wände, verrostete Glocken, Tempelfragmente und Torbögen erhoben sich über den lang gezogenen Treppenstufen, die in die Yamuna führten. Gelbe Wände, rosa Kapitele, rote Stufen und Mauerschäden, die wie weiße Tupfer wirkten, verliehen dem Ort eine Anmutung bizarrer Fremdartigkeit, bei der man sich nicht gewundert hätte, wenn im nächsten Augenblick ein doppelköpfiges Monster aus dem Wasser empor gestiegen wäre. Doch doppelköpfige Monster tauchten an diesem Tag aus dem Wasser nicht auf, stattdessen marschierten ganz normale indische Männer und Frauen entweder mit einem Handtuch um die Hüften oder voll bekleidet in den Fluss hinein, tauchten ihre Köpfe in das Wasser und machten glückliche Gesichter.
Unter den Pilgern, die im ständigen Wechsel kamen, badeten und wieder gingen, war mir eine Familie aufgefallen, von denen sich nur Vater und Mutter entkleideten, während der erwachsene Sohn keinerlei Anstalten machte, sich auszuziehen. Auf eine einladende Geste des Vaters hin, schüttelte er nur den Kopf und setzte sich in die Sitznische neben mich, während seine Eltern in den Fluss stiegen. Der junge Mann hatte eine scharf geschnittene Nase, schräge, dunkle Augen und einen sehr hohen Haaransatz. Zuerst musterte er mich neugierig aus den Augenwinkeln, ehe er mir sein Namaste entbot. Schnell kamen wir ins Gespräch, sein Englisch war exzellent, und ich entnahm seinen Darlegungen, dass er Vikram hieß, ein Student aus Delhi war und dass er Ingenieur werden wolle. Zweimal im Jahr sei es seine Pflicht, seine Eltern in dem familieneigenen Auto zu Pilgerfahrten nach Mathura und Vrindaban zu chauffieren - einmal einige Tage während des Holifestes und im August zur Feier von Krishnas Geburtstag.
Und warum baden Sie nicht? wollte ich wissen.
Vikram zuckte mit den Schultern.
Ist Ihnen nicht warm genug? setzte ich nach.
Warm genug ist mir schon, erwiderte Vikram und blickte mich an. Aber ich hänge an meiner Gesundheit. Sie haben doch bestimmt schon davon gehört, wie verschmutzt die Yamuna ist.
Ja, gab ich zu. Ist es denn wirklich so schlimm?
Noch viel schlimmer, gab Vikram zurück. Was Sie hier sehen, ist nicht das Wasser der Yamuna, sondern es sind zum größten Teil Abwässer. Das frische Wasser aus den Bergen wird durch die Staudämme im Norden umgeleitet, es gelangen nur geringe Wassermengen nach Süden, die sich mit allem anreichern, was die Leute über Hunderte von Kilometern in den Fluss werfen.
Gibt es denn keine Kläranlagen?
Viel zu wenige. Und die meiste Zeit des Jahres arbeiten sie nicht. Es ist hoffnungslos.
Aber die Leute demonstrieren doch dagegen, wandte ich ein. Ich habe heute Morgen Demonstranten gen Delhi ziehen sehen.
Das wird folgenlos bleiben, gab Vikram zurück. Dafür werden die Politiker zu gut von den Wirtschaftsbossen geschmiert. Sogar hier in Mathura gibt es Farbfabriken und Zinkproduzenten, die ihren Dreck einfach in den Fluss leiten.
Wieder waren neue Pilgergruppen am Vishram Ghat eingetroffen. Sie waren dabei sich zu entkleiden, als Vikrams Eltern ihr Bad beendeten und die Stufen hoch kamen.
Wissen ihre Eltern, wie verschmutzt die Yamuna ist? fragte ich.
Natürlich wissen sie es, aber es spielt für sie keine Rolle. Sie glauben felsenfest daran, dass ihnen die Verunreinigungen der Yamuna nicht wirklich etwas anhaben können. Mein Vater sagt: Genauso wie die Yamuna den Pilgern, die in ihm baden, die Sünden abwäscht, so wird sie auch die Kraft besitzen, sich von allen Verunreinigungen zu befreien.
Wir schwiegen und blickten auf den Fluss. Im Licht der Nachmittagssonne wirkte das Wasser samtig und einladend, ich roch auch nichts, aber Schwermetallbestände waren geruchslos. Vikrams Eltern hatten sich inzwischen abgetrocknet und die Kleidung gewechselt. Nun winkten sie ihren Sohn heran und nickten mir zugleich freundlich zu.
Vikram erhob sich. Ich muss weiter. Ihnen noch eine gute Reise – und tun sie sich einen Gefallen: Baden sie lieber nicht in diesem Fluss.
Ich blieb noch eine Stunde in meiner Nische sitzen und beobachtete den abendlichen Badebetrieb. Die Kunde von der Verunreinigung der Yamuna tat ihrer Attraktion als Badestätte keinen Abbruch. Der Augenschein war friedlich und einladend, aber wie heißt es sinngemäß in der Bhagavad-Gita: Zum Wesen des Unheils gehört, dass es sich verbirgt.
Als ich schon bei Anbruch der Dunkelheit meine Unterkunft in der Vorstadt erreichte, kam der Hauseigentümer herunter und teilte mir mit, dass der Strom im ganzen Viertel abgestellt worden sei. Da könne man nichts machen. Gute Nacht.
In meinem Zimmer setzte ich meine Stirnlampe auf, verriegelte sorgfältig die schwere Türe von innen und überprüfte den Verschluss der Fenster zu Hof und Bad. Das Wasser, das aus der Dusche kam, war nicht der Rede wert, dafür sprühte ich mich reichlich mit Antimückenspray ein. Anschließend breitete ich das Bettlaken über die Matratze, legte meinen Schlafsack darauf, warf die Ohrstopfen ein und versuchte so gut es ging, zu schlafen. So ruhig, wie es den Anschein gehabt hatte, war das Zimmer allerdings nicht, denn ich im Laufe der Nacht waren immer wieder Schritte und Stimmen auf dem Hof zu hören. Irgendetwas lief da ab, von dem ich gar nicht wissen wollte, was es war. Schließlich schlief ich ein, und zwischen Wachen und Träumen kam es mir so vor, als würde im Dunkel der Nacht der eine oder andere der schrägen Vögel durch die Fensterscheibe auf mein Lager schauen, um abzuschätzen, welch fette Beute da möglicherweise noch zu erlegen war.
Am nächsten Morgen war ich unausgeraubt, aber von Mücken zerstochen. Als ich den einzigen Schalter im Zimmer betätigte, zeigte sich keinerlei Reaktion, und mir wurde endlich klar, dass dieses Zimmer überhaupt keinen Stromanschluss besaß. Dafür sah es im trüben Morgenlicht womöglich noch schlimmer aus als gestern - plötzlich kam mir der Raum wie eine Kerkerzelle vor, wozu auch die mächtige Türe passte, die eindeutig neu war und die sich vom Rest der Einrichtung deutlich unterschied. Die meisten Kritzeleien an den Wänden waren in Hindi verfasst, es befanden sich aber auch einige Inschriften in Englisch an den Wänden. „Das ist die schlechteste Unterkunft, seitdem ich in Bangkok im Knast gesessen habe“, hatte einer geschrieben – ein anderer hatte gleich darunter vermerkt: „Warum bist du denn nicht dort geblieben?“ Ich stand auf, wusch mich mithilfe eines Eimers voll kalten Wassers, der auf dem Hof neben einem Brunnen stand, packte meine Sachen und nahm an der Hauptstraße eine Rikscha nach Vrindaban.
Vrindaban befand sich nur etwa zehn Kilometer nördlich von Mathura und lag ebenfalls direkt an der Yamuna. Mehr als die meisten anderen Städte Indiens handelte es sich um eine Tempelstadt mit Verehrungsstätten in jedweder Erscheinungsform: monumentale südindische Gopurams, modernistische Neubauten in grellen Farben, aber auch zahlreiche kleinere Verehrungsstätten, in denen immer nur zum gleichen Gott gebetet wurde: zu Krishna, dem Erlöser der Welt.
Die Gesamtheit der Krishna Überlieferung entstammt dem Mahabharatha und gehört wie das Ramayana zum Kernbestand der indischen Kultur. Der Legende nach wurde das Mahabaratha in Urzeiten vom Elefantengott Ganesha höchstselbst dem indischen Gelehrten Vyasa in die Feder diktiert. Wissenschaftler halten dagegen das Mahabaratha für eine Textsammlung aus den unterschiedlichsten Epochen, deren Ursprünge zwar bis in die altvedische Ära zurück reichen, die aber erst kurz nach der Zeitenwende abgeschlossen wurde. Obwohl sich das Werk in Hunderte von Nebenhandlungen mit Tausenden von Personen verzweigt, dreht sich die Haupthandlung um den Konflikt zweier altindischer Königsgeschlechter, der Kauravas und der Pandavas, die sich nach einer komplizierten und schier endlosen Auseinandersetzung schließlich in der Ebene von Delhi zur großen Entscheidungsschlacht von Kurushkreta treffen. Gläubige Hindus sind übrigens felsenfest davon überzeugt, dass das Mahabaratha geschichtliche Ereignisse berichtet, die sie sogar relativ exakt auf das 32. Jahrhundert vor der Zeitrechnung datieren.
Innerhalb der Haupthandlung des Mahabaratha tritt Krishna in zwei Formen auf. Einmal ist er der Prinz, der den Mordanschlägen seines Onkels Kamsa entgeht und im Verborgenen heranwächst, ehe er am Ende über den Tyrannen triumphiert. In diesem Erzählstrang gleicht Krishna einer Mischung aus Jesus, Herkules und Adonis mit zahlreichen menschlichen und liebenswerten Zügen. Dann erscheint Krishna in einem ganz anderen Kontext in der Entscheidungsschlacht von Kurushkreta als der Wagenlenker des Pandava-Helden Arjuna und verkündet diesem vor dem Beginn der großen Schlacht die Lehren der Bhagavad-Gita. Hier streift Krishna alles Menschliche ab und verwandelt sich in den wiedergeborenen Gott, der sich selbst und seine Lehre offenbart. Im Rahmen des Mahabaratha, das etwa 100.000 Strophen umfasst, nimmt die Verkündigung der Bhagavad-Gita zwar nur 700 Strophen ein, und doch gilt sie als die ethische und theologische Quintessenz des gesamten altindischen Denkens. Tod und Wiedergeburt, Vergeltung und Rechtschaffenheit, Karma und Dharma – das gesamte Räderwerk des Universums, das in den Grundzügen später auch von Buddhismus und Jainismus übernommen wurde, wird von Krishna in Gestalt eines großen Gedichtes in 18 Gesängen enthüllt – einschließlich einer düsteren Bestandsaufnahme des eigenen Zeitalters. Denn wie Krishna verkündete, war die Welt von Kurushkreta dabei, in das Kaliyuga, in eine Epoche des Hasses und der Zwietracht einzutreten, in der den Menschen die Verbindung zum Göttlichen entgleitet. Die Szene, in der Krishna auf einem Streitwagen dem Pandava-Helden Arjuna diese Lehre darlegt, gehört deswegen zu den am meisten dargestellten (und am meisten missverstandenen) Motiven der indischen Kunst.
In Vrindaban fand ich schon am Vormittag ohne Schwierigkeiten eine Unterkunft. Ich wohnte in einem von außen etwas verfallenen Gebäude in einer schmalen Gasse, die über zwei Ecken zu den Ghats an der Yamuna führte. Die Zimmer glichen mehr Nischen mit Türen als Räumen, doch die Betten waren sauber, und sogar das Licht funktionierte. Ich besaß sogar ein winziges Fenster, das sich öffnen ließ und durch das ich, wenn ich es schaffte meinen Kopf hindurch zu stecken, auf das Gassengewirr herunterblicken konnte. Unter den Gästen der Herberge befanden sich junge Briten, die sich darüber zu wundern schienen, dass es in diesem Guesthouse kein Bier zu kaufen gab, Frauen im mittleren Alter mit einem ostentativen Desinteresse an allem Männlichen, ältere Reisende im perfekten Outdoor-Dress, die mit Büchern im Essraum saßen, dazu einige Sanyasins, die in ihren rosafarbenen Gewändern entweder hinter ihren Türen ihre Meditationsperlen zählten oder sich in einem der Ashrams aufhielten.
Nicht weit von meiner Unterkunft befand sich das Keshi-Ghat von Vrindaban, eine lang gezogene Tempelfront, an deren Basis mehrere Treppen zur Yamuna führten. Das Gebäude besaß eine hellbraune Farbe, schattige Arkaden und Sitzecken, Fensterverzierungen und vier kleine Podeste, die die einzelnen Ghats voneinander trennten. Ich sah einen schlanken Mann im Schatten sitzen und lesen, seine Haare waren voll, aber schon ergraut, und sein kantiges Gesicht wirkte mit seinen hohen Wangenknochen und den tief liegenden Augen wie das Antlitz eines gealterten Krishnas. Neben ihm saß ein abgemagerter Pilger, Bart und Haare waren verfilzt, die Kleidung hing ihm in Fetzen vom Leib, und seine Arme und Beine glichen eher schwarzen Stöcken als menschlichen Gliedern. Auf einem der Ghats, eingezwängt zwischen zwei Podesten, hatte sich ein Yogi ausgebreitet, vor ihm lagen Girlanden und Bilder, über die er segnend mit seinen Handflächen fuhr, während eine Gruppe älterer Frauen ihn mit zusammengelegten Handflächen adorierte, als rette er in diesem Augenblick die Welt.
Träge floss die Yamuna an diesen Gestalten vorüber. Blumengeschmückten Boote fuhren von Ufer zu Ufer, und die Morgensonne illuminierte die weiten Felder auf der anderen Seite des Flusses, das Braja Mandal, jene Landschaft, in der Gott Krishna seine Jugend verlebt haben soll. Ein großer Teil der Anziehungskraft, die Krishna weit mehr als die anderen Götter des indischen Pantheons ausübte, mochte mit diesen Jugendgeschichten zu tun haben, in denen der kleine Krishna die Milch stibitzte, den Hirtenmädchen die Kleider versteckte oder mit seinen Freunden irgendwelchen Unsinn trieb. Dass in regelmäßigen Abständen eine Schlange, ein Pferdedämon oder irgendein anderes Monster auftauchten, um erfolglos zu versuchen, den kleinen Krishna zu ermorden, waren nur Zutaten für die immer wieder erzählte Geschichte einer Jugend, mit der Millionen Indern aufwuchsen.
Aber nicht nur die Inder können sich in Krishna wiedererkennen - seine Gestalt besitzt als einzige indische Göttergestalt sogar eine über Indien hinausgreifende Attraktion. Vrindaban war deswegen nicht eines der Hauptzentren der indischen Krishna-Verehrung - die Stadt beherbergte außerdem den Hauptsitz einer Missionsbewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Krishna Religion über die ganze Menschheit zu verbreiten.
Sowohl die innerindische Krishna-Verehrung wie die indenübergreifende Krishna-Mission besaßen ihren Ursprung in der Gestalt eines im Westen fast unbekannten religiösen Reformators: Chaitanya Mahaparbhu (1486-1533), der in einer Epoche wirkte, in der ganz Indien durch einen überall triumphierenden Islam tief greifend erschüttert wurde. So barbarisch die Eroberer den Indern jener Zeiten auch erscheinen mochten - vor der Religion der Eindringlinge und ihrem strengen Monotheismus sanken alle Hindureiche in den Staub. Millionen Hindus – vorwiegend, aber nicht nur die Angehörigen der unteren Klassen - konvertierten zur egalitären Religion Allahs, und oft waren die Konvertiten die Eifrigsten, wenn es darum ging, Hindutempel zu zerstören, um Moscheen darauf zu errichten. In dieser Situation propagierte Chaitanya Mahaprabu zu Beginn des 16. Jahrhunderts einen erneuerten Hinduismus mit der zentralen Figur Lord Gestalt Krishnas, der nunmehr als persönlicher Schöpfergott aufgefasst wurde und dem gegenüber alle Unterschiede der Kaste, des Standes, der Rasse oder der Religion aufgehoben sein sollten. Die uralten Krishna-legenden, denen konkrete Orte niemals wirklich hatten zugeordnet werden können, wurden nun erst auf kanonische Weise lokalisiert: Eine neue Exegese der alten Schriften identifizierte - mit welcher Berechtigung auch immer - Mathura und Vrindaban als die Schauplätze seines Götterlebens, so dass der bisher frei über Nordindien diffundierende Mythos eine konkrete Örtlichkeit erhielt, was nichts weiter bedeutete, als dass er zum Ziel von Wallfahrten und zum Anlass von Tempelbauten werden konnte. Chaitanya Mahaprabu war es auch, der die Kaliyuga-Lehre neu interpretierte. Es mochte wohl sein, dass die Kaliyuga-Ära mit Krishnas Tod im Jahre 3102 vor der Zeitrechnung begonnen hatte - dass aber in dieser Epoche der Kontakt zum Göttlichen ganz verloren gegangen sei, war für Chaitanya Mahaprabu nur bedingt richtig. Seine frohe Botschaft war vielmehr, dass es durch das Skandieren der heiligen Mantren und das Singen der Hare-Krishna-Chanten auch in der Nacht des Kaliyuga möglich sei, Anteil am Göttlichen zu gewinnen. Wo die Moslems ihre Religion im Heiligen Krieg mit Feuer und Schwert verbreiteten, wo sich die Buddhisten religiös verwirklichten, in dem sie der Welt entsagten, knüpften die Krishna-Anhänger nunmehr ein neues Band zur Gottheit durch das Singen heiliger Chanten.
Diese gesamtindische Erneuerungsbewegung, die Mathura und Vrindaban in den Rang von Krishna-Städten erhob und die Krishna-Verehrung im ganzen Land intensivierte, muss aber unterschieden werden von dem, was im Westen als „Hare Krishna-Bewegung“ bekannt geworden ist, einer straff geleiteten Missionsbewegung, die eine bestimmte Variante der Krishna-Religiosität in der ganzen Welt verbreitet. Sie selbst bezeichnet sich als „International Society for Krishna Consciousness“ (ISKCon) und beansprucht, als eine neuartige monotheistische Religion, die Lücke auszufüllen, die durch den Zusammenbruch des Christentums und den Sieg des promiskuitiven Liberalismus im Westen aufgetreten ist. Ihr Schöpfer war der Bengale Swami Prabhupada (1896-1977), der sich als geistlicher Führer erst im Alter von 69 Jahren von Indien aus nach Amerika aufmachte, um dort mit minimalen Mitteln die Hare Krishna-Bewegung aufzubauen. Bekanntermaßen fand diese Lehre innerhalb der orientierungslosen westlichen Gesellschaften tatsächlich eine sehr positive Resonanz. Die Hare-Krishna-Chanten schafften es bald bis in Popsongs und Rockopern und bildeten in zahllosen westlichen Ashrams die Grundlage einer strengen vegetarischen Lebensführung, die viele Aussteiger nach der Beliebigkeit der Hippiekultur enthusiastisch begrüßten. In über 100 Ländern ist die Hare-Krishna-Gesellschaft heute aktiv, und der Krishna-Balaram-Tempel von Vrindaban ist ihr weltweites Zentrum.
Dieser Tempel befand sich am westlichen Ortsende von Vrindaban, und er trug seinen Namen nach Krishnas mythischem Bruder Balaram, der hier neben Krishna besondere Verehrung erfuhr. Als ich den Tempel am frühen Nachmittag erreichte, wurde ich sofort als Ausländer erkannt und von einem englisch sprechenden Hare-Krishna-Jünger freundlich begrüßt. Er überreichte mir einige Informationsschriften, erklärte mir, wie ich zu den Sehenswürdigkeiten des Tempels käme und wies mich besonders auf ein Museum hin, das auf dem rückwärtigen Teil des Geländes ausführlich über das Leben von Swami Prabhupada informierte.
Schon auf den ersten Blick war zu erkennen, dass es sich bei dem Krishna-Balaram-Tempel um keinen typisch indischen Verehrungsort handelte. Obwohl er mit seinen Marmorböden, seiner Marmortreppe und den ziselierten Marmorfassaden auf den ersten Blick an einen Jainatempel erinnerte, war er so sauber und blank geputzt, wie ich es in Indien noch niemals gesehen hatte. Auch die Quote nichtindischer Besucher war im Krishna-Balaram-Tempel höher als anderswo - ich schätzte, dass fast ein Viertel der Besucher Nichtinder waren, die man aber als bloße Touristen falsch gekennzeichnet hätte, weil sie wahrscheinlich dauerhaft in Vrindaban lebten. Am Eingang der Haupthalle erwartete den Besucher eine mit Blumen und Devotionalien reich geschmückte Skulpturengruppe, die die Hauptakteure der Hare Krishna-Religiosität in einem einzigen Werk präsentierte - in der Mitte Krishna mit dem charakteristisch dunklen Gesicht, daneben sein Bruder Balaram und natürlich Radha, Krishnas Geliebte und Gefährtin. In der für den westlichen Menschen befremdlichen Nähe zur Gottheit war dieser üppig ausstaffierten Göttergruppe ein menschlicher Appendix am unteren Rand beigeordnet: Rechts befand sich eine kleine Skulptur des Reformators Chaitanya Mahaprabus, der hier als Heiland des Ostens und als wiedergeborener Krishna verehrt wurde, und auf der andere Seite war die Gestalt Swami Prabhupadas zu erkennen.
Ich schlenderte eine Zeitlang durch die Räumlichkeiten des Tempels und musterte die Details der blitzblanken Statuen, die in allen Räumen als Altäre und Verehrungsorte ausgestellt waren. Sie erschienen so blitzblank und sauber, so ganz und gar patinalos und antiseptisch, dass mir darunter fast ihr religiöser Anmutungsgehalt zu leiden schien. Radha mit ihrer Porzellanhaut und ihrer lockeren Art, Krishna die Hand auf die Schulter zu legen, wirkte wie eine religiöse Barbiepuppe, womit ich weder etwas gegen Barbiepuppen, noch etwas gegen die Krishna-Religion gesagt haben sondern nur die Grenzen aufzeigen möchte, die einem westlichen Betrachter beim Verständnis östlicher Ästhetik gezogen sind. Krishna, von den in den klassischen Texten immer als „dem Blauen“ die Rede ist, war rabenschwarz, ein regelrechter Mohr, der auf der Flöte blies, auf einem Bein stand oder fesch seinen Helm trug – er glich mehr einer Kirmesfigur als jenem Gott, der ja immerhin nicht nur einer unter 300 Millionen des indischen Pantheons war, sondern der hier als der Einzige und Entscheidende, als der alles Umfassende in Szene gesetzt werden sollte. So kritisch ich den Islam und viele seiner Verhaltensvorschriften gegenüber Andersgläubigen betrachtete, so sehr bewunderte ich in diesem Augenblick die Weisheit seines Bilderverbotes und fragte mich, ob der Verzicht auf die Darstellung des Undarstellbaren nicht besser war als eine hemmungslose Ausdrucksfreude, die bei all ihrer Kunstfertigkeit nicht immer die Grenzen zum Kitsch beachtete.
Mit mir selber uneinig, verließ ich den Krishna-Balaram-Tempel, wobei ich von dem gleichen jungen Mann, der mich begrüßt hatte, freundlich wieder verabschiedet wurde. Ich erhielt zwei Einladungen zu Darshans, die in den nächsten Tagen stattfinden würden und einige Adressen, bei denen ich mich intensiver über die Hare-Krishna-Bewegung informieren konnte.
Am Keshi Ghat war der Anblick des Flusses am späten Nachmittag womöglich noch berückender als am Morgen. Alle Farben besaßen mehr Tiefe, die Konturen traten stärker hervor, die Luft war milder, der gesamte Anblick kam mit hundertmal authentischer vor als die grellen Figuren des Krishna Balaram-Tempels, wenngleich die Schönheit des Flusses etwas Unwahrhaftiges hatte, denn sie täuschte über seine Vergiftung hinweg.
Ich setzte mich wieder auf das Dach einer der Podeste am Keshi Ghat und kam neben einen sehr schlanken jungen Mann im gelben Sanyasingewand zu sitzen. Erst als ich neben ihm saß, erkannte ich, dass er kein Inder sondern ein Europäer sein musste. Er hatte sehr kurz geschorenes Haar, helle Haut und ein glattes Gesicht mit großen runden Augen, die mich freundlich ansahen, als er mich mit einem Kopfnicken grüßte.
Einige Minuten saßen wir wortlos nebeneinander und blickten über den Fluss. Die gesamte Landschaft war flach, jenseits der Yamuna erstreckte sich das Gopiland, eine weite durchgrünte Ebene mit Feldern, Weiden und kleinen Wäldern - durch den unerschütterlichen Glauben daran geadelt, dass hier in uralten Zeiten ein junger Gott über diese Erde gelaufen sei.
Schließlich kamen wir ins Gespräch und stellten uns vor. Der Name meines Gesprächspartners war Matic, er stammte aus Slowenien und befand sich seit zwei Jahren auf Pilgerreise in Indien. Er sagte es ohne Prätention, als handelte es sich um das Natürlichste von der Welt und sprach mit einem so runden und warmen Timbre, als sei die Wahrhaftigkeit ein Bestandteil seiner Stimme. Immer wenn ich solche Menschen treffe, die wirklich losgelöst von den Wurzeln ihrer Herkunft eine Reise ins Unbekannte antreten, ohne zu wissen, wohin sie diese Reise führen wird, verfalle ich in eine kuriose Ehrfurcht und schäme mich zugleich der engen Grenzen, die meiner eigenen Welt gezogen sind. An den Quellen des Ganges hatte ich Karol getroffen, einen Polen, der zum ewigen Leid seiner Eltern vom Katholizismus zum Hinduismus konvertiert war und den Rest seiner Tage im Hochgebirge meditieren wollte. Mit einer alterslosen Französin hatte ich zwei Tage in Rischikesch verbracht und vergeblich zu verstehen versucht, warum sie den Rest ihres Lebens dem Bakti-Yoga weihen wollte. So unterschiedlich die Menschen auch waren, die ich auf diese Weise getroffen hatte – Indien hatte für sie eine derartige Kraft entwickelt, dass sie sich unter vollem existenziellen Risiko dazu entschlossen hatten, in der Spiritualität des Subkontinentes eine neue Heimat zu suchen.
Darf ich fragen, wohin deine Pilgerreise führt? fragte ich.
Es ist eigentlich keine richtige Pilgerreise, gab Matic zu. Ich habe mir vorgenommen, die Yamuna abzugehen. Ich habe in den Bergen bei Yamunotri begonnen, ich habe die nördliche Ebene durchwandert und möchte bis zur Sanga von Allahabad pilgern, wo sich die Yamuna mit der Mutter Ganga vereinigt.
Und warum wanderst du ausgerechnet die Yamuna entlang?
Chaitanya Mahaprabu, der wiedergeborene Krishna, hat die Yamuna geliebt, sagte Matic.
Er hat den Fluss gepriesen als Quelle für Vergebung und Zuversicht. Jeder, der die Tugend sucht, ist an ihren Ufern willkommen. Matic hatte den Namen Chaitanyas Mahaprabus mit höchster Ehrfurcht ausgesprochen und den Kopf gesenkt.
Aber es geht dem Fluss nicht gut, wandte ich ein. Er soll schrecklich verunreinigt sein.
Das stimmt, antwortete Matic nach einer kurzen Pause. Kaliyuga befleckt alles. Alles wird in Mitleidenschaft gezogen, alles wird vergiftet. Selbst die Yamuna leidet.
Ich schwieg. Die Sonne war noch tiefer gesunken, und das Wasser erstrahlte in einem trügerischen Glanz.
Ich habe in Harikundh gesehen, wie das frische Wasser der Yamuna nach Westen umgeleitet wurde, fuhr Matic fort. Ich habe das fast leere Flussbett gesehen, aus dem die Raffgierigen nicht davor zurückschreckten, dem Fluss selbst noch seinen sandigen Untergrund zu rauben. Und ich habe die Zuflüsse gesehen, die Abwässer und den Müll, die in Delhi in das Flussbett gelangten. Ich habe vor Freude geweint, als der Monsun hereinbrach und den Fluss wieder mit frischem Wasser füllte. Ich habe vor Zorn geweint, als ich an den Kläranlagen vorbeikam und sah, dass sie nicht in Betrieb waren. Nun bin ich in Vrindaban, um Krishna zu bitten, die Yamnua zu retten.
Wie soll das geschehen?
Krishna hat dereinst die Schlange Kalyia getötet, er hat die Welt von ihrem Gift gereinigt, und er wird auch die Yamuna von den Giften, die sie verpesten, erlösen.
Ohne Kläranlagen?
Matic drehte den Kopf und blickte mich an. Natürlich benötigt man dazu auch Kläranlagen, natürlich darf auch im Norden nicht mehr so viel Wasser umgeleitet werden. Aber Chaitanyia Mahaprabu, der wiedergeborene Krishna, sagt: Das gemeinsame Chanten des heiligen Namens Sri Krishnas reinigt unser Herz, es heilt die Geschwüre der Welt. Und darum frage ich: Warum sollte das Chanten des heiligen Krishna-Namens nicht auch in der Lage sein, die Yamuna zu retten?