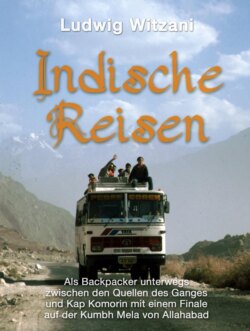Читать книгу Indische Reisen - Ludwig Witzani - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVII Die Stadt auf den Ruinen der Städte
Streifzüge durch Alt-Delhi
Die Hölle der Hühner befand sich noch immer in einer der Seitenstraßen des Chitli Basars von Alt-Delhi. Schon an meinem ersten Tag in Indien, als die Fremdartigkeit dieses Landes über mich zusammengeschlagen war wie eine Heimsuchung, hatte mich das mit der bloßen Hand vollzogene Massaker an dem wehrlosen Federvieh geschockt. Nichts hatte sich seitdem verändert – noch immer dampften die herausgerissenen Eingeweide in den Rinnsteinen, und aus den Hügel voller Knochenreste ragten die gelben Füße der Hühner zu Hunderten wie kleine Arme mit drei Fingern heraus.
Aber inzwischen hatte ich auch das Paradies der Hühner gefunden. Es befand sich ganz in der Nähe des Chitli Basars in einem Anbau des Digambara-Jainatempels Lal Mandir an der großen Basarstraße Chandni Chowk. Ein bemitleidenswert dreinschauendes Huhn mit einer großen Wunde über seinen Augen, dem ein Jaina-Tierarzt behutsam eine Salbe über die verletzte Stelle schmierte, war das erste, das ich sah, als ich den Tempel betrat. Ganz still hielt das Tier, als wüsste es, dass dieser Mensch ihm nichts Böses wollte. Im Nebenkäfig schien ein anderes Huhn seine Rekonvaleszenz bereits beendet zu haben - munter und hektisch wie Hühner nun einmal sind, lief es in seinem Käfig auf und ab, pickte die Körner vom Boden und begleitete meinen Besuch mit einem ununterbrochenen Gegacker.
Ich besuchte einen in seiner Art wohl einzigartigen Ort in der Welt: ein Hospital für Vögel, mit medizinischer Versorgung für kranke Tauben, Spatzen, Hühner, Finken, Krähen, mit Behandlungsräumlichkeiten, Visite und Ventilatoren und einer liebevollen Betreuung durch das Krankenhauspersonal. Eingeteilt nach Arten und Schwere der Erkrankung waren die Patienten in zwei Klassen aufgeteilt: die meisten Tauben logierten in Gruppenkäfigen, nur die schwereren Fällen waren in "Einzelkabinen" untergebracht. An der hintersten Wand im zweiten Stock traf ich auf die hoffnungslosen Fälle, die im Vogelhospital nur noch das gnädige Korn des Sterbens zu sich nahmen: todkranke Tauben mit von Geschwüren grotesk vergrößerten Köpfen, virusinfizierte Hühner, die bereits wie lebende Kadaver in ihren Käfigen lagen und die zu schwach waren, ein wenig Wasser aus den Schälchen zu trinken. Als ich das Vogelhospital verließ, begegnete mir ein zerlumptes Kind, das eine Taube mit gebrochenen Flügeln einliefern wollte. Auch das war Indien.
Ich war aus der Gangesebene nach Delhi zurückgekehrt und hatte bis zum Heimflug noch einige Tage Zeit. Nicht, dass Delhi eine Stadt war, in der es sich besonders entspannt die Zeit verbringen ließe, aber irgendetwas gab es hier immer zu sehen, was beim letzten Mal noch nicht da gewesen war. Diesmal war es der Connaught Place zwischen Alt- und Neu-Delhi, an dem schon seit Jahren gearbeitet wurde und dessen Fertigstellung kurz bevorstand. Auch der Bau der Metro ging voran, wenngleich mich der Bau einer Brücke über die städtischen Bahngleise mehr begeisterte. Endlich gehörten die fürchterlichen Staus auf dem Weg vom Connaught Place nach Paharganj der Vergangenheit an.
Immer wieder neu war auch die Preisgestaltung der Eintrittstickets, die man für den Besuch der Sehenswürdigkeiten Delhis erwerben musste – nur die Richtung war immer die gleiche: nach oben! An meinem ersten Tag in Delhi war der Eintritt zur Djama Masjid noch frei gewesen, so frei wie in fast jeder Moschee in der Welt. Die Abstauber, mit denen ich mich damals hatte herumschlagen müssen, waren mir noch in lebhafter Erinnerung. Nun musste ich für den Eintritt in die Moschee als Ausländer dreihundert Rupien zahlen, doch die Abstauber waren noch immer da. Weil es inzwischen möglich war, für einen Aufpreis eines der beiden Minarette der Freitagsmoschee zu ersteigen, hatten die Bettler in kluger Standortwahl alle Zugänge zu diesem Minarett flächendeckend blockiert. Niemand konnte den Eingang der Minarette erreichen, ohne über die auf dem Boden liegenden Bettler zu staksen, die den Besuchern ihr Leid in Kniehöhe entgegenjammerten
Der Aussichtspunkt des Minaretts befand sich in vierzig Metern Höhe auf einer schmalen Empore mit beängstigend niedriger Brüstung. Tief unter mir erstreckte sich der Innenhof der großen Freitagsmoschee, in dem 25.000 Menschen ihren Platz zum Gebet finden konnten. Dahinter war im morgendlichen Dunst das Rote Fort zu sehen, begrenzt durch die trägen Fluten der Yamuna, die weiter südlich in den Ganges mündete - und im Norden der Moschee befand sich das verbaute und übervölkerte Altstadtviertel mit der großen Basarstraße Chandni Chowk.
Natürlich war Alt-Delhi, so wie ich es jetzt sah, nicht mehr als ein winziger Mosaikstein von Groß-Delhi, einer Stadt, die auf den Ruinen von mindestens sieben weiteren Städten erbaut worden war. Die älteste dieser versunkenen Metropolen befand sich als Ruinenfeld von Lalkot weit im Süden der heutigen Stadt. In den Mauern Lalkots hatten die muslimischen Eroberer am Ende des 12. Jahrhunderts ihren epochalen Sieg über die Maharajas gefeiert und zum Andenken an ihren Sieg das Qutb Minar, das höchste Minarett Indiens, errichtetet. Es folgten Siri, Tughluqabad, dessen Schrecken der mohammedanische Weltreisende Ibn Battuta in seinen Reiseberichten aus dem 14. Jahrhundert beschrieben hatte, sodann Jahanpanah, Kotla und schließlich Purana Quila, in dessen Palästen der Großmogul Humayun im Jahre 1556 von der Brüstung seiner Bibliothek die Treppe herunter fiel und starb.
Nach diesen sechs Städten wurde im 17. Jahrhundert Shahjahanabad erbaut, Delhis siebte Kapitale, die der Mogulkaiser Shahjahan gleichsam aus dem Boden stampfen ließ. Alles, was ich heute von der Spitze des Minaretts aus sehen konnte, war in seiner Ägide errichtet worden: das Rote Fort, die Freitagsmoschee, die damalige Prachtstraße Chandni Chowk und nicht zuletzt eine neun Kilometer lange Stadtmauer. Nie vorher und nie nachher war in Indien derart aufwendig gebaut worden wie unter der Regentschaft Shahjahans, und da zur gleichen Zeit auch das Taj Mahal in Agra entstand, ganz zu schweigen von den Prachtbauten in Lahore, der dritten Kaiserstadt, war der Mogulstaat angesichts dieser Kosten an den Rand des Staatsbankrotts geraten.
Heute ist Delhis siebte Stadt Shahjahanabad nur noch ein demografisches Mosaik inmitten einer der größten Städte Asiens. Längst hatten die Betonstraßen, Wohnsilos, Armensiedlungen oder wo auch immer die Einwohner Delhis leben mochten, alle sieben historischen Städte miteinander verbunden. Niemand wusste genau, ob elf, dreizehn oder fünfzehn Millionen Menschen den Ballungsraum Groß-Delhis bewohnten - die dichteste Bevölkerungskonzentration dieser Megapolis aber pulsierte noch immer in Alt-Delhi.
Alt-Delhi Bahnhof nördlich der Chandni Chowk glich einer Katakombe des Lebens - riesig, unübersichtlich und zweckentfremdet. Er war nicht nur ein Umschlagplatz für Millionen Reisende, die Heimat Hunderttausender von Ratten, sondern auch ein Ort des Überlebens für die Ärmsten der Armen, ein leidlich trockener Lagerplatz während des Monsuns, ein windgeschützter Winkel in der kalten Jahreszeit, aber immer auch so überfüllt, dass Hunderte Familien unter dünnen Decken und Zellophanplanen vor den Eingängen und den Hallen des Bahnhofs schlafen mussten. Nach Einbruch der Dunkelheit stimulierte der Anblick des Bahnhofsbezirkes ohne jede Straßenbeleuchtung die bedrückende Vision vom Ende des städtischen Lebens nach dem Verschwinden der Elektrizität und der Wiederkehr des Lagerfeuers in der Millionenstadt.
Die Basarstraße Chandni Chowk war fast über ihre ganze Länge durch einen meterhohen Eisenzaun in zwei Fahrbahnhälften geteilt, damit der kaum noch entwirrbare Strom von Fahrrad- und Motorrikschas, Kamelen, Kühen, Autos und Fußgängern wenigstens die Richtung beibehielt. Die Fußgänger, die auf beiden Seiten der Straßen dieser Richtung folgten, liefen durch überfüllte Basar-Arkaden, in deren Auslagen sich Tradition und Moderne mischten: kostbare Seidensaris und Massentextilien waren ebenso zu finden wie handgearbeiteter Silberschmuck und Glasketten, Gewürze und Konserven, religiöse Devotionalien und Plastikeimer - viele davon paradoxerweise aus China importiert.
Äußerlich fraglos das schönste Gotteshaus auf der Chandni Chowk war die Sonehri Masjid, die "Goldene Moschee", deren zwiebelartige Kuppeln am Ende des 18. Jahrhunderts auf einem noch älteren Bau errichtet worden waren. Jeder, der von der chaotischen Straße in die Stille der Gebetsräume trat, spürte, dass die Moschee in Indien ein gesegneter Platz war, und sei es auch nur als Membrane der Lautlosigkeit innerhalb eines kakofonischen Normalzustandes. Im Unterschied zur großen Freitagsmoschee herrschte eine Stimmung weltentrückter Andacht: Männer in Straßenkleidung saßen in den Ecken und blätterten im Koran, manche lagen lang ausgestreckt auf dicken Teppichen und schliefen. Man hat den Islam als die Religion des Stolzes bezeichnet, was den Sachverhalt ganz gut trifft, denn die Selbstgewissheit der Menschen in den Moscheen war ebenso beeindruckend wie die Intransigenz gegenüber anderen Religionen erschreckend.
Die Erinnerung an solche Intoleranz war untrennbar verbunden mit dem Namen des letzten Großmoguls Aurangazeb (1658-1707), der nach der Absetzung seines Vaters Shahjahan eine strikt islamisch begründete Neuorientierung der gesamten Reichspolitik vollzog. Das Gerichts- und Wirtschaftsleben, vor allem aber die Steuergesetzgebung, wurden zum Nachteil der hinduistischen Bevölkerungsmehrheit so stark verändert, dass es zu Aufständen in allen Teilen Indiens kam, denen der Mogulstaat langfristig erliegen sollte. Neben den Rajputenfürsten und der zentralindischen Marathen-Konföderation erhoben sich auch die Sikhs gegen die fundamentalistische Religionspolitik des neuen Kaisers. Auf der Grundlage der Lehren ihrer zehn großen Gurus hatten die Sikhs im 16. und 17. Jahrhundert die Grundzüge einer Theologie entwickelt, die Wesenselemente des Hinduismus und des Islam auf eine durchaus originelle Weise miteinander verband. Doch Aurangazeb hatte mit irgendwelchen Religionssynthesen nicht viel im Sinn. Als Teg Bahadur, der neunte der zehn Gurus, sich im Angesicht Aurangazebs weigerte, seinen Glauben zu widerrufen, ließ ihn der Großmogul zusammen mit seiner Gefolgschaft im Jahre 1675 kurzerhand wie einen Verbrecher unter einem Baum an der Chandni Chowk enthaupten.
Genau an diesem Ort, heute nur wenige Meter von der Sonehri Masjid entfernt, erbauten die Sikhs später das neben dem Goldenen Tempel von Amritsar bedeutendste Heiligtum ihrer Religion, den Sikhtempel Sis Ganj Gudwara, einen Ort intensiver Gläubigkeit, der den Besucher aus den laizistischen Gesellschaften des Westens mit der ihm eigenen vibrierenden Inbrunst fast erschlägt. Zurückgesetzt vom Trubel des Chandni Chowk und oberhalb des Straßenniveaus befand sich in einer mit glitzernden Leuchten geschmückten und mit dicken grünen Teppichen ausgelegten Halle der große altarartige Baldachin, unter dem die Gläubigen die Gebeine des Märtyrer-Gurus verehrten, um sich gleich anschließend dem aufgeschlagenen heiligen Buch hinter Panzerglas zuzuwenden. Scheu und ehrerbietig umkreisten die Sikhs den Baldachin, während die monotone Liturgie von Raga-Gesängen die Halle erfüllte. Stundenlang saßen sie vor dem Märtyrersarg und dem heiligen Buch auf dem Teppich und blätterten meditierend über hektografierten Abzügen aus dem Gur Granth Sahib. Es war vornehmlich der hochgewachsene nordwestindische Menschenschlag, der diesen Tempel frequentierte, würdige Männer, die ihre mächtigen Bärte und Turbane trugen wie die Merkmale einer besonderen Erwählung und deren Augen voller Trauer auf den Baldachin blickten, als schmerze sie die Hinrichtung Teg Bahadurs jeden Tag aufs Neue.
Dass der Großmogul Aurangazeb den vorletzten Guru der Sikhs wie einen Verbrecher hatte hinrichten lassen, wirkte bis heute nach. Wo immer es nach dem Abzug der Briten bei der Aufteilung des indischen Subkontinents zwischen Indien und Pakistan zu Kämpfen gekommen war, hatte man die Sikhs zuverlässig auf Seiten der Hindus gefunden. Das war allerdings auch schon eine Weile her, und zur vollständigen Wahrheit gehörte, dass sich inzwischen auch das Verhältnis der Sikhs zur hinduistischen Glaubensmehrheit erheblich verschlechtert hatte. Religiöse und politische Streitigkeiten zwischen der Zentralregierung und separatistischen Sikhs im nordindischen Punjab hatten im Jahre 1984 zur Erstürmung des Goldenen Tempels von Amritsar durch indischer Truppen geführt, ein ungeheures Sakrileg, das sich in den Augen der Sikhs als genauso ruchlos darstellte wie die Hinrichtung Teg Bahadurs durch den Großmogul Aurangazeb. Die unmittelbare Folge dieser Militäraktion war die Ermordung der indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi durch zwei ihrer Sikh- Leibwächter gewesen, ein Attentat, das ganz Indien erschütterte. Noch in der Nacht des Attentats hatte sich der Hindumob vor dem Sis-Ganj-Gudwara-Tempel zusammengerottet, um das Heiligtum der Sikhs niederzubrennen - gehindert allein von den Soldaten der gleichen indischen Armee, deren Aktionen in Amritsar die Krise erst zum Kochen gebracht hatten.
Wurde man im Heiligtum der Sikhs schier erschlagen von religiöser Energie und geschichtlichen Assoziationen, herrschte im wieder nur wenige Meter entfernten hinduistischen Gauri-Shankar-Tempel eine gänzlich andere Atmosphäre. Entweder hatten die dürftigen Lebensumstände der Menschen ihr Bedürfnis nach Schönheit derart beeinträchtigt, dass sie die rostigen Gitter, die halb fertigen Mauern, den hässlichen Wassertank und die funktionslos herumstehenden Eisenträger im Tempelhof kaum noch wahrnahmen, oder ihr Glaube war tatsächlich so vergeistigt, dass sie der erhebenden Kulisse nicht bedurften. Vor dem achthundert Jahre alten steinernen Lingam, dem Phallussymbol des ekstatischen Gottes Shiva, lag ein abgemagerter Inder mit einem schrecklichen Hautkarzinom lang ausgestreckt auf dem Boden. Diese Szene erklärte mehr als alle Theorie die Überlegenheit der Religion über die Wissenschaft: der Arzt prophezeite dem Kranken den Tod und die Gnade Shiva eine bessere Wiedergeburt.
Im bereits erwähnten Jainatempel Digambara Lal Mandir mit seinem Tierhospital endete der Rundgang über die Chandni Chowk. Verbeugten sich die Moslems in der Goldenen Moschee vor der Gebetsnische, die gen Mekka wies, beteten die Sikhs im Sis Ganj Gudwara vor dem Grab des neunten Gurus, verehrten die Hindus im Gauri-Shankar-Tempel ein achthundert Jahre altes steinernes Phallussymbol, so verneigten sich die Jainas in ihren Tempeln vor den immer gleichen Abbildungen der vierundzwanzig Tirthankaras, die als Wegbereiter der Erlösung die allindische Lehre von den Wiedergeburten, vom Leben als Tal des Leidens und der Askese predigten. Vom Hinduisten unterscheiden sich die Jainas wie die Buddhisten in der Ablehnung des Kastensystems, von allen anderen Religionen trennt die Jainas eine unerhörte Hochachtung des Lebens in jedweder Gestalt. Der fromme Jaina duldet keinerlei Leder in Haus und Tempel, entstammen diese Stoffe doch den Körpern getöteter Tiere. Er trägt einen Mundschutz, damit er nicht aus Versehen ein Tier einatmet, er versagt sich den Tee nach Einbruch der Dunkelheit, weil ein Insekt ins heiße Wasser fallen könnte, und er isst nur Gemüse, das über der Erde wächst, weil das Herausreißen von Gemüsegewächsen samt Wurzeln möglicherweise Würmer und Mikroben in Gefahr bringen könnte.
Jeder Vegetarier mochte das super finden, aber nach meiner Reise durch die indische Religionsgeschichte verlangte mein Magen nach Herzhaftem, und so marschierte ich zum Roten Fort, vor dessen Eingang es das beste Chicken Curry von Delhi geben sollte. Niemand wusste natürlich, wie viele der Hühner, die dem Massaker im Chitli Basar entkommen und von den Jainas wieder hochgepäppelt worden waren, anschließend wieder eingefangen und dann doch noch zu rot geröstetem Chicken Curry verarbeitet wurden, aber das wollte ich an diesem Nachmittag auch nicht mehr wissen. Überall wurde geschmatzt und gelacht, Familien waren unterwegs, und hoch über dem verkehrsfreien Platz vor dem Lahore Gate wehte die indische Staatsflagge, seit sie zum ersten Mal am 15. August 1947 anstelle des Union Jack aufgezogen worden war.
Über zwei Kilometern Länge und in einer Höhe zwischen 18 und 34 Metern erstreckten sich die titanischen Wälle des Roten Forts am Rande Alt-Delhis. Heute ein alter geschändeter Riese aus Stein, hätte es das Rote Fort in seiner Glanzzeit mit den schönsten europäischen Barockschlössern aufnehmen können - in seinen gepflegten Gartenanlagen, den aufwendigen königlichen Bädern, in der großen Audienzhalle mit dem Thron des Herrschers, mit dem Diwan-i-Khas, seinen silbernen Decken und dem sagenhaften Pfauenthron erreichte die Kunst der Mogulzeit ihren letzten Zenit.
Nach Aurangazebs Tod im Jahre 1707 aber war es mit dieser Pracht vorbei. 1739 eroberte Nadir Shah von Persien Shahjahanabad, plünderte die Kostbarkeiten des Forts, ließ die Edelsteine des Diwan-i-Khas aus den Wandfassungen reißen und den sagenumwobenen Pfauenthron entführen. 1760 montierten die Marathen die Silberdecken ab und hinterließen die berühmte Audienzhalle in ihrem beklagenswerten heutigen Zustand. 1858/9, nach dem misslungenen Sepoy-Aufstand gegen die britische Herrschaft, wurden auf Anweisung der Engländer in einem Akt bemerkenswerter kolonialgeschichtlicher Barbarei die prächtigen Haremspaläste in der Mitte des Forts abgerissen, um Platz für hässliche Militärkasernen zu schaffen.
Solchermaßen von der Geschichte gebeutelt, machte das Rote Fort auf den heutigen Besucher nur noch wenig Eindruck. Die Gebäude und Gärten waren ungepflegt, es wurde gegen die Palastwände gepinkelt, und die indischen Familien verteilen die Überreste ihrer Picknicks flächendeckend über die karge Wiese neben der Perlmoschee des Aurangazeb. Der Pfauenthron war weg, die Teiche waren leer, und auch die Gewässer der Yamuna, die noch zu Shahjahans Zeiten an die östlichen Mauern des Forts reichten, hatten ihren Lauf verändert. Von den Zinnen des Forts blickte der Besucher nun auf die staubige Landfläche, die im Lauf der Jahrhunderte zwischen die Mauern des Forts und dem Fluss angeschwemmt worden war. Hier trockneten die Dhobbiwallahs ihre Wäsche, dort grasten die Kühe und an einer anderen Stelle reparierte ein Rikschawallah sein Gefährt. Ein kleiner Wald versperrte den Blick auf das Gandhi Memorial im Südosten, jenem Ort, an dem nach der Ermordung Gandhis im Jahre 1948 eine Million Menschen der Einäscherung des Mahatmas beigewohnt hatten. Nur die Ring Road, die stark frequentierte große nördliche Ausfallstraße Delhis, konnte man von den Zinnen des Roten Forts aus beobachten: Kühe, Kamele, Fußgänger, Fahrräder, Busse und Lastwagen bewegten sich wie eine Karawane langsam über den Horizont.