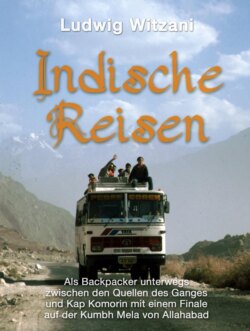Читать книгу Indische Reisen - Ludwig Witzani - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIX Irgendwann kommt jeder einmal nach Agra
Geschichte und Gegenwart einer indischen Kaiserstadt
Rajiv war zweiundzwanzig Jahre alt und ein Bild von einem Mann. Stattlich und schlank, groß gewachsen und sportlich war er, was die Hautfarbe betraf, genauso dunkel, wie man es im Westen mochte, aber noch hellhäutig genug, um in Indien als Angehöriger der oberen Kasten durchzugehen. Andererseits hatte Rajiv mit Kasten überhaupt nichts am Hut. Dass seine Eltern Schuhmacher waren, interessiert ihn nicht, und er hatte sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Seitdem er die Schule geschmissen hatte, lebte und arbeitete er im Touristenviertel Taj Ganj in unmittelbarer Nachbarschaft des Taj Mahal. Seit einem halben Jahr war er die rechte Hand vom „Boss“, dem Eigentümer des Kara Guesthouses, in dem sich die Individualtouristen das ganze Jahr über die Klinke in die Hand gaben. Hier war Rajiv goldrichtig, denn wo sich viele Touristen aufhielten, fiel außer der Reihe immer etwas ab - eine Provision hier, eine Dienstleistung dort, wahrscheinlich auch der eine oder andere kleinere Drogendeal, wer wollte das so genau wissen?
Ich saß auf der Dachterrasse des Kara Guesthouses und frühstückte. Toast mit Marmelade, dazu zwei Spiegeleier und Kaffee. Was hatte dieses Essen mit Indien zu tun? Nichts, aber Taj Ganj war auch nur in einem sehr eingeschränkten Sinne Indien – es war vielmehr eine der zahlreichen Filialen des internationalen Backpackertourismus, in denen der Umgangston, die Musik, das Essen und der Dresscode um einen diffus definierten Mittelwert pendelten, der sich am besten mit zwei Worten beschreiben ließ: easy and cheap. In diesem Umfeld hatte sich Rajiv nicht nur von seiner Herkunft sondern auch von der indischen Küche emanzipiert. Wie die Gäste aß er alles und glaubt an nichts. Vishnu und Shiva hielt Rajiv für Hokuspokus, aber auch mit Jesus, Buddha und Allah konnte er nichts anfangen. Er verehrte stattdessen seine Vespa, die er auf eine nicht ganz saubere Weise finanziert hatte. Denn der schöne Rajiv war der Liebling der allein reisenden jungen Frauen, die das Kara Guesthouse ansteuerten wie die Tauben auf Wanderschaft, und eine unsterblich in ihn verliebte Kanadierin hatte ihm das Geld für ein Flugticket nach Toronto geschickt. Mit diesen kanadischen Dollars war die Finanzierung einer gebrauchten Vespa kein Problem mehr gewesen. Der Flug nach Kanada musste halt warten.
Ich bestellte noch einen Kaffee und blickte über die Häuserdächer von Taj Ganj. Nur der Himmel wusste, wie es möglich gewesen war, dass in der besten Lage der weltberühmten Stadt Agra dieses Billighotelviertel hatte entstehen können. Die Straßen von Taj Ganj waren staubig und eng, die Märkte ärmlich, die Rikschastände überfüllt, aber das Taj Mahal lag buchstäblich vor der Haustüre. Allein das zählte. Beim Morgenkaffee auf der Terrasse einen Blick auf die Umrisse dieses Weltwunders werfen zu können, war für den normalen Individualtouristen einfach ein unschlagbarer Kracher. Ganz konnte man das Gebäude zwar nicht sehen, dafür war das Eingangsportal zu hoch, doch ein Teil der Kuppel und ein Minarett waren gut zu erkennen.
Alle Tische auf der Terrasse waren besetzt. Meistens saßen Paare zusammen, aber auch allein reisende Frau waren anwesend - zwei Australierinnen, eine Dänin und eine hübsche Schweizerin, die sich eine Zigarette nach der nächsten ansteckte. Doch ganz gleich wie sie aussahen oder was sie machten – alle wurden vom schönen Rajiv mit Charme und Aufmerksamkeit bedient. Die Damen dankten es ihm mit reichlich Trinkgeld, denn so blendend weiße Zähne, wie sie Rajiv bei seinem Lächeln zeigte, hatten sie lange nicht mehr gesehen. Inzwischen reichte Rajivs Englisch sogar für den einfachen Basisflirt, den Rest erledigte sein gutes Aussehen. Der Boss hatte nichts dagegen, solange es dem Geschäft nicht schadete.
Und Guesthäuser in Taj Ganj waren tatsächlich ein gutes Geschäft. Die Kundschaft erschien zuverlässig über das ganze Jahr hinweg, war bedürfnislos und dankbar, wenn die Dusche lief und das Bett nicht zusammenbrach. Es war ein juveniler Querschnitt aus den westlichen Ländern, der allmorgendlich auf den Dachterrassen von Taj Ganj Müsli, Pancake oder Sunny Side Eggs bestellte - angereichert neuerdings mit immer mehr Ostasiaten, die auf der Grundlage ihrer steigenden Kaufkraft nun auch Südasien erkundeten. Mr. „Not for me“, den ich zum ersten Mal in Delhi getroffen hatte, war ebenso da wie Pierre, der nun schon seit Jahren kreuz und quer durch Indien reiste und sich in jeder neuen Stadt erst einmal einen Joint gönnte, um sich zu akklimatisieren. Irgendwann einmal kommt jeder nach Agra, sagen die Wirte von Taj Ganj, denn die Stadt bietet dem Indienreisenden gleich zweierlei: das geballte Erlebnis von seinesgleichen, nach dem auch der härteste Traveller in der Fremde mehr lechzt als er zugeben möchte, und einen der kulturell attraktivsten Orte ganz Indiens.
Tatsächlich gehört Agra von außen betrachtet zu den berühmtesten Städten Asiens. Im Rahmen einer im Jahre 2007 weltweit durchgeführten Befragung über die „Neuen Weltwunder“ belegte die Kaiserstadt der Mogulherrscher neben der Chinesischen Mauer und dem peruanischen Machu Pichu den ersten Platz. Indienintern liegt Agra ohnehin ganz weit vorne – kein Indiennovize, der nicht zuerst und vor allem nach Agra und dort schnurstracks zum schönsten Gebäude der Welt fahren würde: zum Taj Mahal. Längst hatte die jährliche Gesamtzahl der Besucher, die als Backpacker, als Gruppenreisende aus Übersee oder als Inlandstouristen die Stadt besuchten, die Millionengrenze überschritten, und wie viele es aktuell waren, wusste niemand. Das war eigentlich die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass mit dem hemmungslosen Anwachsen des Massentourismus die traditionelle indische Gastfreundschaft in Agra zum Teufel gegangen war. Nicht, dass die Bewohner von Agra schlechter oder besser gewesen wären als die Einwohner von Madras oder Madurai - doch die Begleiterscheinungen des Massentourismus hatten ganz einfach die Sitten verdorben. Wo der normale Inder in seiner freundlichen Bereitwilligkeit einen nach dem Weg fragenden Touristen oft höchstpersönlich zu dem erfragten Ort geleitete, waren dergleichen Dienstleistungen in Agra nur gegen Bakschisch zu erhalten. Der Hauptbahnhof von Agra war von Neppern und Schleppern durchsetzt, und gegen die Preiskartelle der Rikschafahrer hatte kein Einzelreisender eine Chance. In ganz Indien war Agra berüchtigt für seine Schmuckhändler, die mit ihren falschen Edelsteinen die Kunden über den Tisch zogen, und keine Stadt wurde so oft von Lebensmittelskandalen erschüttert wie Agra. Unter Travellern ging das Bonmot, dass derjenige, der das versiffte Essen in einem der überteuerten Restaurants der Stadt überlebte, spätestens an einer der dreckigen Spritzen der Ärzte zugrunde gehen würde. Manche behaupteten aber auch, dass es gerade die Wirte aus Taj Ganj waren, die diese Horrorgeschichten lancierten, damit die zahlungskräftige Klientel davon abgehalten wurde, sich in einem der besseren Mittelklassehotels im Süden von Taj Ganj einzuquartieren.
Leider waren bei meiner Ankunft in Agra alle normalen Zimmer des Kara Guesthouses belegt, weil die israelischen Rekruten auf Armeeurlaub in Agra eingefallen waren. So zeigte mir Rajiv eine Schlafgelegenheit im obersten Stockwerk: Der Boden war unverputzt, die Wände befanden sich noch im Rohbau, und wo Fenster hätten sein sollen, waren nur Löcher, durch die ich allerdings einen Teil des Taj Mahal hinter den Dächern der Nachbarhäuser sehen konnte. Elektrizität gab es nicht, und die sanitären Anlagen befanden sich eine Etage tiefer im funktionsfähigen Teil des Gebäudes. Fragend blickte mich Rajiv an, und ich nickte. Ich verfügte immerhin über eine Stirnlampe, mit der ich abends ein wenig würde lesen können, über ein eigenes Moskitonetz, das sich in nahezu jeder Räumlichkeit leicht befestigen ließ, über Ohrenstopfen, die mich vor den akustische Belästigungen der indischen Nacht beschützen würden und alles in allem über einen gesunden Schlaf.
Am ersten Tag meines ersten Aufenthaltes in Agra ließ ich mich mit der Rikscha kreuz und quer durch die Stadt fahren. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass ich damals noch wenig Indienerfahrung besaß und nicht wusste, dass sich aus der Rikschaperspektive fast alle indischen Städte gleichen. Wie Kalkutta, Delhi und Bombay, wie Patna oder Hyderabad erwies sich Agra abseits der weltberühmten Sehenswürdigkeiten als ein brüllendes Chaos aus Staub, Hitze und Blech. Auf meinem Weg zur Yamunabrücke passierte ich aufgerissenen Asphalt, unverlegte Rohre, offene Kloaken, halb zerstörte Fassaden und Stahlschrott, der quer und sperrig über der Fahrbahn lag.
Solche Ansichten sind in Indien nichts Außergewöhnliches sondern nur die Bühne, auf der sich jene hunderttausend Miniaturszenen abspielen, denen das Indienerlebnis seine Intensität verdankt. Eine Rikscha, die wegen Überladung zusammengebrochen war, ein Karren, der in einem offenen Gulli festsaß – auf indischen Straßen nichts Besonderes. Ich sah einen kleinen Jungen, der mit herunter gelassener Hose auf dem Bordstein hockend, seinen kleinen Hund in die Höhe hielt, damit er kötteln konnte, während er selbst eine kleine Wurst in den Rinnstein fallen ließ. Zwei kleine Böcke, von denen man sich fragen mochte, wo das Muttertier abgeblieben war, standen sich inmitten des tosenden Verkehrs Köpfchen an Köpfchen gegenüber und fixierten sich wie Alphabullen. Eingehüllt in knallrote Saris winkten mir zwei junge Mädchen in ihrer betörenden Schönheit zu, und als eine von ihnen lachte, sah ich eine einzige rote Betelwunde. Eine schrecklich zersauste Frau hatte sich lang auf den Bordstein gelegt und ihre Arme ausgebreitet, als wolle sie sichergehen, dass jedermann ihr Leid zur Kenntnis nehme, und sei es auch nur, indem er die Füße heben und darüber hinweg steigen musste.
All das war indischer Alltag, für dessen Anblick niemand eigens nach Agra kam. Die meisten Touristen, die nach Agra kamen, wollten sich lieber an imperialer Geschichte laben, die Anmutungen von Tausendundeiner Nacht erfahren und genau an jener exotischen Projektion partizipieren, auf der Indiens weltweite Werbewirkung beruhte. Die Ursprünge dieser Projektion gehen auf das Mogulreich zurück, das im 16. und 17. Jahrhundert Indien beherrschte und dessen bedeutendste Kaiser Akbar (1556-1605), Jehangir (1605-1627), Shahjahan (1628-1658) und Aurangazeb (1658-1707) ihre Hauptstadt Agra zu einer Stadt ohnegleichen ausgebaut hatten.
An der Mogulepoche scheiden sich in Indien allerdings noch immer die Geister. Die Moslems preisen die Mogulära als den einsamen Höhepunkt indischer Kultur und Gesittung. Für die meisten Hindus waren die Moguln nur die letzte Erscheinungsform einer apokalyptischen Plage, die seit dem zwölften Jahrhundert aus den Bergen Zentralasiens kommend immer aufs Neue über Indien hergefallen waren. Nicht genug damit, dass die moslemischen Heerführer Nordindien erobert und verwüstet hatten: Es waren ihnen andere moslemische Konquistadoren gefolgt, die dann nicht nur die Hindus sondern auch noch ihre gerade erst siegreichen Glaubensbrüder massakrierten - unter ihnen der Schrecklichste von allen, der Mongole Tamerlan, der im Jahre 1398 Delhi in Schutt und Asche legte und einhunderttausend Kriegsgefangene einfach niedermetzeln ließ.
Babur, der erste Großmogul, der den Sultan von Delhi 1526 in der Kanonenschlacht von Panipat besiegte und das nordindische Mogulreich begründete, war ein Nachkomme des Völkerschlächters Tamerlan. Sein Sohn Humayun, der das Reich fast wieder verloren hätte, war ein zögerlicher Melancholiker, der einen ganz unkriegerischen Tod erlitt, als er im Jahre 1556 in seiner Bibliothek in Delhi die Treppe herunterfiel. Sein Nachfolger wurde Akbar, der dritte und bedeutendste Großmogul, unter dem es eine Zeit lang immerhin so ausgesehen hatte, als wäre es möglich, den Antagonismus zwischen Hindus und Moslems zu überwinden. Fatepur Sikri, die gigantische Geisterstadt vor den Toren Agras, war Akbars architektonisches Vermächtnis, und mit diesem Ort wollte ich meine Reise durch die Vergangenheit beginnen.
Eine knappe Stunde dauerte die Busfahrt vom Agra Fort nach Fatepur Sikri. Über dreißig Kilometer führte die Straße nach Westen in ein sanft gewelltes Hügelland durch Dörfer und kleine Weiler, ehe hinter einem letzten Hügel in der Ferne die Silhouette der verlassenen Stadt sichtbar wurde. Die hoch aufragenden Wehrmauern, das Riesentor über der gewaltigen Treppe, die zahlreichen Minarette und die Umrisse der Stadt erschienen mir wie die Kulisse eines Monumentalfilms, und unwillkürlich spähte ich nach den Komparsenhorden, die nach den Anweisungen eines Hollywoodregisseurs gleich mit Holzschwertern und Sandalen zur Schlacht antreten würden. Doch die wuchtigen Mauern von Fatepur Sikri waren keine Fakes, sondern die authentischen Zeugen einer steingewordenen Vergangenheit, die sich als eine Laune der Weltgeschichte bis in die Gegenwart gerettet hatte. Die Inder, die an diesem Tag mit dem gleichen Bus wie ich aus Agra angereist waren, aber blickten gar nicht mehr hoch. Fatepur Sikri hatte für sie den Bereich der Geschichte längst verlassen und war zu einem Stück Natur geworden wie der Fluss, der Hügel oder die weite Ebene, auf der sich die Stadt erstreckte.
In der Nähe der großen Moschee von Fatepur Sikri entstieg ich dem Bus und lief zum Buland Darzawa, dem größten Siegestor Asiens. Über eine weiträumige Treppe stieg ich wie ein Zwerg einem vierundfünfzig Meter hohen Tor entgegen, das in seiner Größe in der Welt nichts Vergleichbares hat. Zusammen mit den beiden kreisrunden Ornamenten über dem Eingangsiwan wirkte das Tor wie ein riesiger Mund, der die Welt verschlang. Zahlreiche Nischen, Seitenstreben und Mogultürme in den verschiedensten Größen bewahrten das monumentale Tor vor jeder Klobigkeit, und der Schein der Nachmittagssonne illuminierte das Gestein mit seinem blutroten Licht.
Nach der Durchschreitung des Buland Darzawa erreichte ich den Innenhof der großen Moschee von Fatepur Sikri, einem der mit 165 Metern Länge und einer Breite von 133 Metern größten Vorhöfe der islamischen Welt. In diesem Hof, an eine der Mauern angelehnt, befand sich das baldachinartige Mausoleum Scheich Saalem Chistis, ein ganz aus Marmor errichteter Bau, dessen Fensterfronten mit Tausenden hauchdünner Ornamente perforiert waren. Der Überlieferung nach soll der islamische Sufi Saalem Chisti, der hier als Einsiedler lebte, dem Großmogul die Geburt des lange ersehnten Thronfolgers vorausgesagt haben. Seinen eigenen Sohn soll er gleich nach dieser Weissagung getötet haben, um auf diese etwas krasse Weise die Umstände für die Prinzengeburt zu verbessern. Als dann Akbars Hauptfrau tatsächlich schwanger wurde und im Jahre 1567 einen Sohn gebar, entschloss sich Akbar an dem Ort, der ihm so viel Glück gebracht hatte, seine neue Hauptstadt zu errichten. Mauern, Tore und Paläste wuchsen in den Himmel, Teiche und Brunnen wurden angelegt oder neu gebaut, ehe der Großmogul im Jahre 1571 mitsamt seinem Hof von Agra nach Fatepur Sikri zog. An alles war gedacht worden – nur nicht an die Wasserversorgung, die sich bald als so unzureichend erwies, dass der Großmogul nach weniger als zwanzig Jahren seine neue Hauptstadt wieder verlassen und nach Agra zurückkehren musste. Zurückgeblieben ist eine Geisterstadt, prachtvoll und grandios wie ein Traum, der zu schön war, um wahr zu sein und der an der schnöden Realität von Bodenbeschaffenheit und Wasservorkommen zerschellte.
Diese eigentliche Kaiserstadt nordöstlich der großen Moschee war groß, geräumig und leer, wie manches Herz, nachdem die Liebe es verlassen hat. Im Mittelpunkt der fast vollständig erhaltenen Anlage erhob sich das fünfstöckige „Goldene Haus“, von dessen Fenstern aus die Haremsdamen das Treiben auf den weiten Höfen beobachten konnten. Ich erkletterte das oberste Stockwerk des „Goldenen Hauses“ und erblickte ein Gesamtpanorama des Palasthofes mit seinem großen Teich, mit den Schlafgemächern des Kaisers und der großen Audienzhalle auf der anderen Seite. Alles war in rotem Sandstein gehalten und mit unzähligen Mogultürmchen geschmückt, die aus der Entfernung aussahen als zöge eine Karawane aus lauter Elefanten mit dünnen Beinchen vorüber. Zahlreiche Balkone, Erker und runde Kioske, die die Mauern krönten, durchgliederten die Fassaden der Gebäude wie eine vertikale Landschaft. Reichhaltiges Dekor schmückte die Kapitele und Portale – unverkennbar hatte die Darstellungsfreude der hinduistischen Kunst die strenge Askese der islamischen Architektur beeinflusst.
Das möglicherweise berühmteste Gebäude der Kaiserstadt war das Diwan-i-Khas, das Juwelenhaus, in dem sich die große Audienzhalle Akbars befand. Eine einzige Säule mit wild wuchernden Ausläufern trug die Decke des Raumes, in dem Akbar Gelehrte der verschiedensten Religionen miteinander diskutieren ließ. Obwohl Akbar an bestimmten Formen des Islam festhielt, hatte sich der Großmogul spätestens in der Epoche von Fatepur Sikri längst vom strengen Islam gelöst und sich auch mit den anderen Gottesvorstellungen beschäftigt, die in seinem Reich geglaubt wurden. Wo einhundert Jahre später Akbars Urenkel Aurangazeb mit seiner religiösen Intoleranz die Totenglocke des Mogulreiches läuten sollte, hatte sich sein Urgroßvater sogar in der Kreation einer neuen Reichsreligion versucht. Din-e-Ilahi, „Religion Gottes“, nannte Akbar dieses philosophisch-theologisches System, das alle Gotteszugänge der großen Religionen als gleichberechtigt anerkannte und in dem versucht wurde, Islam und Hinduismus zu verbinden. Doch mit Din-e-Ilahi ging es Akbar genauso wie mit seiner Hauptstadt. Die neue Religion Gottes hatte keine Zukunft. Als reine Kopfgeburt konnte sie weder die Masse der Hindus noch der Moslems überzeugen. Mit Akbars Tod im Jahre 1605 verschwand sie auf Nimmerwiedersehen im Orkus der Geschichte – der Mogulhof war schon zwanzig Jahre vorher wieder nach Agra zurückgekehrt.
So lag etwas Wehmütiges über der verlassenen Stadt, eine Ahnung von Frieden und Toleranz, die an diesem Platz nicht hatte Wirklichkeit werden können. Die Sonne sank tiefer, die Schatten in den Höfen wurden länger, der rote Sandstein glühte, als würden sich die Fassaden der Paläste entzünden. Ich schloss die Augen und fantasierte Prinzessinnen und Generäle, Höflinge, Beamte und Diener auf einem imaginären Bühnenbild der Vergangenheit. Der Großmogul verfolgte von einer Sänfte aus das Treiben auf den weiten Plätzen, christliche Missionare aus Goa waren eingetroffen, um am Abend mit Sufis und Yogis im Diwan-i-Khas zu diskutieren. Da rüttelte mich ein Aufseher an den Schultern. Die Dämmerung war hereingebrochen, ich musste gehen.
Als ich am Abend ins Guesthouse zurückkam, herrschte dicke Luft auf der Terrasse. Eine Gruppe von Australiern hatte sich zerstritten, einige wollten nach Gwalior, andere endlich ans Meer, aber alle ärgerten sich über das Bier, das ihnen zu warm war. Zwei Frauen in den Dreißigern beschwerten sich über das Chicken Curry, das ihnen verbrannt vorkam. Eine von beiden war eine hagere Blondine mit scharf geschnittenen Gesichtszügen. Dazu trug sie eine Hornbrille, was ihr das groteske Aussehen einer Gouvernante auf Indienreise gab. Ihre Freundin war mollig und ein wenig eingefallen, sie stellte eine beleidigte Schnute zur Schau und überließ ihrer Freundin die Reklamation. Rajiv versuchte zu beschwichtigen und berührte dabei die Hagere vertraulich an der Schulter. Doch die Hagere schlug ihm blitzschnell die Hand von ihrer Schulter. „Keep your hands off und bring an new chicken“, zischte sie. Ich sah, wie Rajiv das Blut ins Gesicht schoss, und einen Augenblick dachte ich, er würde die Blonde auf der Stelle ohrfeigen, doch er ließ es und ging an die Kasse zurück.
Am nächsten Morgen waren die beiden Frauen verschwunden. Rajiv nahm auf der Dachterrasse missmutig die Bestellungen der Gäste entgegen und übersah die Flirtversuche der Schweizerin, die schon wieder wie ein Schlot rauchte. Wie ich von Pierre erfuhr, war „Mr. not for me“ aus dem Guesthouse geflogen, weil er die Rechnung nicht mehr bezahlen konnte.
Nach dem Frühstück ließ ich mich von einer Rikscha an das Ufer der Yamuna fahren. Wieder stauten sich Lastwagen, Limousinen und Gefährte aller Art vor der Brückenauffahrt, und zu allem Unglück war ein Karren umgestürzt, was den Verkehr ganz zum Erliegen brachte. Wirklich auf die Fortbewegung verlassen kann sich in lndien nur der Fußgänger, und so verließ ich die Rikscha und überquerte die Brücke, um die zweite bedeutende Sehenswürdigkeit Agras zu besuchen, das ltimald-ud-Daulat, das Grabmal eines persischen Wesirs, unter den Touristen nur als „Baby Taj“ bekannt, weil das Bauwerk nur wenige Jahre vor der Errichtung des Taj Mahal entstanden war.
Der Name des iranischen Wesirs, der im Itimad-ud-Daulat begraben lag, war Mirza Ghias Beg. Nach einer umstrittenen Überlieferung hatte er im Jahre 1578 als Flüchtling den Mogulhof in Fatepur Sikri erreicht und war dort schnell zu höchsten Positionen und schließlich zum Rang eines ersten Ministers aufgestiegen. „Itimad-ud-Daulat", Säule des Staates, nannte der alte Kaiser Akbar seinen Wesir, und Akbars Sohn und Nachfolger Jehangir erhob Ghias Begs Tochter Mehrunnissa sogar zur „Nur Jahan“, zum Licht der Welt, und zu seiner Hauptgemahlin. Kaiserin Nur Jahan, die in den späten Jahren des opiumabhängigen Kaisers Jehangir mehr und mehr die Führung der Reichsgeschäfte übernahm, war es auch, die für ihren 1622 verstorbenen persischen Vater das prachtvolle Itimad-ud-Daulat erbauen ließ.
Der quadratische Bau mit seinen vier kleinen Minaretten besaß eine Seitenlänge von 43 mal 43 Metern und vier knapp dreizehn Meter große Tore. Im Innenhof befand sich, von einem gepflegten Park umgeben, das Mausoleum des Wesirs auf einer erhöhten Empore. Ich strich mit der Hand über die Marmorwände, die sich wunderbar kühl anfühlten und setzte mich in den Schatten der Umfassungsmauern. Was für eine Wonne, sich von der zudringlichen Hektik der indischen Wirklichkeit in eine historische Nische flüchten zu können. Die unterhalb des Grabmals vorbei fließende Yamuna schien die Geräusche der Stadt zu schlucken, außerdem war es leer, denn die Touristen, die das Mausoleum gleichsam als Vorprogramm zum Taj Mahal besuchten, waren schon wieder verschwunden. Die abstrakten Formen und Girlanden, die die Marmorwände des Grabmals bedeckten, beruhigten mich - unwillkürlich folgten die Augen den Linien bis in die kleinsten Verästelungen, als sei das Rätsel der Schönheit wie eine Formel an die Außenwände des Grabmals geschrieben.
Sechs Jahre lang, von 1622 bis 1628, sollen die Bauarbeiten am ltimad-ud-Daulat gedauert haben - sechs stürmische Jahre, in denen der Großmogul Jehangir endgültig in seinen Opiumräuschen versank und während derer seine Gattin Nur Jahan den Thronfolger Prinz Khurram in den Aufstand gegen seinen Vater trieb. Am Ende, ein halbes Jahr vor der Fertigstellung des Bauwerkes, verstarb der alte Kaiser, und Nur Jahans eigener Bruder Asaf Khan beförderte die Kaiserin mit Einverständnis Prinz Khurrams aufs Abstellgleis. Nur Jahan wurde vom Hof verbannt und zog sich nach Lahore zurück, wo sie den Rest ihrer Tage die Bauarbeiten am Grabmal ihres Gatten Jehangirs beaufsichtigte. Prinz Khurram aber bestieg nach einem Blutbad sondergleichen als Shahjahan (Herrscher der Welt) den Mogulthron.
Mit Shahjahans Regierungszeit (1628-1658) erreichte das Imperium seinen Zenit und seinen Umkehrpunkt zugleich, denn seine aufwendigen Bauten in allen Regionen Indiens sollten die finanzielle Leistungsfähigkeit des Reiches bei weitem überfordern. Und das Gemetzel, das der Kaiser bei seinem Regierungsantritt an seiner Verwandtschaft angerichtet hatte, wurde zum Menetekel seines späteren Konfliktes mit seinem ungebärdigen Sohn Aurangazeb.
Wie schon sein Vater Jehangir war auch Shahjahan mit einer Frau aus der Familie des persischen Wesirs Ghias Beg verheiratet. Arjumand Banu, die Enkelin des Wesirs und die Nichte der alten Kaiserin, sollte den Ruhm Nur Jahans noch übertreffen. Als Mumtaz Mahal", als „Perle des Palastes", wurde sie die berühmteste Frau Indiens – tragischerweise durch nichts anderes als durch ihren frühen Tod. Mumtaz Mahal verstarb schon im vierten Regierungsjahr des neuen Kaisers im Alter von nur 39 Jahren, was den untröstlichen Shahjahan veranlasste, alle Ressourcen seines Reiches aufzuwenden, um für seine verstorbene Gattin ein Bauwerk zu errichten, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte: das Taj Mahal. Künstler und Architekten aus Iran und Zentralasien, aus Venedig und Frankreich waren unter der Federführung des Kaisers an der Konzeption und der Durchführung des Baus beteiligt, aus allen Teilen des Reiches wurden Baumaterialien und Arbeitskräfte zusammenbezogen, und zeitweise arbeiteten zwanzigtausend Menschen gleichzeitig am Ufer der Yamuna.
Dreimal habe ich in meinem Leben das Taj Mahal besucht, und jedes Mal war ich aufs Neue erschüttert, aber an meine ersten Empfindungen kann ich mich noch gut erinnern. Die erste Empfindung war eine Überraschung darüber, dass die vollkommene Schönheit, von der man immer gehofft hatte, es möge sie geben, tatsächlich existierte. Die zweite Empfindung war ein Wohlgefühl, das mich beim puren Anblick des Taj Mahal erfüllte, gerade so, als besäße die vollkommene Schönheit die Kraft, in dem Menschen, der sie betrachtete, Glück zu erzeugen.
Seine Gefühle beim Anblick des Erhabenen zu deklarieren aber war das eine – etwas ganz anderes war es, sich die Elemente zu vergegenwärtigen, die diese Gefühle hervorriefen. Es war nicht so sehr die große Kuppel, die sich über dem Grabmal erhob, nicht so sehr die vie r eleganten Minarette, die das Grabmal in vornehmem Abstand umstanden, auch nicht die beiden sandsteinfarbenen Seitengebäude, die den großen Marmorbau wie Kontrapunkte umgaben oder die vornehme Dunkelheit der Krypta - sondern es war alles zusammen: die Harmonie ihrer Proportionen, ihrer Form und ihrer Platzierung inmitten eines paradiesisch anmutenden Parks verwandelten das ganze Areal am Ufer der Yamuna in ein Reich abgesonderter Wirklichkeit, in dem sich die Menschen ehrfürchtig und behutsam bewegten, als wollten sie alles unterlassen, die Vollkommenheit zu stören.
Drei aufeinander folgende Tage besuchte ich das Taj Mahal. Ich hielt mich von morgens bis abends in der Anlage auf, lag auf der Wiese, schlief, sah, träumte und schrieb. Ich umkreiste das Bauwerk und nahm die unterschiedlichsten Positionen und Perspektiven ein, wechselte immer wieder meinen Standort, ohne mich einem Gesamtverständnis anzunähern. Überall sah ich indische Liebespaare, die sich im Angesicht des Taj Mahal umarmten, was mir angemessen vorkam, denn allein empfand ich mich dem Bauwerk gegenüber als unvollständig, als hilflos und unerlöst - ich vermochte seinen Rang nicht zu fassen und hatte das Gefühl, als übersteige das, was ich sah, meine Verständnisfähigkeit. Trotzdem war ich glücklich, diesen Anblick Tag für Tag und ohne jede zeitliche Begrenzung in mich aufnehmen zu können, und während meines Aufenthaltes kam es mir vor, als impfe ich mich mit einem Quantum Schönheit, das mich viele Jahre tragen würde.
Nach dem Besuch des Taj Mahals war für mich die Luft raus aus Agra. So besuchte ich zum Abschluss meines Aufenthaltes in Agra nur flüchtig das riesenhafte Agra Fort an der Yamuna, an dem ich auf dem Weg zu den anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt bisher jeden Tag nur vorbeigefahren war. Auch diese kombinierte Festungs- und Palastanlage war eine Schöpfung Shahjahans, der nach der Fertigstellung des Taj Mahal seine Bautätigkeit womöglich noch intensiviert hatte. Zweieinhalb Kilometer in der Länge maßen die Wehrmauern des Forts, von denen sich der Besucher fragen mochte, gegen wen sie errichtet worden waren, denn erstzunehmende Gegner waren in Shahjahans Zeiten weit und breit nicht mehr in Sicht. Innerhalb der Wehrmauern lief ich durch ein ganzes Ensemble von Palästen und Moscheen, die einen vernachlässigten Eindruck machten. Die Gartenlagen waren ungepflegt, in den Audienzhallen und Gemächern sah ich beschädigte Decken, Schmuckstücke waren offenbar aus den Wänden gestohlen worden, und Baumaterialien lagen wahllos in den Ecken herum.
Doch ich war ohnehin nur wegen eines einzigen Raumes zum Agra Fort gekommen. Auf der Flussseite des Forts hatte Shahjahan einen kleinen Turm errichten lassen, durch den es möglich war, über eine enge Treppe eine Terrasse zu erreichen, von der aus sich nicht nur ein Ausblick auf die Yamuna, sondern auch auf die Umrisse des Taj Mahal im Südwesten bot. Und genau in diesen Turm, den Burj Saman, wurde Shahjahan nach dem Staatsstreich seines Sohnes Aurangazeb im Jahre 1658 gefangen gesetzt. Acht Jahre lang hatte der alte Kaiser während dieser Haft tagtäglich Gelegenheit, auf sein größtes Werk zu blicken, während das Reich unter dem Regiment seines Sohnes in die Phase seiner imperialen Überdehnung und Ausblutung eintrat. 1666 war er in diesem Turm gestorben, kurz darauf wurde er in der Krypta des Taj Mahal an der Seite der Mumtaz Mahal begraben.
Inzwischen neigte sich das Jahr dem Ende entgegen, und das Wetter wurde immer schlechter. Morgens lag ein dichter Nebel über der Stadt, von dem man gar nicht glauben mochte, dass er sich im Laufe des Tages auflösen würde. Sogar die Umrisse des Taj Mahal waren von der Dachterrasse des Kara Guesthouses nicht mehr zu sehen. Mitten in diese trübe Stimmung platzte am Silvestermorgen ein Skandal, mit dem niemand gerechnet hatte. Der Morgentee war noch gar nicht gekocht, als der Boss wütend durch das Guesthouse lief und seine Angestellten zusammen schrie. Wie sich herausstellte, war Rajiv mit der Kasse durchgebrannt, und auch die hübsche Schweizerin war verschwunden. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Als die Polizei Rajivs Zimmer durchsuchte, fand sie Spuren von Drogengebrauch und schloss kurzerhand das Guesthouse.
Mir war es recht, dann konnte ich mir zur Feier des Jahreswechsels noch ein schöneres Zimmer gönnen. Ich buchte eine Nacht in einem Mittelklassehotel mit Marmorverkleidung und großer Eingangshalle. Der Rezeptionist hatte ein hochnäsiges Gehabe, und ehe ich mich versah, zerrte mir der Boy meinen Rucksack von den Schultern, um ihn hochzutragen. Ich zahlte für mein neues Zimmer den dreifachen Preis wie im Kara Gusthouse und besaß dafür eine eigene Dusche, ein relativ großes Bett und eine Nachttischlampe.
Leider tropfte das Wasser in meinem neuen Bad noch spärlicher aus dem Duschkopf als in meiner letzten Bleibe, die Mücken stachen hier ebenso zu wie in Taj Ganj, und kaum war es dunkel geworden, brach der Strom zusammen. Im Essraum des Hotels wurden am Silvesterabend immerhin Kerzen aufgestellt, doch ich war der einzige Gast. Ein Kellner saß desinteressiert und Betelnuss kauend in einer Restaurantecke, und als ich etwas bestellen wollte, hieß es nur: Sorry, no energy.
So landete ich schon lange vor Mitternacht in meinem großen Bett, zog mir in der Dunkelheit die Kopfhörer über die Ohren, um den Jahreswechsel mit mir selbst und Rimsky-Korsakows „Scheherazade“zu begehen. Aber auch das blieb mir an diesem Abend versagt. Wie sich zeigte, waren die Batterien meines MP3-Players leer. So lag ich zum Jahreswechsel in Agra allein im Dunkeln und hörte nichts weiter als das Surren der Moskitos.