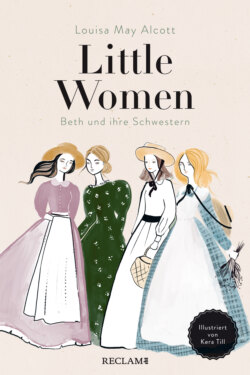Читать книгу Little Women - Луиза Мэй Олкотт - Страница 13
Bündel
Оглавление»Oh weh, wie schwer es einem fällt, sein Bündel zu packen und weiterzuziehen«, sagte Meg seufzend am Morgen nach der Feier. Die Ferien waren vorbei, und nach einer Woche voller Festivitäten fiel es ihr alles andere als leicht, ihre ungeliebten Pflichten wieder aufzunehmen.
»Ich wünschte, es wäre immer Weihnachten oder Neujahr; wäre das nicht lustig?«, erwiderte Jo und gähnte betrübt.
»Wir würden es nicht halb so sehr genießen wie jetzt. Aber es ist wirklich schön, vornehme Abendessen spendiert und Blumensträuße geschenkt zu bekommen, auf Feiern zu gehen und in einem Wagen nach Hause zu fahren, zu lesen, sich auszuruhen und nicht schuften zu müssen. Ein Leben, wie es andere führen, weißt du, und ich beneide die Mädchen, die sich sowas erlauben können. Luxus ist wirklich was Feines«, sagte Meg und überlegte, welches ihrer beiden schäbigen Kleider das weniger schäbige war.
»Tja, wir können’s nun mal nicht, also lass uns nicht murren, sondern unsere Bündel schultern und so frohen Mutes weitermachen wie Marmee. Keine Frage, Tante March ist für mich ein unberechenbarer Meeresgott, aber ich vermute, sobald ich gelernt habe, sie klaglos auf mich zu nehmen, wird sie von mir abfallen, oder zumindest so leicht werden, dass sie mir gar nichts mehr ausmacht.«
Dieser Gedanke gefiel Jo und hob ihre Laune, aber Megs Stimmung hellte sich kein bisschen auf, denn ihr Bündel, bestehend aus vier verwöhnten Kindern, schien ihr schwerer als je zuvor. Sie hatte nicht einmal Lust, sich wie sonst hübsch zu machen, sich eine blaue Schleife um den Hals zu binden und sich zu frisieren.
»Was soll ich mich zurechtmachen, wenn mich ohnehin keiner sieht, außer diese nervtötenden Zwerge. Niemanden kümmert’s, ob ich hübsch aussehe oder nicht«, murmelte sie und schob mit einem Ruck ihre Schublade zu. »Ich werde bis ans Ende meiner Tage schuften müssen, und nur hier und da ein bisschen Spaß haben. Dann werde ich alt, hässlich und verbittert, nur weil ich arm bin und mein Leben nicht so genießen kann wie andere Mädchen. Es ist zum Heulen!«
So ging Meg mit gekränkter Miene nach unten und war beim Frühstück sehr unleidlich. Alle wirkten ein wenig neben sich und unzufrieden.
Beth lag mit Kopfschmerzen auf dem Sofa und versuchte sich mit der Katze und ihren drei kleinen Jungen zu trösten; Amy war aufgebracht, weil sie nicht gelernt hatte und ihre Überschuhe verschwunden waren; klar, dass Jo ein Liedchen pfiff und beim Anziehen jede Menge Lärm machte; Mrs March war damit beschäftigt, einen Brief zu Ende zu schreiben, der dringend in die Post musste; und Hannah war unausgeschlafen und übellaunig.
»Mein Gott, sind wir alle unleidlich!«, rief Jo wütend, nachdem sie ein Tintenfass umgeworfen, beide Schnürsenkel ihrer Stiefel abgerissen und sich auf ihren Hut gesetzt hatte.
»Du aber am schlimmsten!«, gab Amy zurück und löschte das – natürlich falsche – Ergebnis auf ihrer Schiefertafel mit ihren Tränen.
»Beth, wenn du diese grässlichen Katzen nicht im Keller lässt, sorge ich dafür, dass sie ertränkt werden,«, rief Meg gereizt und versuchte vergeblich, das Kätzchen zu packen, das an ihrem Rücken hochgeklettert war und sich festgekrallt hatte wie eine Klette.
Jo lachte, Meg schimpfte, Beth flehte und Amy jammerte, weil sie nicht mehr wusste, wie viel 9 mal 12 war.
»Mädchen! Mädchen! Bitte! Seid leise! Das hier muss in die Morgenpost, und ich kann mich so nicht konzentrieren«, rief Mrs March, die schon zum dritten Mal einen Satz durchstreichen musste.
Dann war es still, bis Hannah hereinstürzte, zwei heiße Teigtaschen auf den Tisch legte und wieder hinausstürzte. Diese Teigtaschen waren eine Institution, und die Mädchen nannten sie scherzhaft ihre ›Muffe‹, da sie keine richtigen Muffe besaßen und es liebten, sich an kalten Morgen an den heißen Küchlein die Hände zu wärmen.
Hannah vergaß nie, welche zu backen, egal wie viel sie zu tun hatte oder wie grantig sie war, denn der Fußweg der armen Dinger war lang und trostlos; sie bekamen kein Mittagessen und waren selten vor drei Uhr nachmittags zu Hause.
»Knuddel deine Katzen und gute Besserung, Betty. Mach’s gut, Marmee. Wir waren schlimm heute Morgen, aber nachher kommen wir als Engel zurück. Auf geht’s, Meg!« Und Jo stapfte los. Anscheinend waren die Pilgerinnen heute allesamt mit dem falschen Fuß aufgestanden, dachte sie.
Vor der Biegung warfen sie noch einen letzten Blick zurück, denn wie immer stand ihre Mutter nickend und lächelnd am Fenster und winkte ihnen zum Abschied zu. Irgendwie war es so, als würden sie den Tag sonst nicht überstehen, denn schlechte Laune hin oder her, das Gesicht ihrer Mutter hatte jedes Mal etwas von einem Sonnenstrahl.
»Marmee sollte uns eher mit der Faust drohen, als uns Kusshände zuzuwerfen – wir sind so ein undankbares Pack«, rief Jo und empfand eine gewisse Genugtuung, im bitteren Wind durch den Matsch stiefeln zu müssen.
»Benutz doch nicht immer solche schrecklichen Ausdrücke«, entgegnete Meg aus den Tiefen ihres Schals, in dem sie eingemummelt war wie eine Nonne, die vom weltlichen Dasein genug hat.
»Ich mag Begriffe, die stark und aussagekräftig sind«, erwiderte Jo und packte gerade noch rechtzeitig ihre Mütze, bevor sie ihr vom Kopf geweht und davongehüpft wäre.
»Bezeichne dich selbst, wie du willst. Ich bin aber weder schlimm noch undankbar, und ich möchte auch nicht so genannt werden.«
»Du bist ein ganz armes Kind, und nur deshalb so schlecht gelaunt heute, weil du nicht jeden Tag in Luxus schwelgen kannst. Armer Liebling! Warte nur, bis ich reich bin, dann kannst du dich nicht mehr retten vor Kutschen, Eiscreme, hochhackigen Schuhen, Blumensträußen und rothaarigen Tanzpartnern.«
»Du bist so albern!«, sagte Meg, aber sie lachte über diesen Blödsinn und fühlte sich wider Willen besser.
»Dein Glück! Wenn ich nämlich versuchen würde, genauso bedrückt und elend zu sein wie du, stünden wir alle dumm da. Gott sei Dank finde ich immer was Witziges, das mich bei der Stange hält. Jetzt hör auf zu jammern und komm mit guter Laune nach Hause, ja?«
Jo gab ihrer Schwester einen aufmunternden Klaps auf die Schulter, und sie trennten sich, um in entgegengesetzte Richtungen weiterzugehen. Beide drückten ihre warme kleine Teigtasche an sich und nahmen sich vor, trotz des winterlichen Wetters, der harten Arbeit und der unbefriedigten Lust auf jugendliche Vergnügungen fröhlich zu sein.
Als Mr March bei seinem Versuch, einem Freund finanziell aus der Patsche zu helfen, sein Vermögen verloren hatte, hatten ihn die beiden ältesten Mädchen angefleht, zumindest für den eigenen Unterhalt selbst sorgen zu dürfen. Da ihre Eltern der Meinung waren, dass man nicht früh genug damit anfangen konnte, Tatkraft, Fleiß und Unabhängigkeit zu lernen, hatten sie eingewilligt, und beide Mädchen hatten sich ins Erwerbsleben gestürzt, wacker und mit bestem Willen, der trotz aller Schwierigkeiten am Ende eigentlich immer mit Erfolg belohnt wurde. Margaret hatte eine Stelle als Gouvernante gefunden und fühlte sich mit ihrem kleinen Gehalt sehr wohlhabend. Wie gesagt war Luxus für sie etwas sehr ›Feines‹, und ihr größtes Problem war die Armut. Arm zu sein war für sie schwerer zu ertragen als für die anderen, da sie sich noch an eine Zeit erinnern konnte, als zu Hause alles sehr vornehm, das Leben leicht und fröhlich gewesen war und kein Mangel geherrscht hatte. Sie gab sich alle Mühe, nicht neidisch oder unzufrieden zu sein, aber es war ja nur normal, dass sich das Mädchen nach schönen Dingen, unbeschwerten Freundinnen, Erfolg und einem glücklichen Leben sehnte. Bei den Kings sah sie tagtäglich alles, was sie selbst haben wollte. Die älteren Schwestern der Kinder waren immer unterwegs, und Meg erhaschte ständig einen Blick auf zarte Ballkleider und üppige Sträuße und hörte angeregte Gespräche über Theater, Konzerte, Schlittenfahrten und allerlei Vergnügungen. Sie sah, wie kostbares Geld für Unwichtigkeiten verschwendet wurde. Die arme Meg klagte selten, aber die Ungerechtigkeit des Ganzen löste manchmal Bitterkeit in ihr aus. Sie hatte noch nicht erkannt, wie reich sie gesegnet war mit den Dingen, die das Leben eigentlich wertvoll machten.
Tante March indessen, die nicht gut zu Fuß war und jemand Tatkräftiges brauchte, um sie zu bedienen, hatte in Jo eine passende Kandidatin gefunden. Zu Beginn der finanziellen Misere der Marches hatte die kinderlose alte Dame vorgeschlagen, eines der Mädchen zu adoptieren, und sie war ziemlich gekränkt gewesen, als ihr Angebot abgelehnt wurde. Bekannte wiesen die Familie darauf hin, dass sie sich ihre Chancen gründlich vertan hätte, im Testament der reichen Dame genannt zu werden, doch die weltfremden Marches erwiderten darauf bloß:
»Nicht mal für das dutzendfache Vermögen würden wir unsere Mädchen hergeben. Ob reich oder arm, wir gehören zusammen und werden uns gegenseitig glücklich machen.«
Eine Zeitlang hatte die alte Dame kein Wort mehr mit den Marches gesprochen, doch als Jo ihr zufällig bei Bekannten über den Weg gelaufen war, hatte die alte Dame Gefallen an ihrem fröhlichen Gesicht und ihrer direkten Art gefunden und ihr eine Stelle als Gesellschafterin angeboten. Jo hatte das ganz und gar nicht gepasst, doch aus Ermangelung eines Besseren hatte sie die Stelle angenommen – und zu aller Verwunderung kam sie mit ihrer temperamentvollen Tante gut aus. Hin und wieder krachte es, und einmal war Jo nach Haus marschiert und hatte verkündet, sie halte es nicht länger bei ihr aus. Doch Tante March beruhigte sich stets schnell und hatte sie erneut mit solcher Dringlichkeit herbeigerufen, dass Jo nicht anders konnte.
Vermutlich war aber einfach die große Bibliothek voll wunderschöner Bücher zu verlockend, die seit dem Tod von Onkel March dem Staub und den Spinnen anheimfiel. Jo erinnerte sich gut an den freundlichen alten Herrn mit seinen Wörterbüchern, mit denen sie Eisenbahntrassen und Brücken bauen durfte, der ihr Geschichten zu den seltsamen Bildern in den lateinischen Büchern erzählte und ihr Lebkuchen kaufte, wann immer sie sich auf der Straße begegneten. Das schummrige, staubige Zimmer mit den Büsten, die von den hohen Regalen herabblickten, den gemütlichen Sesseln, den Weltkugeln und vor allem der Unmenge Bücher, zwischen denen sie nach Herzenslust umherstreifen konnte, war für Jo das Paradies auf Erden. Kaum dass sich Tante March aufs Ohr gelegt oder Besuch bekommen hatte, eilte Jo in diesen stillen Raum, machte es sich in dem dicken Sessel bequem und verschlang Gedichte, Romane, Geschichtsbücher, Reiseberichte und Bildbände wie ein echter Bücherwurm. Aber wie jedes Glück war auch dieses nie von langer Dauer, denn immer dann, wenn sie gerade bei der Schlüsselszene einer Geschichte, beim schönsten Vers oder brenzligsten Abenteuer ihres Reiseberichts angekommen war, rief eine schrille Stimme: »Jose-phine, Jose-phine!«, und sie musste ihr Himmelreich verlassen, um stundenlang Wolle aufzuwickeln, den Pudel zu waschen oder aus Belshams Essays vorzulesen.
Jo hatte den Ehrgeiz, irgendwann einmal etwas ganz Großartiges zu tun. Noch hatte sie keine exakte Vorstellung davon – doch die würde mit der Zeit kommen. Unterdessen machte es ihr furchtbaren Kummer, dass sie nicht so viel lesen, herumtollen und reiten konnte, wie sie wollte. Ihr hitziges Temperament, ihre spitze Zunge und ihr unruhiger Geist brachten sie immer wieder in Schwierigkeiten, und ihr Leben war ein Auf und Ab, mal lustig, mal traurig. Doch das, was sie bei Tante March lernte, war genau das, was sie brauchte, und der Gedanke, dass sie selbst für ihren Unterhalt aufkam, machte sie glücklich – trotz der ständigen Rufe ihrer Tante.
Beth war zu schüchtern, um zur Schule zu gehen. Man hatte einen Versuch gestartet, aber sie hatte so gelitten, dass man es aufgegeben hatte. Stattdessen lernte sie zu Hause bei ihrem Vater. Sogar als er wegging und ihre Mutter ihre ganze Energie und Fertigkeit in diverse Hilfsvereine für Soldaten steckte, setzte Beth in Eigenregie ihre Lektionen fort und gab ihr Bestes. Sie war ein häusliches kleines Geschöpf und half Hannah, das Zuhause für den arbeitenden Teil der Familie ordentlich und gemütlich zu machen, ohne jemals an irgendeinen Lohn zu denken. Sie wollte einfach nur geliebt werden. Ihre langen stillen Tage waren aber weder einsam noch müßig, denn ihre kleine Welt war voller imaginärer Freunde, und sie war von Natur aus fürsorglich. Es waren sechs Puppen, die jeden Morgen angezogen werden mussten, denn Beth war noch immer ein Kind und liebte ihr Spielzeug wie eh und je. Keine einzige Puppe war intakt oder schön anzusehen – es waren allesamt Außenseiter, die Beth anstelle von Amy, die nichts haben wollte, was alt oder hässlich war, von ihren Schwestern geerbt hatte. Doch gerade darum liebte Beth sie umso zärtlicher und machte sogar eine Puppenklinik auf. Niemals wurden sie mit Stecknadeln traktiert, niemals gab es Schimpfe oder gar Schläge. Selbst die Hässlichsten wurden geachtet und alle mit ungeteilter Zuneigung gefüttert und angezogen, gehegt und gepflegt. Ein besonders elendes Exemplar hatte einmal Jo gehört und war nach einem stürmischen Leben als Wrack im Flickenbeutel gestrandet. Aus diesem traurigen Armenhaus hatte sie Beth erlöst. Da die Puppe keine Schädeldecke mehr besaß, setzte Beth ihr ein hübsches Käppchen auf, und da ihr sowohl Arme als auch Beine fehlten, überspielte Beth diese kleinen Mängel, indem sie sie in eine Decke einschlug und der chronisch Kranken ihr bestes Bettchen gab. Hätte irgendjemand mitbekommen, mit wie viel Liebe diese kleine Puppe überhäuft wurde, wäre er – bei aller Belustigung – gerührt gewesen. Beth brachte ihr Blümchen, las ihr vor, nahm sie unter ihrem Mantel mit nach draußen an die frische Luft, sang ihr Wiegenlieder und ging nie zu Bett, ohne ihr einen Kuss auf das schmutzige Gesicht zu pflanzen und ihr liebevoll zuzuflüstern:
»Hoffentlich schläfst du gut, du arme Kleine.«
Beth hatte genauso ihre Sorgen wie alle anderen, und da auch sie kein Engel war, sondern ein sehr menschliches kleines Mädchen, ›verdrückte sie die eine oder andere Träne‹, wie Jo sagte, weil sie keine Musikstunden nehmen konnte, obwohl sie so gerne ein schönes Klavier gehabt hätte. Sie liebte die Musik so sehr, versuchte so eifrig zu lernen und übte so geduldig an dem klapprigen alten Instrument, dass man einfach zu der Überzeugung kommen musste, ihr helfen zu müssen (ohne Tante March zu behelligen). Aber niemand fand sich und niemand sah, wie Beth, wenn sie allein war, ihre Tränen von den immerzu verstimmten und vergilbten Tasten wischte. Bei der Arbeit trällerte sie wie eine kleine Lerche und wurde nie zu müde, Marmee und den Mädchen etwas vorzusingen. Jeden Tag sagte sie voller Zuversicht zu sich selbst: ›Ich muss nur brav genug sein, dann bekomme ich irgendwann mein Klavier, ganz bestimmt!‹
Es gibt viele Beths auf dieser Welt, die schüchtern und still in ihrer Ecke sitzen und warten, bis sie gebraucht werden, die sich unbemerkt solange freudig für andere aufopfern, bis eines Tages die kleine Grille auf dem Ofen aufhört zu zirpen und die liebe Sonne für immer versinkt und nichts als Stille und Schatten zurücklässt.
Wäre Amy nach ihrem größten Problem im Leben gefragt worden, hätte sie sofort erwidert: »Meine Nase.« Als Kleinkind war Amy von Jo aus Versehen in einen Kohleeimer fallengelassen worden, und sie beharrte darauf, dass ihre Nase dabei für immer ruiniert worden sei. Sie war nicht groß und rot wie die der armen ›Petrea‹, sie war nur ein bisschen flach geraten, doch alles Kneifen der Welt konnte ihr keine aristokratische Spitze geben. Niemand außer Amy störte sich daran, und sie wuchs, so gut sie konnte, doch Amy litt schwer unter der fehlenden griechischen Nase, und um sich zu trösten, zeichnete sie seitenweise edlere Exemplare.
»Klein-Raphael«, wie sie von den Schwestern genannt wurde, hatte ein ausgesprochenes Talent fürs Zeichnen und war nie glücklicher als beim Skizzieren von Blumen oder Elfen oder beim farbenfrohen Illustrieren von Geschichten. Ihre Lehrer klagten, dass ihre Schiefertafel voller Tiere statt Rechenaufgaben sei, auf den leeren Seiten ihres Atlasses wurden Landkarten kopiert, und Karikaturen der aberwitzigsten Art kamen in unpassenden Momenten aus all ihren Schulbüchern geflattert. Sie mogelte sich durch ihre Schulstunden und schaffte es, unbestraft zu bleiben, indem sie ein beispielhaftes Betragen an den Tag legte. Sie war sehr beliebt bei ihren Schulkameradinnen, da sie freundlich war und die Kunst beherrschte, mühelos zu gefallen. Ihre kleinen Marotten und Talente wurden ebenso bewundert wie ihre Erfolge, denn neben ihrem zeichnerischen Talent konnte sie zwölf Lieder spielen, häkeln und einen französischen Text lesen, ohne mehr als zwei Drittel der Wörter falsch auszusprechen. Sie sagte gerne etwas leidend: ›Als Papa noch reich war, haben wir immer dieses und jenes gemacht‹, was sehr anrührend war, und ihre gedehnten Wörter wurden von den Freundinnen als ›äußerst elegant‹ bezeichnet.
Amy war auf bestem Wege, sich in ein verwöhntes Gör zu verwandeln, denn alle schmierten ihr Honig um den Mund, so dass ihre kleinen Eitelkeiten und ihr Egoismus wuchsen und gediehen. Eine Sache stellte sich ihrer Eitelkeit jedoch entgegen: Sie musste die Kleider ihrer Cousine auftragen. Nun war es aber so, dass die Mutter von Florence nicht einen Hauch von Geschmack besaß, und Amy litt fürchterlich, eine rote statt einer blauen Haube, unvorteilhafte Kleider und blöde Rüschenschürzen tragen zu müssen, die nicht mal passten. Die Sachen waren gepflegt, von guter Qualität und fast neu, doch Amys künstlerisches Auge wurde sehr strapaziert – vor allem diesen Winter, da ihr Schulkleid matt lila mit gelben Punkten und ohne Spitzenbesatz war.
»Mein einziger Trost«, sagte sie zu Meg mit Tränen in den Augen, »ist, dass Mutter meine Kleider nicht kürzt wie die Mutter von Maria Parks. Meine Güte, das ist so schrecklich. Manchmal ist sie so böse, dass ihr das Kleid bis zu den Knien geht, und dann kann sie nicht in die Schule. Wenn ich an diese Erniederigung denke, hab ich das Gefühl, selbst meine flache Nase und mein gelbgekleckstes lila Kleid ertragen zu können.«
Meg war Amys Vertraute und Beschützerin, und aufgrund jener seltsamen Anziehung von Gegensätzen war Jo die Vertraute der sanftmütigen Beth. Nur ihrer Jo erzählte das scheue Kind von ihren Gedanken; und sie übte auf ihre tollkühne große Schwester unbewusst mehr Einfluss aus als sonst jemand in der Familie. Die beiden älteren Mädchen waren einander sehr zugetan, doch jede nahm eine der jüngeren Schwestern unter ihre Fittiche und passte auf ihre besondere Art auf sie auf. Mit dem Mutterinstinkt kleiner Frauen legten sie ihre Puppen beiseite und sorgten stattdessen für ihre jüngeren Schwestern.
»Hat jemand was zu erzählen? Heute war ein so trüber Tag, dass ich dringend was zum Lachen brauche«, sagte Meg, als sie an jenem Abend zusammensaßen und nähten.
»Ich hatte ein seltsames Erlebnis mit unserer Tante, aber da es für mich gut ausging, kann ich dich damit unterhalten«, begann Jo, die für ihr Leben gerne Geschichten erzählte. »Ich war gerade dabei, ihr aus diesem endlosen Belsham vorzulesen, wie immer sehr monoton, denn Tante March schläft immer gleich ein, und dann nehme ich mir irgendein schönes Buch und lese wie verrückt, bis sie wieder aufwacht. Dieses Mal wurde ich vom Lesen selbst schläfrig, und bevor sie einnickte, musste ich so gähnen, dass sie mich fragte, was das soll, den Mund so weit aufzureißen, dass ich gleich das ganze Buch verschlingen könnte.
›Ich wünschte, ich könnte es, dann wär die Sache endlich gegessen‹, sage ich, und ich wollte wirklich nicht frech sein. Doch sie hält mir einen langen Vortrag über meine Sünden, und ich solle stillsitzen und darüber nachdenken, während sie sich mal eben ›verliert‹. Bis sie sich wiederfindet, kann es dauern – und kaum, dass ihre Haube anfängt zu wippen wie eine kopflastige Dahlie, zaubere ich den Pfarrer von Wakefield aus meiner Tasche und beginne draufloszulesen, ein Auge auf dem Pfarrer, ein Auge auf Tante March. Gerade komme ich an die Stelle, in der sie ins Wasser stürzen, da lache ich aus Versehen laut auf. Tante March erwacht. Aber weil sie nach ihrem Schläfchen immer besser gelaunt ist, bittet sie mich, ihr ein bisschen aus dem Buch vorzulesen und ihr zu zeigen, welches frivole Werk ich dem würdigen und lehrreichen Belsham vorziehe. Ich gebe mir alle Mühe, und es gefällt ihr, auch wenn sie nur sagt … ›Ich versteh nicht, worum es geht. Fang von vorne an, Kind.‹
Gesagt, getan. Ich mache die Primroses so interessant wie nur möglich. Einmal bin ich so gemein und höre an einer spannenden Stelle auf zu lesen und frage vorsichtig: ›Ich fürchte, es ermüdet dich, Tante March. Soll ich lieber aufhören?‹ Da nimmt sie ihr fallengelassenes Strickzeug wieder in die Hand, wirft mir durch ihre Brille einen scharfen Blick zu und meint auf ihre knappe Art: ›Lies das Kapitel zu Ende, und werde mir nicht frech, Fräulein.‹«
»Hat sie zugegeben, dass es ihr gefallen hat?«, fragte Meg.
»Oh nein, um Gottes Willen! Aber sie ließ den alten Belsham ruhen. Und als ich nachmittags noch mal zurückgelaufen bin, um meine Handschuhe zu holen, saß sie da und war so vertieft in den Pfarrer, dass sie gar nicht mitbekam, wie ich gelacht und in der Vorhalle ein kleines Tänzchen aufgeführt habe, wegen der guten Zeiten, die auf mich zukommen. Was für ein schönes Leben sie haben könnte, wenn sie nur wollen würde! Ich beneide sie nicht besonders, trotz ihres Geldes. Ich nehme an, am Ende haben reiche Leute genauso viele Sorgen wie arme.«
»Apropos«, sagte Meg, »ich hab auch was zu erzählen. Es ist nicht lustig wie Jos Geschichte, aber auf dem Heimweg musste ich noch lange drüber nachdenken. Heute bei den Kings waren alle in heller Aufregung, und eines der Kinder sagte, der älteste Bruder hätte irgendwas Schlimmes angestellt und Papa hätte ihn rausgeworfen. Ich hörte Mrs King weinen und Mr King sehr laut sprechen, und Grace und Ellen schauten zur Seite, als sie an mir vorbeikamen, damit ich ihre verweinten Augen nicht sehen konnte. Natürlich hab ich keine Fragen gestellt, aber sie taten mir schrecklich leid und ich war fast froh, dass ich keine wilden Brüder habe, die schlimme Sachen machen und die Familie entehren.«
»Ich finde, in der Schule in Ungnade zu fallen ist viel aufreibenderer als alles, was freche Jungen anstellen können«, sagte Amy kopfschüttelnd und schöpfte aus den Tiefen ihrer Lebenserfahrung. »Susie Perkens kam heute mit einem schönen roten Karneol-Ring in die Schule. Diesen Ring hätte ich furchtbar gern gehabt. Ich hab mir so gewünscht, an ihrer Stelle zu sein. Na ja, sie hat eine Karikatur von Mr Davis gemacht, mit riesengroßer Nase und Buckel und Sprechblase, in der stand: ›Meine Damen, ich sehe alles!‹. Wir lachten gerade darüber, als er plötzlich tatsächlich alles sah, und Susie musste mit ihrer Schiefertafel nach vorne kommen. Sie war vor Angst fast parrilisiert, aber sie ist hingegangen, und was glaubt ihr, was er gemacht hat? Er hat sie am Ohr gepackt – am Ohr! Das müsst ihr euch mal vorstellen! – und zum Lehrerpodest gezerrt, wo sie eine halbe Stunde lang dastehen und ihre Schiefertafel so halten musste, dass alle sie sehen konnten.«
»Haben die Mädchen denn nicht über das Bild gelacht?«, fragte Jo, die von dem Vorfall entzückt war.
»Gelacht? Keine einzige. Sie saßen mucksmäuschenstill, und Susie hat sich die Augen aus dem Kopf geheult, das konnte ich sehen. Da hab ich sie überhaupt nicht mehr beneidet, sondern mir gedacht, dass mich danach nicht mal tausend Karneol-Ringe hätten trösten können. Niemals, niemals wäre ich über eine so hochrotpeinliche Herabwürdigung hinweggekommen.« Und Amy fuhr mit ihrer Arbeit fort, im stolzen Bewusstsein ihrer Tugendhaftigkeit und der zwei äußerst schwierigen Wörter, die sie in einem Atemzug verwendet hatte.
»Heute Morgen habe ich was Schönes gesehen, und ich wollte es schon beim Essen erzählen, aber da hatte ich es vergessen«, sagte Beth, die gerade dabei war, in Jos Handarbeitskorb für Ordnung zu sorgen. »Als ich für Hannah Austern besorgen sollte, war Mr Laurence im Fischladen, aber er konnte mich nicht sehen, weil ich hinter einem Fass stand, während er mit Mr Cutter, dem Verkäufer, redete. Eine arme Frau kam mit Eimer und Putzzeug in den Laden und fragte, ob sie für ein bisschen Fisch den Boden schrubben könne. Sie habe nichts zu essen für ihre Kinder und heute keine Arbeit bekommen. Mr Cutter war sehr beschäftigt und sagte ziemlich mürrisch ›Nein‹. Also wollte sie wieder gehen, hungrig und traurig, doch da hat Mr Laurence mit dem krummen Ende seines Spazierstocks einen großen Fisch geangelt und ihn ihr hingehalten. Sie war so glücklich und überrascht, dass sie den Fisch in die Arme nahm und sich tausendmal bei Mr Laurence bedankt hat. ›Dann mal ab an den Herd‹, sagte er, und sie rannte sofort los, sie war überglücklich! War das nicht nett von ihm? Und sie sah so lustig aus, wie sie diesen großen glitschigen Fisch an sich drückte und Mr Laurence ›Gott segne Sie‹ zurief.«
Nachdem sie über Beths Erzählung gelacht hatten, baten sie ihre Mutter um eine Geschichte. Nach kurzer Überlegung sagte sie ernst:
»Als ich heute in den Räumlichkeiten unseres Vereins saß und blaue Flanelljacken zuschnitt, überkam mich eine große Angst um Vater, und ich dachte daran, wie einsam und hilflos wir wären, wenn ihm etwas zustoßen würde. Das war nicht besonders klug von mir, aber ich sorgte mich immer mehr, bis ein alter Mann eintrat, der ein paar Sachen brauchte. Er setzte sich zu mir, und ich fing ein Gespräch mit ihm an, weil er so arm, müde und besorgt wirkte.
›Haben Sie Söhne in der Armee?‹, fragte ich, denn der Brief, den er dabei hatte, war nicht für mich.
›Ja, Ma’am. Ich hatte vier Söhne, aber zwei sind gefallen, einer ist in Gefangenschaft, und ich fahre jetzt zu dem anderen, der schwer krank in Washington im Krankenhaus liegt‹, erwiderte er mit ruhiger Stimme. ›Sie haben viel für Ihr Land getan, Sir‹, sagte ich, jetzt mit Hochachtung statt Mitleid. ›Keinen Deut mehr, als sich’s gehört, Ma’am. Ich würde ja selbst in den Kampf ziehen, wenn ich noch zu was nutze wäre. Da ich’s nicht bin, gebe ich mit freien Stücken meine Jungen.‹ Er sprach so gefasst, wirkte so aufrichtig und schien so glücklich darüber, alles zu geben, was er hatte, dass ich mich geschämt habe. Ich hatte an einen einzigen Mann so viele Gedanken verschwendet, während er ohne Groll gleich vier Männer hergegeben hatte. Ich hatte all meine Mädchen zu Hause, um mich zu trösten, und sein letzter Sohn wartete in der Fremde auf ihn, um vielleicht für immer von ihm Abschied zu nehmen! Ich fühlte mich so reich, so glücklich in dem Wissen, wie gesegnet ich war, dass ich ihm ein schönes Bündel schnürte und ihm für das dankte, was ich von ihm gelernt hatte.«
»Erzähl uns noch eine Geschichte, Mutter. Mit einer Moral, so wie diese. Ich lasse sie mir danach immer gern noch mal durch den Kopf gehen, das heißt, wenn sie echt ist und nicht zu sehr wie eine Predigt klingt«, sagte Jo nach kurzem Schweigen.
Mrs March lächelte und legte sofort los. Sie erzählte diesem kleinen Publikum schon seit langem Geschichten und wusste genau, was ihm gefiel.
»Es waren einmal vier Mädchen, die alle genug zu essen, zu trinken und anzuziehen hatten. Sie hatten ein gutes und leichtes Leben mit Freunden und Eltern, die sie sehr lieb hatten. Dennoch waren sie unzufrieden.« (Hier warfen sich die Zuhörerinnen verstohlene Blicke zu und begannen, angestrengt zu nähen.) »Diese Mädchen wollten unbedingt brav sein und nahmen es sich fest vor, schafften es aber irgendwie nicht so richtig, sich an ihr Vorhaben zu halten und sagten ständig: ›Hätten wir nur dieses‹ oder ›Könnten wir doch nur jenes tun‹. Darüber vergaßen sie, wie viel sie schon besaßen und wie viel schöne Dinge sie schon unternehmen konnten. Also baten sie eine alte Frau um einen Zauberspruch, der sie glücklich machen sollte, und die Frau sagte: ›Wenn ihr unzufrieden seid, denkt darüber nach, wie gut ihr es habt und seid dankbar.‹« (An dieser Stelle schaute Jo abrupt hoch, als wollte sie etwas sagen, besann sich aber, da sie merkte, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war.)
»Da es vernünftige Mädchen waren, beschlossen sie, den Rat der Frau zu befolgen, und sie erkannten bald, wie gut es ihnen ging. Eine stellte fest, dass auch Geld nicht half, die Reichen vor Schande und Trauer zu bewahren; eine andere begriff, dass sie zwar arm war, doch mit ihrer Jugend, ihrer Gesundheit und ihrem Optimismus besser dran war als eine gewisse unleidliche, gebrechliche alte Dame, die nicht imstande war, ihren Wohlstand zu genießen; eine dritte erkannte, dass es vielleicht mühsam war, beim Essenmachen zu helfen, aber dass es weitaus anstrengender wäre, dafür betteln gehen zu müssen; und die vierte sah ein, dass selbst Karneol-Ringe nicht so wertvoll waren wie gute Manieren. Also einigten sie sich, weniger zu klagen und stattdessen das zu genießen, womit sie bereits gesegnet waren. Sie wollten sich ihres Glückes würdig erweisen, damit es ihnen nicht genommen würde, sondern sich stattdessen mehrte. Ich glaube, sie waren nie enttäuscht oder traurig darüber, dass sie den Rat der alten Frau angenommen hatten.«
»Also, Marmee, das ist wirklich sehr gewieft von dir, unsere eigenen Geschichten gegen uns zu verwenden und sie in eine Predigt zu packen!«, rief Meg.
»Ich mag diese Art von Predigt. So etwas Ähnliches hat Vater uns auch immer erzählt«, sagte Beth nachdenklich und ordnete Jos Nadelkissen.
»Ich beschwere mich längst nicht so viel wie die anderen, und ich werde achtsamer sein als je zuvor. Susies Niedergang ist mir ein Beispiel gewesen«, sagte Amy rechtschaffen.
»Wir haben diese Lektion gebraucht und werden sie nicht so schnell vergessen. Und wenn doch, sag uns einfach dasselbe wie Tante Chloe aus Onkel Toms Hütte: ›Wir wollen an Gottes Gnade denken‹«, fügte Jo hinzu, die der Versuchung nicht widerstehen konnte, sich ein kleines bisschen über die kurze Predigt lustig zu machen, auch wenn sie sich diese genauso zu Herzen nahm wie die anderen.