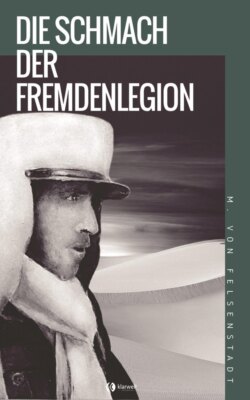Читать книгу Die Schmach der Fremdenlegion - M. von Felsenstadt - Страница 9
6. Kapitel. Transport der neuen Legionsrekruten.
ОглавлениеAm anderen Morgen frühzeitig ertönte der Weckruf, der sämtliche Legionsrekruten zusammenrief, damit sie sich im Kasernenhof zum Abmarsch aufstellten. Der Rapport war schon am Abend zuvor erfolgt, wobei ein deutsch sprechender Korporal des Meldebureaus für die der Mehrzahl nach aus Deutschen bestehenden neuen Legionäre den Dolmetscher machte.
Auch jetzt war dieser Dolmetscher zugegen und vermittelte beim Appell die Befehle. Jeder der zum Transport bereitstehenden Rekruten erhielt von einem Sergeanten drei Franken, die sogenannten Tagegelder, als Reisezehrung für die Fahrt nach Marseille, einer französischen Hafenstadt am Mittelländischen Meere.
Der diensthabende Unteroffizier der Kaserne brachte den Gefesselten aus dem prison, der scheu und gedrückt erschien, für den tiefer blickenden Menschenkenner aber etwas Lauerndes, Raubtierartiges in seinen brutalen, ordinären Gesichtszügen zeigte. Die Fesseln wurden ihm jetzt abgenommen, und auch er erhielt seine drei Franken, die übliche Wegzehrung, die jedem Legionsrekruten eingehändigt wird, ob er nun noch etwas eigenes Geld besitzt oder nicht. Denn da die letzteren, das heißt also die Nichtsbesitzenden, in der weit überwiegenden Mehrzahl sind, die Transportierten sich aber auf der langen Eisenbahnfahrt bis Marseille selbst zu beköstigen haben, weil daselbst erst die eigentliche Kasernenverpflegung beginnt, so hat die französische Regierung in einem Rest menschenfreundlicher Fürsorglichkeit für ihre angehenden Vaterlandsverteidiger in den afrikanischen Kolonien diese Einrichtung getroffen. Ein Akt der Fürsorge, der allerdings auch durch die praktische Notwendigkeit geboten ist und sich in anderer Weise vielfältig bezahlt macht, wie sich später noch zeigen wird.
Nachdem die Legionsrekruten solcher Art zur Reise vorbereitet worden waren, wobei dem Sträfling dieser Nacht noch durch den Dolmetscher eine kräftige Vermahnung zuteil geworden, die er augenscheinlich mit verbissenem Ingrimm hinnahm, trat einer jener die deutsche Sprache radebrechenden französischen Korporale herzu, der beordert war, die Kolonne unter seine Obhut zu nehmen und nach Marseille zu eskortieren.
Obgleich das Militärbillett jedes einzelnen Rekruten diesen aufs deutlichste als angehenden Fremdenlegionär kennzeichnet, so dass eine Desertion mit solchem Billett eigentlich eine absolute Unmöglichkeit wäre, so pflegt man dennoch die Rekrutentransporte nie ohne militärische Begleitung reisen zu lassen.
So saßen denn nun die neuen Legionäre dichtgedrängt in einem wohl eigens für solche Zwecke eingestellten besonderen Wagen beisammen, während der begleitende Korporal in den den Wagen an beiden Längsseiten umgebenden Außengängen auf und ab wandelte, seine Zigarette rauchend und dabei ab und zu durch das Fenster noch seinen Pflegebefohlenen lugend. Die Rekruten rauchten übrigens ebenfalls, soweit sie im Besitz von Tabak und der üblichen Stummelpfeife waren, oder gar Zigarren oder Zigaretten ihr eigen nannten. Das Rauchen ist den auf dem Transport befindlichen Legionsrekruten gestattet. Besser aber wäre es vielleicht, wenn dies nicht der Fall wäre, weil hier bei der engen Gemeinschaft von Besitzenden, die in der Minderzahl, und Besitzlosen, die in der Mehrheit waren, dem Neid, der Missgunst und oft noch schlimmeren Fehlern und Lastern Eingang gewährt wird.
Binnen kurzem sollte dies mit überraschender Deutlichkeit zutage treten.
Neben Edmund Gebhardt, der natürlich unter den Nichtrauchern war, saß ein biederer, dicker Oberbayer, der aus seiner kurzen Pfeife wie ein Schornstein qualmte.
Vielleicht glaubte er aus Edmunds Blicken ein Verlangen herausgelesen zu haben; vielleicht auch war es nur eine gutmütige Regung, als er sich auf einmal ganz unvermittelt seinem jüngeren Nachbar zuwandte.
„Willst an Tobak?“ fragte er freundlich, dem Angeredeten seinen wohlgefüllten Beutel präsentierend. „Nimm der halt! ’s langt schu“, ermunterte er, als jener zögerte.
„Ich habe keine Pfeife“, sagte Edmund, mit Dank ablehnend.
Sofort trat von der anderen Seite, wie aus der Erde gewachsen, wieder der ältere der beiden Hamburger heran, ihm zwei dem Aussehen und Geruch nach recht gute Zigarren darbietend.
„Nehmen Sie nur. Ich habe Vorrat“, drang er in den jungen Kameraden, der sich denn auch nicht weiter nötigen ließ. Ehe er aber noch die Hand nach der gebotenen Labung ausstrecken konnte, langte plötzlich mit Taschenspielergewandtheit ein zerlumptes Individuum von unten herauf darnach, die beiden so heißbegehrten Glimmstängel mit einem einzigen raschen und sicheren Griff an sich reißend. Bevor die beiden Verdutzten sich von ihrem Staunen erholt hatten, war das Kerlchen, das mehr verkommen als bösartig aussah, mit der willkommenen Beute enteilt.
Der Hamburger, der eine rasche Selbstjustiz zu lieben schien, schickte sich an, den Spitzbuben zu verfolgen, um ihm seinen Raub wieder zu entreißen. Aber Edmund, diese Absicht erratend, hinderte ihn daran, indem er seine Hand auf des Kameraden Arm legte.
„Lassen Sie ihn“, bat er. „Meinetwegen sollen Sie sich nicht mit diesem Gesindel herumschlagen. Ich kann gut und gern entbehren, was ich nicht habe. Wer weiß, wie lange der Strolch da sich nach solchem Genuss gesehnt hat.“
Er hatte leise gesprochen, um kein Aufsehen zu erregen. Ebenso leise erfolgte die Antwort des Hamburgers.
„Mag sein!“ entgegnete er unmutig, nach jener Seite des Wagens blickend, wo jetzt der Zerlumpte verstohlen seinen Schatz mit wohlgefälligem Schmunzeln in Brand zu setzen begann. „Mag sein! Der Lump braucht aber nicht meine guten Zigarren zu rauchen!“
„Wenn das nur die einzigen schlimmen Erfahrungen wären, die wir mit unseren neuen Kameraden machen, dann könnten wir immer noch zufrieden sein“, meinte Edmund besorgt in noch leiserem Flüstertone. „Ich fürchte, dass wir da unter eine ganz verkommene, rohe Spitzbubengesellschaft geraten sind, die uns noch manches zu raten geben wird.“
Der Andere nickte nur.
„Es scheint so!“ erwiderte er lakonisch.
So leise sie aber auch gesprochen hatten, der Bayer hatte die geheime Zwiesprache doch gehört.
„Do hobt’s recht“, mischte er sich drein in seiner derben, urwüchsigen Art. „Do hobt’s recht! Dös hob i halt a schu g’murkt, dass dös an ruppiget Viechsg’sellschaft nun Minschen is, wos do zu d’ Legion will!“
Dabei paffte er mit fast komisch wirkendem Zorn seine kurze Stummelpfeife, dass sein Gesicht mit der betrübten Grimasse bald hinter dichten Rauchwolken völlig verschwand. Edmund reichte dem Hamburger dankend die Hand, und dieser erwiderte den Druck derselben so kräftig, dass der also Begrüßte, obschon auch er einen festen Händedruck liebte und keineswegs verweichlicht war, beinahe laut aufgeschrien hätte.
„Wenn wir wenigstens zu einem Korps kämen, Sie und Ihr Herr Bruder“, sagte der Jüngling herzlich.
Der Andere nickte. „Wir sind nicht Brüder, nur Vettern“, erklärte er dabei. „In Marseille, wenn wir mal unter vier Augen sind, erzähl’ ich Ihnen, was ich noch keinem anvertraut.“ Sprach’s und drehte sich um, still seinen Platz im Wagen wieder aufsuchend. — Inzwischen rasselte der Zug rastlos weiter, den ganzen Tag und die darauffolgende Nacht hindurch fahrend. Endlich, als der neue Morgen zu grauen begann, langte der Transport der neuen Legionsrekruten auf dem Bahnhofe in Marseille an.
Auf dem Bahnsteig stand schon ein Sergeant zum Empfang der ankommenden „Blauen“ bereit, dem noch ein Korporal auf dem Fuße folgte, und diese drei Vorgesetzten, von denen nur der eine, der die Kolonne hertransportiert hatte, leidlich deutsch sprechen konnte und somit fürs erste die Verständigung herstellte, führten nun die dem Zuge Entsteigenden, „die Blauen“ genannt, dem Fort St. Jean als ihrem einstweiligen Bestimmungsorte zu.
„Les bleus“ („die Blauen“) ist der Spitzname, der den neuankommenden Legionsrekruten von Seiten der älteren Legionäre beigelegt zu werden pflegt. Derselbe soll nach einer alten Überlieferung daher rühren, dass in früheren Zeiten die französischen Soldaten steife Halsbinden getragen haben, die den hohen Uniformkragen gerade zu halten bestimmt waren, wodurch Kopf und Hals des Trägers wie in einem Schraubstock zusammengepresst wurden. Die dieser Marter ungewohnten neueingestellten Rekruten waren durch die furchtbare Pressung. die keinerlei freie Bewegung des Kopfes gestattete, in der ersten Zeit, von Blutstockungen heimgesucht, meist ganz blau im Gesicht geworden. In einer Art von Schadenfreude, dass jetzt diese Neuen dasselbe leiden mussten, was sie selbst einst ertrugen, riefen ihnen, dies bemerkend, die altgedienten Mannschaften spottend zu: „Voila! les bleus — les bleus! —“ („Sehet da! die Blauen! die Blauen! —“) Diese Bezeichnung hat sich später speziell auf die Legionsrekruten verpflanzt, und ist ihnen erhalten geblieben bis auf den heutigen Tag. So auch hier. Als die Kolonne der einrückenden Rekruten, angeführt von dem Sergeanten und den beiden Korporalen, den Hafen entlang, in ihren zum Teil beschmutzten und defekten, oft geradezu zerlumpten Zivilanzügen nach dem Fort St. .Jean marschierte, da riefen auch diesen angehenden Legionären vorübergehende Zivilisten sowohl als die hier und da in Trupps zusammenstehenden, aus den verschiedensten Elementen zusammengewürfelten Mannschaften spottend entgegen: „Voila! — les bleus pour la légion!“ („Sehet da! — die Blauen für die Legion! —“) Ein wunderbares Panorama breitete sich aus vor den Blicken der einrückenden Rekruten, als sie an dem herrlichen Marseiller Hafen entlang marschierten.
Voilà les bleues.
Es musste mit seinen wechselnden Bildern die Ankommenden für vieles entschädigen, was sie verloren, und was ihnen noch Schweres und Kummervolles bevorstand. Es war für lange Zeit der letzte schöne und freie Ausblick. Allerdings waren es wohl nur sehr wenige, nur ganz vereinzelte empfängliche Gemüter, die Sinn und Verständnis dafür besaßen.
Edmund gehörte zu diesen Wenigen. Mechanisch marschierte er dahin, im Anschauen und Sinnen verloren. — Welches Schicksal mochte seiner warten? — Ging er unrettbar seinem Verderben entgegen? Fand er ein unrühmliches, unbekanntes Grab in fremder Erde? — Oder hatte ihm ein freundliches Geschick ein besseres Los beschieden? Würde es ihm gelingen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und zu besiegen, und sich eine neue, glückliche Zukunft zu begründen? —
Der unüberwindliche Optimismus der Jugend wollte immer wieder durchbrechen und ihm trotz der augenblicklichen, keineswegs verlockenden Zukunftsaussichten das letztere zuflüstern. —
So ging es dahin durch eine wimmelnde Menschenmasse, aus aller Herren Ländern hier zusammengewürfelt, die sich in wahrhaft babylonischem Sprachengewirr überall hier unterhielten, lachten, plauderten, oder auch schrien, zankten und eiferten.
Dazu der Blick auf den Hafen selbst, mit seiner endlosen Menge der verschiedensten Schiffe, die hart aneinandergedrängt lagen, unter denen die elegantesten Salonschiffe, wahre Luxusbauten, ebenso wenig fehlten, als die grobgezimmerten Arbeitsbarken und Handelsschiffe der braunen Levantiner, die schreiend und heftig gestikulierend mit Ausladen ihrer Waren beschäftigt waren. Segelschiffe aller Art zogen in ihrer ehrwürdigen Ruhe dahin — alles in allem ein Bild von wahrhaft überwältigender Größe und Mannigfaltigkeit!
Überall aber blieben die Blicke an den vorbeimarschierenden Legionsrekruten haften, und Mitleid, Spott, mitunter auch unsägliche Verachtung — das waren die Empfindungen, die sich je nach Charakter, Art und Wesen, sowie nach der Menschenrasse der Begegnenden auf ihren Gesichtern widerspiegelten.
Edmund marschierte an der Seite der beiden Vettern, seiner neuen Freunde. Gleichwohl wusste er auch von ihnen noch nichts weiter, als dass sie sich anständiger betrugen, dass ihre Kleidung in besserem Zustande sich befand, als dies bei der Mehrzahl der neuen Kameraden der Fall war, die in einer solchen schmutzigen, zerlumpten Verfassung, in einer Bekleidung einhertrotteten, die oft kaum noch den Namen „Kleidung“ verdiente, deren rohe, verlebte und verkommene Züge zum Teil den Stempel des Lasters, ja des ausgeprägten Verbrechertums so deutlich zur Schau trugen, dass die Verachtung begreiflich wurde, die den Soldaten der Fremdenlegion überhaupt, insbesondere den neuangeworbenen Rekruten, die in der überwiegenden Mehrheit den Abschaum der Menschheit, den Auswurf der Taugenichtse aller Länder und Völker verkörperten, hier zuteilwurde. Das bessere Element, das entschieden in der Minderheit und darum gewiss umso bedauernswürdiger war, konnte das allgemeine Urteil so wenig beeinflussen, dass sich vielmehr die Missachtung, die offenbare Geringschätzung, mit der die Fremdenlegionäre behandelt zu werden pflegen, auf sie ebenso erstreckte als auf den eigentlichen Tross der Legionsrekruten.
Diese Missachtung und Geringschätzung, die feinfühlige Naturen, wie die Edmunds, in denen noch nicht alles Ehrgefühl, alle Selbstachtung erstickt und ertötet war, zur Verzweiflung bringen musste, fand auf Fort St. Jean, wohin die neuen Legionsrekruten von den drei Vorgesetzten jetzt geführt wurden, ihren Gipfelpunkt. Dies sollten Edmund und die beiden Hamburger Vettern, die so ziemlich die einzigen anständigeren Elemente der Einrückenden darstellten, alsobald erfahren.