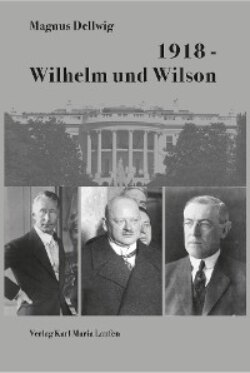Читать книгу 1918 - Wilhelm und Wilson - Magnus Dellwig - Страница 11
5 Neujahr
ОглавлениеDas Jahr 1918 begann für mich mit einem eindrucksvollen Gespräch, das ich für mein Leben - so kurz es vielleicht von hier aus der Charité betrachtet auch nur noch sein mag - niemals wieder vergessen werde! Seine kaiserliche Hoheit, Kronprinz Wilhelm ließ mir durch seinen Adjutanten Major von Müller bei der von ihm befehligten Heeresgruppe “Deutscher Kronprinz” am 2. Januar persönlich mitteilen, er wünsche vor seiner Abreise an die Front eine persönliche Unterredung. Diese habe unter vier Augen und ausdrücklich nicht im Berliner Stadtschloss, sondern auf Schloss Cecilienhof in Potsdam, dem Wohnsitz der Familie Wilhelms vor den Toren der Residenz Berlin statt zu finden. Ich war natürlich verwundert. Uns blieben nur zwei Tage. Ich sagte ohne Zögern für den darauf folgenden Tag zu. Adjutant von Müller zeigte sich erleichtert. Er erklärte, seine kaiserliche Hoheit sei sich dessen gewiss gewesen, sich auf mich verlassen zu können. Der Kronprinz lade für den 3. Januar um 15 Uhr zum Tee. In der anschließenden Nacht schlief ich schlecht. Ich kam nicht zur Ruhe, weil meine Gedanken um die Frage kreisten, welche äußeren Ereignisse so bedeutsam sein konnten, dass sie seine Hoheit veranlassten, sich in großer Eile mit dem Vorsitzenden der größten vaterländisch gesinnten Reichstagsfraktion zu treffen, heimlich und allein. Natürlich stellte ich Spekulationen an, die mich nicht gerade in einen Zustand der Beruhigung versetzten. Sollte die Front wanken? Gäbe es eine neue Qualität bei der Auflösung aller staatlichen Autorität in Russland oder endlich die Einwilligung der bolschewistischen Revolutionäre in einen Frieden nach unseren Vorstellungen? Gab es vielleicht aber ein Zerwürfnis zwischen der Obersten Heeresleitung und dem Reichskanzler? Graf Hertling war zwar als Nachfolger von Michaelis erst seit dem 1. November im Amt, aber was hieß das schon in diesen Zeiten? In Berlin ging in einschlägigen Kreisen von Abgeordneten und Presse, von Ministerialbürokratie und den Verbandsvertretern der Wirtschaft das Gerücht um, Hindenburg und Ludendorff verlange es nach dem uneingeschränkten Primat der militärischen vor der zivilen Führung in allen Angelegenheiten von Krieg und Frieden. Eine solche Bankrotterklärung des Reichskanzlers hätte ich als schweren Fehler, als Selbstaufgabe der Politik empfunden. Stattdessen war ich immer mehr davon überzeugt, dass es die ureigene Verantwortung des Reichstags werde, durch eigene Anstrengungen und solidarische Kreativität mit dem Hause Hohenzollern und damit auch mit der von ihm eingesetzten zivilen Reichsleitung den Frieden zu erringen. Ob es dagegen die ureigene Fähigkeit Ludendorffs und seiner Männer in Spa sein sollte, die Weltlage und die Strömungen in Deutschland politisch richtig einzuschätzen, daran waren mir doch im abgelaufenen Jahr 1917 immer größere Zweifel gekommen. Schließlich hatte sich die Entente allen Versprechungen zum Trotz weder aufgelöst noch hatte ihre Kampfkraft merklich gelitten, sondern mit Hilfe der Amerikaner war die Entente sogar gefestigt aus dem Kriegsjahr 1917 hervorgegangen.
Was es auch immer war, das der Kronprinz mit mir erörtern wollte. Als mich die von ihm geschickte Limousine am 3. Januar um 14 Uhr zu Hause abholte, betrachtete ich es als meine heilige vaterländische Pflicht ihm zu helfen so gut es in meinen Möglichkeiten liegen sollte. Auf dem Weg nach Potsdam durchquerten wir Steglitz, Dahlem und Zehlendorf, kamen an immer noch weihnachtlich geschmückten Schaufenstern und hell erleuchteten Gaststätten vorbei. Natürlich reichte die Pracht und Vielfalt der Auslagen nicht an Friedenszeiten heran. Dennoch nahm ich sehr bewusst auf, wie lebenswert Berlin, ja ganz Deutschland trotz aller Not, trotz des Mangels an Lebensmitteln und Brennstoff für die Mehrzahl der einfachen Menschen weiterhin war, selbst im vierten Kriegsjahr geblieben war. Ich als Fraktionsvorsitzender der Nationalliberalen trug eine herausragende Verantwortung dafür, dass die deutsche Politik so umsichtig wie irgend möglich auf Kaiser und Reich einwirkte, für einen Frieden, der unserer Nation und vor allem den einfachen Menschen Glück und Wohlstand, am besten dauerhaften Frieden und Anerkennung in der Welt einbrachte. Einmal mehr musste ich an Albert Ballins Worte gegenüber dem Kohlenbaron Stinnes denken: Deutschland in Europa zu stärken und zu sichern empfanden wir als unsere gemeinsame Aufgabe. Und ich bekam das ungute Gefühl, dass meine Vorstellungen von der Umsetzung dieser hohen Idee mit denselben von Stinnes und Ludendorff, aber womöglich auch des Kaisers und seines Sohnes nicht ganz übereinstimmen mochten. Innerlich aufgewühlt kam ich in Potsdam am Schloss Cecilienhof an. Bereits in der Türe empfing mich seine kaiserliche Hoheit mit weit geöffneten Armen und einem erfrischenden Strahlen in den Gesichtszügen. Ein wenig erleichtert betrat ich mit Kronprinz Wilhelm den großzügigen Salon, den er als Arbeits- und vor allem als Besprechungszimmer nutzte. Eine schwere Garnitur in grünem englischen Leder diente uns als bequeme Sitzgelegenheit. Im Kamin prasselte ein helles Feuer. Dank des trockenen Buchenholzes stieg kaum Rauch auf. Ein Kammerdiener servierte Tee und Kuchen. Der Kronprinz bestellte dazu Kognak und zwei Zigarren. Dann waren wir allein.
Die nun folgende Unterredung brannte sich derart in mein Gedächtnis ein, dass ich sie noch heute Wort für Wort nacherleben kann, ganz so, als säße ich gerade eben wieder mit seiner kaiserlichen Hoheit, meinem inzwischen engen Freund Wilhelm in engster Vertraulichkeit zusammen.
„Lieber Doktor Stresemann, haben sie vielen Dank für diesen schnell vereinbarten Termin. Ich weiß ja selbst, wie viele familiäre Verpflichtungen die Weihnachtstage und Neujahr mit sich bringen. Richten sie bitte ihrer Gemahlin meine herzlichsten Grüße und einen warmherzigen Dank dafür aus, heute auf sie zu verzichten.”
Wilhelm spricht etwas langsamer und auch etwas leiser als bei unseren bisherigen Begegnungen. Es ist womöglich keine Niedergeschlagenheit, die ihn kennzeichnet. Ganz gewiss ist er jedoch nachdenklich und höflich. Ich bin mir sicher, es muss sich etwas ereignet haben, dass ihn tief bewegt.
„Kaiserliche Hoheit, meiner Gattin fiel es nicht schwer, heute auf mich zu verzichten. Sie hat ihre Eltern zu Gast und weiß überdies zu erkennen, wann höhere Staatsgeschäfte über dem Familienleben stehen. Da auch sie heute Nachmittag auf ein Zusammensein mit ihren Liebsten verzichten, obgleich die baldige Rückreise zu ihrer Heeresgruppe an der Somme ansteht, wird es einen wichtigen Grund für unser Treffen geben. Zuallererst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, dass sie mir hiermit entgegenbringen, und ihnen meine vollkommene Verschwiegenheit zusichern.”
„Mein lieber Stresemann, danke dafür. Sie machen es mir leicht, gleich zum Kern der Sache zu kommen. Aber eine Vorbemerkung ist mir wichtig. Sie mögen glauben, ich lüde sie als den Vorsitzenden der Nationalliberalen Reichstagsfraktion ein. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht so ganz. Ich möchte mit ihnen sprechen, weil ich in unserem letzten Gespräch im kleinen Kreise mit dem Generalquartiermeister und Oberst Bauer tiefes Vertrauen zu ihnen gefunden habe. Zugleich war ich sehr angenehm berührt von der großen Verantwortung, die sie für die Zukunft unseres Volkes empfinden. Auch wenn wir in einer Frage - nämlich den Erzen von Longwy / Briey - nicht übereinstimmen, betrachte ich dies, vielleicht anders als die Herren Kommerzienräte Hugenberg und Stinnes, als eine Detailfrage.”
Der Kronprinz lächelt bei diesen letzten Worten und deutet mir damit an, dass es keine vollständige Übereinstimmung in der Gewichtung der Ziele zwischen ihm und den Ruhrbaronen gibt. Ich könnte vor Freude in die Hände klatschen, so sehr erleichtert mich diese Erkenntnis, die kaum mehr ist als der Ausfluss eines einzigen Nebensatzes und einer winzigen Miene.
„Warum ich sie heute zu mir gebeten habe, hat zunächst gar nichts mit den Herren Hugenberg und Konsorten und auch nicht mit seinen Exzellenzen Hindenburg und Ludendorff zu tun. All diese Personen spielen nur sehr mittelbar hinein. Im Kern der Sache geht es um mein Verhältnis zu meinem Herrn Vater und damit selbstverständlich um die elementaren Interessen des Deutschen Reiches und deren wirkungsvolle Wahrnehmung in der nächsten Zukunft.”
Mir stockt der Atem und mein Puls schnellt in die Höhe. Ich spüre sogar meine rechte Halsschlagader plötzlich heftig pochen. Welch eine Gunst mir der Kronprinz erweist! Er hat eine Meinungsverschiedenheit mit Seiner Majestät und zieht mich zu Rate. Ich bin glücklich, an diesem Nachmittag im Schloss Cecilienhof sitzen zu dürfen.
„Womit fange ich an, lieber Doktor Stresemann? Nachdem wir uns im Mai im Stadtschloss trafen, ist eine Menge passiert. Ich selbst habe im Juli eindeutig für die Entlassung Bethmann-Hollwegs votiert. Anders als sie, der sie klare Ziele für einen großartigen Frieden verfolgen, war Bethmann nur noch passiv, ja ich möchte sogar sagen resignativ. Das galt zuerst für die erzbergersche Friedensresolution, deren Umsetzung dem Reich jede Zukunft nähme. Das gleiche galt für das gleiche Wahlrecht in Preußen schon im Kriege, so dass wir bei einem leichtfertigen Nachgeben jeder Erpressung von SPD und Gewerkschaften hilflos ausgeliefert wären. Deshalb habe ich mich mit Hindenburg und Ludendorff bei meinem Vater für die Entlassung Bethmann-Hollwegs ausgesprochen. Dann hatte ich in der knappen Folgezeit nichts mit der Berufung von Michaelis zu tun. Doch der erwies sich als Bürokrat ohne Phantasie und Fortune. Ich bin froh, dass er inzwischen auch wieder entlassen ist. Und obwohl ich damit nun auch gar nichts zu tun hatte, bildete der doppelte Kanzlerwechsel des zurückliegenden Jahres den Ausgangspunkt eines Streits, den ich mit dem Kaiser hatte.”
Wilhelm macht eine lange Pause. Er schwenkt seinen Kognak, trinkt einen kleinen Schluck, stellt das Glas ab, greift zur Zigarre, die er in aller Seelenruhe anschneidet und sich sodann anzündet. Meine Neugierde wächst. Meine Ungeduld drückt sich in dem Schweiß aus, den ich in meinen Handflächen fühle. Das zwingt mich dazu, ruhig und gleichmäßig einzuatmen und mit scheinbar gelassenem Lächeln um die Lippen abzuwarten. Dann spricht der Kronprinz weiter.
„Es war folgendermaßen: Am ersten Weihnachtstag fand mittags das Zusammentreffen der gesamten kaiserlichen Familie im Stadtschloss statt. Wie stets zu Weihnachten waren die Kinder aufgeregt und warteten ungeduldig auf die Bescherung. Mein Vater brachte größte innere Ruhe zum Ausdruck und wahre Freude über das Wiedersehen mit all seinen Enkeln, die in den letzten Monaten zum Teil auch in Schlesien und Westpreußen ihren Aufenthalt hatten. Nach der Andacht folgte erst die Bescherung, dann das Mittagessen. In gemessenen Worten begrüßte der Kaiser die Schar und gab sich als geselliger Gastgeber. Nach dem Essen wechselten wir in den Musiksalon und hörten ein abwechslungsreiches Konzert der verschiedensten Familienmitglieder, die sich rühmen ein Instrument zu beherrschen. Es begann mit den Kleinsten, denen mein Vater mit größtem Interesse lauschte. Als aber die Enkel ihr Vorspiel beendet hatten, bedeutete er mir, mit ihm den Salon zu verlassen. Er schien zunächst bestens gelaunt und sprach mich auf dem Weg in sein Arbeitszimmer sogar mit Lieber Willi an. Dort angelangt wurde er ernster und forderte mich auf, gemeinsam mit ihm einen Rückblick auf 1917 zu halten. Ich nickte und zögerte zugleich damit, das Gespräch zu beginnen. Zu neugierig war ich darauf, ob mein Vater, den ich Ludendorff gegenüber jüngst reichlich despektierlich noch den Zauderer genannt hatte, denn wohl mit einer pointierten Bewertung starten wolle.
Es sei vielleicht ein grober Fehler gewesen, den alten, verdienten Bethmann nach acht Jahren der Kanzlerschaft zurück auf sein Landgut in die Mark Brandenburg zu schiken. So begann mein Vater das Gespräch. Nach langer Zeit der Verlässlichkeit sei nun eine unschöne Bewegung in das Erscheinungsbild der Reichsregierung geraten. Es habe ihn geärgert, Michaelis auch schon wieder nach nur gut drei Monaten entlassen zu müssen. Was sollen nur unsere Feinde, aber ebenso unser eigenes Volk, der einfache Mann auf der Straße, von der Monarchie denken, wenn die Kanzler jetzt beginnen zu wechseln wie die Jahreszeiten.
Ich wurde unruhig. Auch wenn es keinen direkten Vorwurf gab, fühlte ich mich herausgefordert. War ich es doch, der im Juni/Juli des zurückliegenden Jahres voller Unverständnis auf das Taktieren des Kanzlers reagiert, mich mit der OHL wechselseitig aufgepeitscht hatte. Ich hegte unbestreitbar eine nicht nur sachlich, sondern ebenso emotional unterfütterte Abneigung gegen den flauen Theobald. Und dann gingen mit mir die Pferde durch! Jawohl, ich möchte es ihnen gegenüber sehr freimütig zugeben und schildern, lieber Doktor Stresemann, im Vertrauen auf ihre absolute Verschwiegenheit. Ich war dann nicht ganz fair und habe meinen Vater geradezu angegriffen. Es tut mir sogar Leid im Nachhinein. Aber nun ja, es ist geschehen und wird auch nicht wieder rückgängig gemacht. Wir beide sollten nach meiner Schilderung freundschaftlich beraten, welche Folgen der Disput haben könnte.”
Freundschaftlich hat Kronprinz Wilhelm gesagt. Ich fühlte mich geschmeichelt. Ich befürchtete zugleich, dass die angedeuteten Konsequenzen von großer Tragweite für das nun beginnende vierte Kriegsjahr sein würden.
„ `Du bist der Kaiser der Unentschlossenheit! Und statt daran etwas ändern zu wollen, machst du all jenen auch noch Vorwürfe, die den Mut aufbringen, klar in die Zukunft zu schauen, und dir dafür feste Empfehlungen geben. Mache bitte weder die OHL noch mich dafür verantwortlich, wenn Deutschland nach mehr als drei Jahren des Krieges immer noch ohne Sieg dasteht!`
So unvermittelt habe ich meine Erwiderung auf die bisher ja durchaus moderat ausgefallene Eröffnung des Gespräches durch den Kaiser begonnen. Und es geht von meiner Seite genau so weiter, ohne Rücksicht darauf, dass ich mit meinem ehrwürdigen Herrn Papa disputiere.
`Es war nicht zuletzt dein Handeln oder Nicht-Handeln, das die Lage des Reiches seit 1914 immer wieder verschlechtert hat. Daran können wir nicht mehr vorbei sehen, lieber Papa!
Dieses lieber Papa wirkte auf mich selbst wie der reinste Widerspruch zu Inhalt und Tonfall meiner Worte. Vielleicht wollte ich zum Mindesten den kleinsten Versuch unternehmen, eine unnötige Verschärfung der Atmosphäre zu vermeiden. Doch mit einem Mal, lieber Doktor Stresemann, hatte ich mich in den Disput geworfen und es gab kein zurück mehr. Um ehrlich zu sein, nachdem ich die Stimmung gründlich verdorben hatte, wollte ich sogar die Gelegenheit nutzen, um meine Vorstellungen und Wünsche einmal los zu werden. Ich stellte mir vor, wie ich wohl handelte, wäre ich selbst der Kaiser. Während des folgenden Monologs beschlich mich wohl die Einsicht, dass es immer leichter sei, von außen harsches Vorgehen zu fordern, als wenn man selbst die volle und letzte Verantwortung für unser Volk trüge. Doch unbeschadet dessen wählte ich den Parforceritt!”
Der Kronprinz wirkt zwar äußerlich ruhig, doch nicht wirklich innerlich ausgeglichen und auch nicht restlos davon überzeugt, dass die Welt so klar und vermeintlich einfach sei, wie es seiner anschließenden Rede zu entnehmen sein wird. Ich fühle mich ihm in all seinen Zweifeln nahe. In meiner Fraktion gibt es nicht wenige Stimmen, die ähnlich denken und dem Kaiser eine Mitschuld am bisherigen Kriegsverlauf geben, die ihn überdies für schwach halten in personellen Dingen, also bei der Auswahl von Reichskanzlern und Heeresführern sowie bei der Entscheidung über den Zeitpunkt von Wechseln. Vor allem aber stimme ich mit dem Kronprinzen in einer zentralen Beurteilung überein: Seine Majestät ließe sich seit jeher von seinen Beratern, von seinem Hofstab und seinem Zivilkabinett viel zu sehr treiben oder bevormunden! Die Führungsschichten des Reiches haben anders als bis 1913 die Gewissheit verloren, dass ihr Kaiser Herr der Lage sei, um das Reich mit einem klaren und zielstrebigen Plan zum Sieg zu führen. Somit verstehe ich den Ansatz für die Kritik des Kronprinzen nur zu gut. Und ebenfalls empfinde ich seine innere Zerrissenheit mit: Dem eigenen, geschätzten und vielleicht gar geliebten Vater aus Staatsräson persönliche Vorwürfe machen zu müssen, und dann auch noch ausgerechnet am Fest des Friedens und der Familie, zu Weihnachten, kann natürlich keine Freude und innere Zufriedenheit geben! Doch sogleich muss ich mich erneut auf die Worte Wilhelms konzentrieren.
“Ich fing beinahe bei Adam und Eva an, lieber Doktor Stresemann, also im Jahr 1913: ˊLieber Papa, in der Generalität gab es anlässlich des Begräbnisses des großen Schlieffen laute und warnende Stimmen, dass die fortlaufende Veränderung des Planes für den doppelten Krieg gegen Frankreich und Russland Risiken mit sich bringe. Weißt du noch, was Feldmarschall Schlieffen aus seinem Ruhestand immer wieder mahnend forderte: Macht mir den rechten Flügel stark! - Warum wohl? Er kannte die Gefahr, dass mit der russischen Heeresaufstockung immer mehr deutsche Divisionen nach Osten geschickt würden und uns dann fehlen würden, um im Westen Paris einzukreisen und zu nehmen, und gleichzeitig noch eine irgend geartete Front bis zur Kanalküste aufrecht zu erhalten. Schlieffens Plan sah zu Beginn ein Kräfteverhältnis von sieben zu eins vor. Und was machte dieser Moltke daraus? Drei zu eins! Das war doch schon Wahnsinn, als unser Aufmarsch begann!
Du, lieber Papa, hast den jüngeren Moltke gemocht. Ich will gerne zubilligen: Auf mich traf dies anfangs ebenfalls zu. Aber du hast dir das kühle Urteil von der Sympathie verstellen lassen und alle Mahner überhört, die 1913 und 1914 dem Generalstabschef die Fähigkeit absprachen, den großen Krieg so erfolgreich zu gewinnen wie sein Großonkel unser Heer 1866 und 1870 geführt hatte.ˋ
Daraufhin wiegelte der Kaiser mit einer laschen Handbewegung ab und fragte resigniert: “Was sollen denn die ollen Kamellen, mein lieber Willi?” Auf solch eine Antwort hatte ich nur gewartet. Sie signalisierte mir, dass ich in der Vorwärtsbewegung, er aber hoffnungslos in der Defensive war. Also setzte ich nach:
“Moltke hat den fatalen Fehler begangen, ausgerechnet Anfang September, als im Westen die Entscheidung über die Einnahme von Paris fiel, ein ganzes Armeekorps zu Hindenburg nach Ostpreußen zu entsenden. Der Fall liegt doch wohl klar: Moltke verlor die Nerven, genau zu dem Zeitpunkt, als es darauf ankam, ein kaltes Hinterteil zu beweisen. Und was hast du unternommen? Nichts, wenn ich das richtig sehe. Der Kaiser blieb bis auf eine kurze Stippvisite im Hauptquartier in Spa in Berlin und überließ seinem Heeresführer alle Entscheidungen. Papa, ein Friedrich der Große wäre im August nach Spa gereist und hätte seinen Generalstab nicht mehr eine Minute aus den Augen gelassen! Das hätte die Verantwortung vor der Geschichte von dir verlangt!”
Seine Majestät sah mich bei meinem Vortag zuweilen entgeistert, zuweilen auch zu innerem Widerspruch gereizt an. Lieber Stresemann, mir ging es nun darum, in das Jahr 1917 zu springen. Eigentlich wollte ich damit die Welt der Vorhaltungen hinter mir lassen und zur Welt der Zukunft hinüberwechseln. Zu Falkenhayn und der zweiten OHL verlor ich nur einen Satz, nämlich dass der Generalstabschef kein Mittel ersonnen habe, die Front im Westen zu knacken. Immerhin wusste er, wie er sich 1915 an der Somme der gegnerischen Übermacht zu erwehren hatte. Die Einsetzung der dritten OHL bezeichnete ich dann ausdrücklich als richtig, wobei ja eigentlich nicht der alte Hindenburg, sondern der frische Ludendorff der starke Mann sei. Der habe auch den nötigen Machtinstinkt, um sich mit den Größen der Schwerindustrie zu verbünden. Ich sagte dann ein wenig versöhnlich:
ˊPapa, ich werfe dir doch nicht vor, dass du die zweite und die dritte OHL berufen hast. Es hätte vielleicht besser, es hätte indes auch viel schlechter kommen können. Was ich aber für die Aufgabe des Monarchen in der Krise erachte, ist Folgendes: wie der Kapitän ganz oben auf der Brücke zu stehen, damit die gesamte Mannschaft die Ruhe spürt, die vom Chef ausgeht, wenn es augenscheinlich eng wird. Der Juli 17 brachte die schwerste innere Krise seit Kriegsbeginn mit sich. Du aber hast dich seit der Osterbotschaft nicht mehr an dein Volk gewandt. Die Ereignisse nahmen mit Erzbergers Resolutionsentwurf Fahrt auf. Du und ich, Ludendorff und Stresemannˋ- jawohl, ihren Namen, lieber Herr Doktor, wollte ich einführen - ˊjedenfalls die intimen Kenner des Reiches wussten doch schon im Juni, dass Bethmann zum Frieden auf der Basis des Status quo ante tendierte. Hättest du ihn zum Rücktritt gezwungen, bevor Erzberger seine Resolution einbrachte, und einen starken Reichskanzler mit unverbrüchlicher vaterländischer Gesinnung ernannt, dann wären der ganze Spuk, die Aufregung im Inneren, das unglückliche Signal an unsere Feinde, dass die deutsche Reichsregierung unter den weltweit gültigen Bedingungen des Sommers 1917 auf einen Gestaltungsfrieden verzichten wolle, zerplatzt, bevor sie überhaupt wie ein böser Geist die Flasche verließen! Sie hören, Stressemann, ich war mächtig in Fahrt.
Kronprinz Wilhelm macht eine Pause, legt die Zigarre bei Seite und fordert mich auf, von der hervorragenden Herrentorte zu probieren. Er lächelt auf ein Mal. Die beherzte Erzählung hat seinen Geist befreit. Je energischer er von seinen Forderungen an den Regenten berichtet, um so selbstsicherer ist er geworden, in dem Schlagabtausch das Richtige, das Unvermeidbare verlangt zu haben. Doch bisher ging es ausschließlich um die Vergangenheit. Und ich war mir sicher, dass der Kronprinz mich nicht heute Nachmittag zu sich gebeten hatte, um sich in vaterländischem Pathos oder in zwischen uns konsensualen Wahrheiten über die Vergangenheit zu ergehen. Doch eine andere Frage brannte mir zusehends unter den Nägeln:
„Und Seine Majestät der Kaiser hat das alles, ihre ausführlichen Erläuterungen, kaiserliche Hoheit, mehr oder minder widerspruchslos über sich ergehen lassen?”
„Aber selbstverständlich nicht, lieber Doktor Stresemann. Mein Vater schien mir zuerst überrascht, dann entsetzt, dann einfach nur still auf meine Vorhaltungen zu reagieren. Doch als ich mit der Entlassung Bethmanns fertig wurde, kehrte ein Leuchten in seine bis dahin traurigen, müden Augen zurück. Und dann zuckte ich tatsächlich zusammen und blieb ganz still, um der urplötzlich zurückgekehrten Autorität des Kaisers, des mächtigsten Monarchen Europas zu lauschen:
`Willi, was erlaubst du dir gegenüber deinem Vater und deinem Kaiser! Zügele deine Zunge und bedenke, dass du heute noch ein niemand bist. Solange ich lebe, hat der Kronprinz in bedingungsloser Treue zum Monarchen zu stehen. Du selbst wähltest eben den Vergleich mit Friedrich dem Großen. Doch ich sage dir, zu seiner Zeit war Friedrich seinem Vater auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Worte wie deine hätten ihn ins Zuchthaus, in die Verbannung oder gar zur Exekution gebracht!
Wohl sei dir, dass wir im 20. Jahrhundert leben und nicht mehr im 18.! Jetzt aber schweige und höre mir zu. Ich verlange von dir Respekt und Treue. So wie ich deine Leistung an der Spitze deiner Heeresgruppe schätze, obgleich dein Stab dir etwas mehr abnehmen mag als dies bei den übrigen Armeen der Fall sein wird.ˋ
Diese Spitze tat mir weh, Herr Doktor Stresemann. Der Kaiser fuhr fort:
`verlange ich von dir absolute, bedingungslose Treue und Loyalität gegenüber deinem Herrscher. Das verlange ich nicht deshalb, weil ich dein gealterter Vater bin. Allein der Umstand, dass du ein reifer Mann geworden bist und glauben magst, du wüsstest es jetzt besser als die Generation der Alten, gibt dir nicht das Recht, mich zu belehren, mir Vorwürfe zu machen, mich zu verurteilen! Deshalb warne ich dich mit brutaler Klarheit, mein Sohn Wilhelm. Höre ich noch ein einziges Mal in diesem Tone von dir, so entziehe ich dir dein Kommando und verurteile dich zur Untätigkeit auf deinem Landsitz Oels in Schlesien, solange, bis der Krieg beendet und die Gefahr für die innere und äußere Einigkeit unseres Vaterlandes gebannt sein wird.´
Die Drohung, lieber Doktor Stresemann, verschlug mir für kurze Zeit den Atem. Von meinem zaudernden Vater hatte ich viel erwartet, etwa Vorwürfe, Mahnungen, eine Verteidigungsrede. Nicht aber, dass er mich im Alter von 35 Jahren wie einen Buben behandelte und androhte, mich gleichsam unter Hausarrest zu stellen, mich, seinen im Volk beliebten Nachfolger und den anerkannten Heerführer der Truppen bei Verdun und nun an der Somme! Ich blieb still. Und tatsächlich schlug die Stimme des Kaisers in Sanftheit um:
`Was ich dir, mein lieber Sohn, hingegen zugute halte, ist der Takt, mich zwar zur Rede zu stellen, dafür aber einzig und allein eine Situation zu suchen, die unter vier Augen stattfindet. Ich wünsche von dir, dass die deutsche Öffentlichkeit und ebenso die Oberste Heeresleitung von deinen Ansichten ebenso wenig erfährt wie davon, dass diese Unterredung jemals stattgefunden hat.`”
Mein sich anschließender Augenaufschlag scheint Bände zu sprechen. Der Kronprinz schmunzelt. Er zündet sich genussvoll erneut die noch zur Hälfte ungerauchte Zigarre an und blickt mir lange in die Augen.
„Der einzige Mensch, dem ich bisher und vor ihnen von meinem Streitgespräch mit meinem Vater erzählte, ist meine liebe Gattin Cecilie. Betrachten sie es als Ausdruck unseres persönlichen Umgangs miteinander, dass ich ihnen auch davon kurz berichte. Es ist mir ein Bedürfnis, nicht zuletzt wegen der Anerkennung, die ich meiner Frau damit zollen möchte. Ich musste gestern Abend schlichtweg los werden, was mich beschäftigte. Nachdem die Kinder zu Bett gegangen waren, fragte ich recht unverbindlich nach, ob meine Frau noch die Frische aufbrächte, mir mit gutem Rat zur Seite zu stehen. Cecilie zeigte sich hoch erfreut über die ihr damit zu Teil werdende Anerkennung und lauschte äußerst geduldig meinem Bericht. Als ich geendet hatte, wartete ich einen Moment ab, ob meine Frau eine Bemerkung machen wollte. Das war nicht der Fall. Also begann ich selbst mit der Bewertung. Ich rügte mich als zu forsch, zuweilen beleidigend im Ton des Vortrags. Zugleich rechtfertigte ich mein Handeln, indem ich zu jedem sachlichen Argument stünde, das ich vorgebracht hätte.
Jetzt unterbrach mich meine Gattin. Cecilie billigte mir ohne Zweifel das Recht zu, ein kritisches und offenes Gespräch mit Seiner Majestät zu suchen. Hingegen verlangte sie mir mehr Respekt vor dem Alter und der Lebenserfahrung meines Vaters ab. Es fiel der Satz:
`Es mag Wilhelm selbstgerecht erschienen sein, dass du seine Regentschaft seit 1913 so durchgehend negativ beurteiltest. Es ist doch stets einfacher, aus der Rückschau die Dinge einzuordnen als in der akuten Entscheidungssituation des welthistorischen Augenblicks, den zum Beispiel die Kriegserklärungen der Mächte Anfang August 1914 bildeten. Prüfe dich bitte selbst, lieber Willi. Ist dir nicht ebenfalls seitdem das eine oder andere Fehlurteil unterlaufen?´
Selten hatte meine Gattin bisher in diesen Worten mit mir gesprochen. Es war ein schönes Gefühl, in ihr diese Nachdenklichkeit, diesen Geist anzutreffen. So versetzte mich meine Cecilie in die Stimmung, durchaus ein wenig Selbstkritik zu üben. Plötzlich hörte ich mich selbst sagen, ich sei zwar ein großer Freund der dritten OHL, doch die beiden Herren Hindenburg und Ludendorff machten leider auch nicht alles richtig. Ebenso wie sie und viele andere in Deutschland hätte ich auf die Wirkung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegen England vertraut und fatalerweise die Gefahr unterschätzt, die von der Provokation ausging, die wir damit gegenüber den Vereinigten Staaten wagten. Aus heutiger Sicht billigte ich meiner Gattin zu, es sei ein Fehler gewesen, den U-Boot-Krieg als totalen Krieg wieder aufzunehmen. Wir stünden heute besser da, falls die USA weiter neutral wären.“
Mit den letzten Sätzen des Kronprinzen gewinnt das Bild, das ich mir bislang von ihm gemacht habe, weitere wichtige und facettenreiche Züge hinzu. Dieser Mann ist für mich von nun an viel mehr als ein Vertreter der alten preußischen Elite. Wilhelms Fähigkeit und Offenheit zur Selbstkritik sowie seine sehr sympathische Äußerung zur Persönlichkeit seiner Gattin Cecilie hinterlassen bei mir den gesicherten Eindruck eines Mannes, der mit beiden Beinen fest in der Moderne des 20. Jahrhunderts stehe und von daher auch die Fähigkeit mitbringen werde, zu gegebener Zeit die Zukunft unseres großen Volkes zu gestalten.
Der Kronprinz blinzelt mich aufmerksam an. Er scheint zu erraten, dass ich in meinen Gedanken ein wenig abgeschweift bin. Ebenso scheint er mir bewusst und gerne die Zeit dazu einzuräumen. Erst als ich ihm wieder mit voller Aufmerksamkeit ins Gesicht schaue, spricht Wilhelm weiter.
„Sie fragen sich jetzt natürlich, wie ich es nur wagen kann, trotz der deutlichen Warnung Seiner Majestät vor jeder Indiskretion über meine Unterredung mit ihm dennoch heute dieses Gespräch mit ihnen zu führen. Die Verwunderung ist berechtigt. Sie vermag ich jedoch gleich aufzulösen, wenn ich ihnen die Ereignisse bis zum gestrigen Tage berichte. Denn gestern hat - als Ausfluss des Streitgespräches mit meinem Vater - auf Veranlassung des Kaisers der Kronrat getagt und bedeutsame Weichenstellungen vorgenommen. Diese sind der letzte Grund dafür, warum ich so viel Wert darauf legte, heute mit ihnen zusammen zu kommen. Aber greifen wir den Ereignissen bitte nicht vor. Zur Sache selbst, lieber Doktor Stresemann, nur Folgendes: Durch unsere tief schürfende Unterredung im Mai 1917 und die seitdem von uns allseits darüber gewahrte Verschwiegenheit sind sie nicht mehr ein Teil der deutschen Öffentlichkeit, sondern mein Vertrauter, mit dem ich mich berate und von dem keinerlei Gefahr ausgeht, dass die Berliner Neuesten Nachrichten oder sonst wer in der Presse davon erfährt.”
„Ich danke ihnen sehr für ihr uneingeschränktes Vertrauen, kaiserliche Hoheit. Sie können sich jetzt und in Zukunft immer auf mich verlassen!”
„Das weiß ich, verehrter Herr Doktor. Nun lassen sie mich aber noch die Wissenslücke bei ihnen schließen, damit sich der gestrige Kronrat auch vollends erklärt.
Seine Majestät, der Kaiser, nahm nämlich nach seinem herrischen Auftritt doch die Verteidigung auf. Die Ernennung Graf Hertlings zum Reichskanzler sei eine aktive Tat gewesen, von der er sich eine starke Regierung und die Erringung des Friedens erwarte. Zwar habe die Mobilisierung der Kriegswirtschaft im zurückliegenden Jahr nicht ganz die erwünschten Fortschritte gemacht, doch der Feind sei weiter zurückgefallen. Demgegenüber gehe die Strategie zu Russland vollkommen auf: Lenin stifte nicht mehr nur erfolgreich Unruhe, er sitze jetzt gar in der Regierung und müsse seinen Worten vom Vorrang des Friedens vor allen anderen Zielen der Revolutionsregierung Taten folgen lassen. Seine Majestät der Kaiser sei sich mit Hindenburg und Ludendorff bei deren letztem Besuch in Berlin vor erst einer Woche einig darin gewesen, dass wir über den Osten endlich wieder Bewegung in die Westfront bringen werden. Nötig sei dafür natürlich der Fortbestand des Burgfriedens. Wir könnten jetzt einfach keine Arbeitermassen gebrauchen, die nach dem Frieden im Osten den Verhandlungsfrieden auf Basis des Status quo ante im Westen fordern und in den Bummelstreik treten würden.
Sie können sich vorstellen, lieber Doktor Stresemann, damit hatte ich nicht ganz gerechnet. Einen guten Teil dessen, was ich für die Gegenwart und das Jahr 1918 von meinem Vater als Conclusio meiner Vorrede verlangen wollte, nahm er mir da gerade vorweg. Und noch bevor ich meine Gedanken neu geordnet bekam, preschte der alte Herr mit einer Initiative vor, der ich ohne Vorbehalte zustimmen wollte. Der Kaiser sagte nur noch kurz und knapp:
`Es ist Weihnacht, lieber Willi, Hindenburg reist nach dem Fest wieder von Ostpreußen nach Westen und kommt durch Berlin. Ludendorff und der Reichskanzler und Staatssekretär Kühlmann sind ohnehin hier. Ich lade jetzt für einen Tag nach Neujahr zum Kronrat ein und du bist mit dabei! Wir werden der zivilen und der militärischen Reichsleitung klare Vorgaben machen. Wie soll der Krieg im Osten beendet werden? Wie mobilisieren wir alle Kräfte für die letzte, entscheidende Offensive im Westen? Mit welchen Zielen zwingen wir Frankreich und England danach an den Verhandlungstisch?`”
„Kaiserliche Hoheit, nun beginne ich zu ahnen, warum sie mich heute hierher bestellt haben. Sie haben gestern Kronrat gehalten. Der Kronrat hat Beschlüsse gefasst. Doch die Regierung kann nicht über alles entscheiden, das für die Wehrhaftigkeit Deutschlands im neuen, im hoffentlich letzten Kriegsjahr 1918 ausschlaggebend sein wird. Möchten sie mit mir da eher über die Kriegsziele oder aber über die innenpolitische Lage und die Bereitwilligkeit der Reichstagsfraktionen zur Fortsetzung aller kriegerischen Anstrengungen unter dem Schirm des Burgfriedens sprechen?”
„Sehr scharfsinnig, mein lieber Doktor Stresemann! Irgendwie natürlich über beides. Doch wenn unser Plan aufgeht und der Sieg im Westen errungen wird, ja dann sind die Einigung über die Kriegsziele zwischen den Ruhrbaronen und der übrigen Industrie sowie eine gleiche Vereinbarung zwischen der OHL und Reichskanzler Graf Hertling nicht unser Hauptproblem. - Obwohl ich inzwischen weiß, dass sie eine Skepsis gegenüber der Zuversicht auf einen vollständigen militärischen Sieg zurückbehalten, werden wir in den kommenden Monaten auf dem erfolgreichen Wege unserer weiteren Kriegführung zuerst in Russland, dann aber in Frankreich noch genügend Zeit finden, einen Frieden zu schließen, der Deutschland nicht für Jahrzehnte zum verhassten Hegemon des Kontinents macht. Tatsächlich sollten wir unsere Vormachtstellung in Europa in das moderne Kleid von nationaler Selbstbestimmung und Völkerverständigung wandeln. Dabei dürfen sie durchaus auf mich zählen, lieber Doktor Stresemann. Soweit reicht mein Angebot am heutigen Abend. Es hat zum Gegenstand, dass wir beide hier im neuen Jahr zu einem ganz persönlichen Zweierbündnis gelangen und uns in die Hände spielen werden. Je länger Hugenberg und Ludendorff davon nichts wissen und es nicht einmal ahnen, umso wertvoller wird diese Übereinkunft sein!”
Mein Herz schlägt laut und feste. Der Kronprinz bietet mir eine geheime Übereinkunft an, die den Interessen des Friedens, des freien Handels, damit der Exportwirtschaft und sogar manchen Interessen der demokratischen Fraktionen im Reichstag förderlich sein dürfte. Für eine lange Sekunde schwelge ich in einem schönen Tagtraum: Ich bin das Scharnier, der Dreh- und Angelpunkt zwischen Scheidemann, Erzberger und Haußmann hier, Rathenau, Ballin und Duisberg dort, dem Kronprinzen und einigen anderen weitsichtigen Militärs, vielleicht Oberst Bauer darunter, auf der dritten Seite. Uns gelingt es gemeinsam, die OHL, die Schwerindustrie und das konservative Junkertum im entscheidenden Moment, nämlich wenn der Westen nach unserer Westoffensive um Frieden nachsuchen muss, ein kühnes Modell von einem neuen Europa durchzusetzen. In dieser kühnen Vision wird das Reich die unbestrittene wirtschaftliche und militärische Vormacht sein. Doch zugleich werden die Völker des Kontinents eine Zollunion eingehen und eine Partnerschaft vereinbaren, die irgendwie das herkömmliche Bündniswesen der Vergangenheit obsolet machen wird. Ich schüttele mich innerlich und streife meinen Tagtraum als zu optimistisch, als gefährlich naiv von mir ab. Ich zwinge mich dazu, Realist zu bleiben.
„Zum wiederholten Male, kaiserliche Hoheit: Ich danke ihnen für das unermessliche Vertrauen, das sie mir entgegen bringen. Ich danke ihnen auch für die noch ein wenig nebulöse Zielbeschreibung. Sie ist doppelt zutreffend. Einmal kann ich ihnen nämlich inhaltlich völlig zustimmen, zum anderen Mal legt die vage Formulierung offen, dass sie und ich heute noch nicht recht wissen, was zum Zollverein noch hinzutreten muss, damit Europa im weiteren 20. Jahrhundert ein Hort der Stabilität, des Wohlstandes und der Macht in der Welt wird. Diesbezüglich genügt mir völlig, wenn sie mir zusichern, dass wir zur rechten Zeit, vor der Aufnahme von Friedensverhandlungen, erneut und so oft wie nötig vertraulich unter vier Augen zusammen kommen.”
Kronprinz Wilhelm nickt deutlich und bekräftigt dies noch mit einem betont langsam vollzogenen Augenaufschlag.
„Sie haben mein Ehrenwort als Thronfolger der Krone der Hohenzollern, zukünftig der machtvollsten Dynastie der Erde, mein lieber Stresemann.“
Auf die pathetische Zusage seiner kaiserlichen Hoheit folgt eine Weile, die einzig und allein von den Blicken der in sich ruhenden Zuversicht, die wir uns zuwerfen, ausgefüllt wird.
„Darf ich denn dann zu den inneren Verhältnissen kommen, um deretwillen sie ja heute auch hier sind, wie sie so scharfsinnig geschlussfolgert haben? Graf Hertling, Staatssekretär Kühlmann und Generalquartiermeister Ludendorff haben sich beim Kronrat darin überboten zu betonen, dass die Wehrkraft des Reiches bei der großen Westoffensive in gleich mehrfachem Sinne von der Ruhe an der Heimatfront abhängen wird. Sie stimmten darin überein, die sozialistischen und die christlichen Gewerkschaften für Disziplin und fortgesetzte Arbeit in den Rüstungsfabriken gewinnen zu müssen. Sie zeigten sich aber abgesehen von pflaumenweichen Bekundungen ihrer Zuversicht in meinen Augen sehr hilflos, wie denn das Mitwirken der Arbeiterschaft erreicht werden sollte. Ich dachte sogleich an ihre Gespräche mit den Herren Scheidemann, Haußmann und Erzberger vom Frühjahr 1917, lieber Doktor Stresemann. Doch ich hielt mich zurück. Nicht nur, um unsere Zusammenkunft vom Mai zu schützen. Gerade auch, um hier und heute ungestört, allein mit ihnen darüber sinnieren zu können, wie es uns zum Wohle des Vaterlandes gelingen möge, den inneren Frieden zu wahren, um den äußeren erst noch zu gewinnen.”
Ich blicke dem Kronprinzen lange in die Augen. Ihm scheint das unangenehm zu werden, denn er lächelt und sieht dann weg, um zum Kognakschwenker zu greifen. Ich rätsele kurz, wie ungeschminkt ich meine Auffassung äußern soll. Dann weiß ich, diplomatisch formuliert zwar, doch es muss raus, was mir Sorgen bereitet.
„Euer kaiserliche Hoheit wissen sicher noch, welche Bedeutung die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes im Königreich Preußen für die demokratischen Fraktionen des Reichstags hat. Angesichts der zweiten Revolution in Russland, angesichts der zunehmenden Hoffnung auf einen Separatfrieden mit den Revolutionären geraten wir in sehr kritisches Fahrwasser. Millionen deutscher Arbeiter und Millionen ihrer Frauen sind kriegsmüde. Es bedarf nur eines kleinen Auslösers und die Stimmung schlägt gegen die Eliten der kaiserlichen Gesellschaft um. Ich sage ihnen jetzt im tiefsten Vertrauen: Selbstverständlich bin ich mit den Herren von den anderen Reichstagsfraktionen immer noch im unregelmäßig stattfindenden, aber irgendwie dann doch kontinuierlichen Austausch. Und Herr Scheidemann prophezeite Anfang Dezember, es werde im neuen Jahr Streiks geben. Diese Streiks könnten womöglich alles bisher Gekannte in den Schatten stellen. Falls das zutreffen sollte, bekommen wir sehr viel schneller als uns lieb sein kann jene innenpolitische Situation, vor der sie sich zu Recht fürchten. Und die kann Ludendorff mit den bisher von ihm gewählten Mitteln im Rahmen des Hilfsdienstgesetzes - also ein wenig Zuckerbrot und ein wenig mehr Peitsche - einfach nicht entschärfen.”
„Hugenberg und Stinnes sehen das anders, das wissen sie doch, Doktor Stresemann, oder?”
„Aber natürlich, die Ruhrbarone streben nach dem engsten Schulterschlusse mit der Heeresleitung und den Armeekommandos zu Hause. Jeder Arbeiter, der streikt oder aufwiegelt, solle ohne zu Zögern eingezogen werden. Die Herren Zechendirektoren und Stahlindustriellen glauben allen Ernstes, damit jetzt und sogar in der Nachkriegszeit ihre Macht in den Betrieben auf Dauer festschreiben zu können. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass dies funktionieren wird, und vor allem nicht, dass wir es uns erlauben dürften, dieses Risiko einzugehen und einen großen Arbeitskampf heraufzubeschwören, wenn unsere Landser an der Front auf gefüllte Munitionsarsenale für den Angriff warten. Denn eines ist klar: Der Soldat wird nicht mit voller Leidenschaft für sein Vaterland kämpfen, wenn seine Arbeitskollegen von 1914 im Ausstand sind. Deshalb klingen die Reden der Herren Stinnes, Hugenberg und Konsorten sehr selbstbewusst und stichhaltig, überzeugen werden sie mich aber und mit mir die Vertreter der demokratischen Fraktionen im hohen Hause nicht. Was nützt ihnen dann ein gewonnener Arbeitskampf, wenn darüber die Mehrheit des Reichstags ihre Friedensstrategie einschließlich der großen Offensive im Westen offen ablehnt? Kaiserliche Hoheit, haben Ludendorff und Stinnes daran wohl auch gedacht?”
Kronprinz Wilhelm lächelt überlegen.
„Sie haben vollkommen Recht, was ihre Einschätzung der inneren Verhältnisse im Reich betrifft. Deshalb ist es mir ja so wichtig, dieses Gespräch mit ihnen zu führen, lieber Doktor Stresemann. Ich schätze ihren scharfen und schonungslos analysierenden Verstand. Und ich setze auf ihre sehr guten Kontakte zu allen politischen Kräften in unserem Reichstag. Es ist an der Zeit offen zu legen, was ich mir von ihnen wünsche und erhoffe: Sie sind der einzige Politiker in Deutschland, der fest auf dem Boden vaterländischer Werte steht und der zugleich über den vertraulichen Zugang zu den führenden Vertretern der demokratischen Parteien verfügt. Deshalb sind sie auch der einzige, der im ersten Schritt über das nötige Wissen verfügt, um erkennen zu können, auf welchem Wege die Herren Scheidemann und Erzberger vielleicht zu einer Mitwirkung an unserem Friedensplan für 1918 bewogen werden können. In einem zweiten Schritt wären sie dann wiederum der einzige, der bei den Herren der demokratischen Fraktionen über das nötige Vertrauen verfügte, in Gesprächen vielleicht sogar ihre Kooperation zu erreichen. Das ist der wahre Grund, warum ich es bereits vor Kenntnis der genauen Ergebnisse des Kronrats als unabdingbar beurteilt habe, das vertrauensvolle Gespräch mit ihnen zu suchen.”
Der Kronprinz legt eine Kunstpause in seiner Erläuterung ein. Er erwartet von mir wohl kaum einen Widerspruch, kaum eine Erwiderung oder Antwort. Vielmehr ringt er offenbar um die richtigen Worte, um sein Anliegen en Detail vorzubringen.
„Die sozialistisch gesinnten Arbeiter blicken seit März 1917 aufmerksam nach Petersburg und Moskau. Der dort erhobene Ruf nach einem Frieden ohne Sieger findet auch in Deutschland viel Zuspruch. Doch es braucht gar nicht einmal der sozialistischen Überzeugung dazu. Ich ganz persönlich werte Erzbergers Friedensresolution vom Juli als eine kleine Verzweiflungstat. Denn auch Erzberger musste bemerken, wie sehr seine katholischen Arbeiter unwillig wurden, Entbehrungen für die Fortsetzung des Kampfes auf sich zu nehmen. Dieser bitteren Wahrheit haben sie und ich, lieber Stresemann, sich längst geöffnet. Gestern aber musste ich im Kronrat wieder einmal erleben, wie sehr die manches Mal all zu selbstbewussten Vertreter der alten preußischen Führungsschichten die Augen davor verschließen, wie sehr ihre Siegesplanung für 1918 auf völlig tönernen Füßen steht, falls die deutsche Arbeiterschaft ihnen die Gefolgschaft verweigerte und einen Generalstreik zur Erzwingung des Waffenstillstandes aufnähme. Der Generalquartiermeister beruhigt sich damit, seine Politik aus Zuckerbrot und Peitsche werde ihre Wirkung nicht verfehlen. Ludendorff setzt auf die Abschreckung einer möglichen Einziehung zum Heer in Kombination mit der erfolgreichen Wirkung unserer Propaganda, ein Friedensersuchen unsererseits werde die Feinde nur in ihrer Überzeugung bestärken, uns doch noch besiegen zu können. Gerade die Franzosen seien unendlich weit davon entfernt, von ihren eigenen maßlosen Forderungen Abstand zu nehmen. Also sind sie und ich vielleicht die einzigen aus dem Kreise jener Deutschen, die über Einfluss verfügen und die gleichzeitig längst erkannt haben, dass wir auf die Führer der Arbeiterschaft aktiv zugehen müssen, um dem Sieg den Weg zu ebnen. Wollen sie das gemeinsam mit mir unternehmen, lieber Doktor Stresemann?”
Lange Zeit zum Nachdenken brauche ich tatsächlich nicht. Denn innerlich gebe ich dem Kronprinzen bei jedem einzelnen seiner Worte vollständig Recht. Allerdings bedeutet es eines, zu erkennen welcher Versäumnisse sich die Militärs schuldig machen, und etwas gänzlich anderes, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Ich stelle mir soeben vor, in der bekannten Viererrunde vom Frühjahr 1917 mit Erzberger, Scheidemann und Haußmann gemeinsam und zugleich höchst geheim darüber zu beraten, dass ihre Parteien und die ihnen nahe stehenden Gewerkschaften für eine Fortsetzung des Kampfes votieren sollen, weil ihnen dann nicht nur der Sieg, sondern zugleich einige schmackhafte Zugeständnisse im Inneren winken. Der Gedanke erscheint mir gleichermaßen verlockend und absurd. Wie soll ein Zugehen auf die Kollegen nur aussehen?
„Kaiserliche Hoheit, sie scheinen im Ansatz die Dimension der Aufgabe zu erahnen, die da vor uns liegt. Dass es unsere gemeinsame Aufgabe wird, dass ich alles dafür tun will, mit eurer Hoheit für einen guten Sieg und eine stabile Gesellschaft im Inneren zu kämpfen, dass versteht sich für mich von selbst. Jeder gut vaterländisch gesinnte Deutsche hat sein Bestes zu geben, wenn die Krone ihn in der Stunde der Not und der Herausforderung ruft!”
Der Kronprinz nickt anerkennend. Unterbrechen möchte er mich augenscheinlich nicht. Dennoch macht er eine kurze Bemerkung.
„Kein Zweifel kam mir daran, auf ihre Hilfe und ihre Gesinnung vollkommen zählen zu können.”
„Was die Sache selber betrifft, kaiserliche Hoheit, liegt es mir völlig fern, ihnen vorgeblich nach dem Munde zu reden, die Größe der Herausforderung herunterzuspielen. Da sie mich in der Vertraulichkeit unseres heutigen Treffens zu sich gerufen haben, werden sie die Kraft und die Geduld und die Konzentration aufbringen, meiner Einschätzung und meinen Empfehlungen zu lauschen.”
Die Spur von Ironie, die man in die Worte Konzentration und lauschen hinein legen könnte, ist von mir gar nicht bewusst gewählt und daher auch bestimmt nicht abfällig gemeint. Das ändert selbstverständlich nichts daran, dass der Kronprinz die Spitzen meiner Worte wahrnimmt, ohne mir dies allerdings im Geringsten übel zu nehmen. Im Gegenteil lächelt er.
„Das dürfen sie tatsächlich von mir erwarten. Bei der Größe der von mir geäußerten Bitte um Mithilfe dürfen sie jetzt und immerdar von mir verlangen, ihnen aufmerksam und so lange wie nötig zuzuhören.”
„Beginnen wir bei Herrn Erzberger. Die christlichen Gewerkschaften haben zwar nicht ganz so viele Mitglieder wie die sozialistischen. Bis vor dem Krieg jedoch zeigten sie sich Appellen an ihre vaterländische Verantwortung gegenüber stets aufgeschlossener als die Konkurrenz. Also haben wir sicher eine realistische Möglichkeit, über die Reichstagsfraktion des Zentrums auf die Streikneigung der Christlichen Einfluss zu nehmen. Herr Erzberger speziell ist hingegen nicht so naiv, uns seine Unterstützung anzubieten ohne handfeste Gegenleistungen. Zwar liegt ihm vielleicht mehr am Verhandlungsfrieden als am gleichen Wahlrecht in Preußen. Er wird aber sogleich erkennen, dass seine Friedensidee obsolet ist, sobald wir in Russland siegen. Folglich wird er zwei Dinge gleichzeitig fordern: Erstens sollen wir sicherlich trotz der militärischen Erfolge den Bogen an Kriegszielen nicht überspannen. Zweitens wird er seine Kooperation von einer Einführung des gleichen Wahlrechts ausdrücklich vor dem Kriegsende abhängig machen.”
„Sie sagen das sehr gelassen, lieber Doktor Stresemann. Ich möchte daraus beinahe schließen, dass sie seiner Forderung womöglich zustimmen könnten. Sagen sie mir dazu bitte mehr, denn ich sehe voraus, dass insbesondere die Herren Scheidemann und Ebert noch unversöhnlicher auf dem gleichen Wahlrecht in Preußen bestehen werden.”
„Kaiserliche Hoheit, sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Ganz gewiss werden die beiden Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratie uns keinen Zentimeter entgegenkommen, ohne dass beim Wahlrecht der Durchbruch geschafft sein wird. Falls sie aber nun annehmen, ich sähe das ganz gelassen und würde der Forderung sofort nachgeben, interpretieren sie meine nüchterne Schilderung fehl. Der Grund für meine Ausgeglichenheit ist ein anderer. Ich kann mir sehr wohl eine Lösung vorstellen, die es den Herren Scheidemann, Erzberger und Haußmann ebenso ermöglichte zuzustimmen wie sie dasselbe Graf Hertling, ihnen oder sogar ihrem Herrn Vater erlaubte.”
„Jetzt haben sie mich neugierig gemacht. Immer heraus damit!”
„Ja, es gibt da einen Weg. Stellen sie sich vor, die Einführung des allgemeinen Wahlrechts fände unmittelbar, sagen wir zum 1. Februar oder zum 1. März statt, und zugleich hätte das überhaupt keine Auswirkungen auf die weitere innere Lage, keinerlei Folgen für die Position der vaterländischen Parteien. Ich bin sicher, sie wollen mehr erfahren.”
„Aber selbstverständlich, heraus damit.”
„Nun, kaiserliche Hoheit, meine Lösung bestünde darin, das gleiche Wahlrecht in Preußen sofort einzuführen, doch die Durchführung von Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus auf die Zeit nach dem Waffenstillstand zu vertagen. Und sodann würde ich noch eines darauf setzen: Diese verbindliche Aussage für die Zukunft würde ich feierlich im Reichstag durch Seine Majestät, durch den Reichskanzler in seiner Eigenschaft als preußischer Ministerpräsident und dann durch alle Fraktionsvorsitzenden der demokratischen Parteien sowie aller weiterer Parteien, die daran mitwirken wollen, unterzeichnen lassen. Ich kann mir keine wirkungsvollere, machtvollere Demonstration der Einigkeit und der Stärke der deutschen Gesellschaft im Kriege vorstellen. Sollen doch die Blätter des Westens ihre Korrespondenten zu jenem feierlichen Akt entsenden und in ihre Heimatländer berichten, wie einig das deutsche Volk hinter Kaiser, Armee und Regierung stehe.”
„Ein wahrlich genialer Gedanke, lieber Doktor Stresemann! Im Gegenzug für das Entgegenkommen der kaiserlichen Regierung würden die Führer der demokratischen Parteien nach Rücksprachen mit den ihnen nahe stehenden Gewerkschaftsorganisationen im vertraulichen Termin zusichern, den Arbeitsfrieden im Rahmen ihrer Möglichkeiten umfassend zu schützen. Das bedeutete also: keine Streiks, keine Demonstrationen der Solidarität mit der russischen Regierung, keine Demonstrationen mehr für einen Krieg ohne Annexionen und Kontributionen! Eine herrliche Vorstellung!”
„Tatsächlich ist das eine wunderbare Vorstellung. Doch ganz so einfach wird uns die Übereinkunft mit den demokratischen Parteien nicht gemacht. Denn einen Verzicht auf spontane oder auch organisierte Demonstrationen für den Frieden wird kaum jemand aussprechen. In wessen Macht sollte es denn liegen, spontane Ausbrüche der Volksmeinung zu verhindern, falls zum Beispiel die bolschewistische Regierung in Moskau öffentlich erklärte, sie verzichte auf den Einfluss über fremde Völker, die einst unter der Knute der Zaren gestanden hätten, wie zum Beispiel der Polen und Finnen, der Balten und möglichst auch der Ukrainer? Scheidemann und Ebert sind da nach meiner Erfahrung zu Recht sehr vorsichtig. Sie wissen nur zu gut, dass die radikaleren Vertreter ihrer Partei, wie Herr Liebknecht oder auch Frau Luxemburg, die Volksstimmung durchaus erfolgreich anzuheizen vermögen.
Und was die christlichen Gewerkschaften betrifft, ist die Zentrumspartei noch weitaus mehr als die Sozialdemokratie darauf bedacht, die formale Unabhängigkeit von Partei und Gewerkschaftsbewegung zu wahren und nach außen zu tragen. Alles andere würden die bürgerlichen Gruppen im Zentrum niemals tolerieren. Also wird die Reichstagsfraktion unter Erzberger nicht offen für ein Stillhalten der christlichen Gewerkschaften eintreten. Als Erkenntnis bleibt da nur Folgendes: Gespräche hinter den Kulissen zwischen den einschlägigen Parteiführungen mit den Gewerkschaftsspitzen sind das einzig denkbare Instrument, um Einfluss auf die Stimmung in den Betrieben zu nehmen.“
Ich mache eine Pause, überlege kurz und finde den neuen Gedanken sehr wohl bestechend.
„Es gibt aber sicher ergänzend die Möglichkeit, mit den Parteien über eine öffentliche Positionierung zum Burgfrieden zu sprechen.“
Der Kronprinz stutzt, scheint meine Worte auszuwerten und fragt schließlich nach.
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie da richtig verstanden habe, lieber Doktor Stresemann. Seitdem in Russland Revolution herrscht und seitdem die Reichstagsmehrheit letzten Juli die Friedensresolution beschlossen hat, steht der Burgfrieden doch eher nur noch auf dem Papier. Wie wollen sie denn da erreichen, dass der Geist des Augusts 1914 wieder belebt werden könnte?“
„Na, ich bin da etwas optimistischer als sie, kaiserliche Hoheit.
Wäre der vaterländische Geist von 1914 gänzlich verflogen, dann wäre das Jahr 1917 anders zu Ende gegangen! Ich möchte nur in Erinnerung rufen, dass Deutschland kaum Streiks erlebt hat, ganz anders als etwa Frankreich. Woran aber liegt das? Das liegt, da bin ich mir absolut sicher, an der hohen Tugend der Pflichterfüllung, die nicht nur beim deutschen Bürger, sondern auch beim deutschen Arbeiter gepflegt wird. Das liegt zusätzlich an der vaterländischen Gesinnung unserer Arbeiter, selbst dann, wenn sie die auch international eingestellte Sozialdemokratie wählen. Und das liegt drittens an der Treue zu Kaiser und Reich, wenn es ernst wird, und zwar bei allen drei demokratischen Parteien. – Kaiserliche Hoheit, es ist am Ende doch einzig und allein die Unabhängige Sozialdemokratie, die sich den Erfordernissen zum Schutz unseres Reiches vor seinen äußeren Feinden geradezu demonstrativ, ja mutwillig entzieht!“
„Wohl denn, lieber Doktor Stresemann, ihre Worte in Gottes Ohr! Anders als sie die innenpolitische Gesamtlage beurteilen, bin ich in einem Punkt näher bei Generalquartiermeister Ludendorff: Mit der Friedensresolution des Reichstags haben die Arbeiterparteien Zentrum und SPD einen wesentlichen Aspekt des Burgfriedens aufgekündigt, nämlich die Zustimmung zu Kriegszielen, die Deutschland in Europa nach diesem Kriege sicherer machen als vorher. Diese Grundhaltung aber müssen wir irgendwie rückgängig machen, um den nötigen inneren Frieden für die große Offensive im Westen und deren Ausstattung mit Waffen und Munition zu gewährleisten.“
„Genauso ist es, kaiserliche Hoheit. Das können wir schaffen, aber keinesfalls nur mit schönen Worten. Wir müssen die Demokraten nicht als unsere Gegner betrachten und behandeln, sondern als nationale Partner zur Gestaltung einer guten Zukunft. Wir müssen Zentrum und SPD gegenüber eines offen zum Ausdruck bringen: Ihr seid nicht mehr die Außenstehenden in dieser Nation, wie das noch zu den Zeiten des Kulturkampfes und des Sozialistengesetzes der Fall war! Ab heute seid ihr endgültig Teil der Willensbildung, der Gemeinschaft unseres Volkes, Teil der politischen Kräfte, deren Ziele die Reichsregierung zu erfüllen trachtet. Das ist der alles entscheidende Punkt, euer Hoheit. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir von den führenden Kreisen der Berliner Gesellschaft, das heißt eigentlich Seine Majestät der Kaiser und dessen Reichskanzler, müssen am besten für Zentrum und SPD jeweils ein lebenswichtiges, in die eigene Anhängerschaft überzeugend hineinwirkendes Zugeständnis machen. Und dann müssen wir sagen: Das gilt auch noch nach dem Krieg und wird nicht mehr zurückgedreht! Weder von den Herren Konservativen im Preußischen Abgeordnetenhaus noch von den Herren Exzellenzen Militärs in der Obersten Heeresleitung, und auch nicht von den Herren Stahlbaronen an der Ruhr.“
Ich bin bei meinem Vortag etwas laut geworden, so engagiert habe ich meine Überzeugung vorgetragen. Jetzt will ich mich wieder zurücknehmen und verschnaufe für einen Moment. Der Kronprinz lächelt. Er hat natürlich gemerkt, dass er mich jetzt in volle Fahrt gebracht hat. Das gefällt ihm augenscheinlich. Außerdem deutet sein verschmitztes Lächeln an, dass er glaubt, mich und meine weiteren Absichten durchschaut zu haben.
„Herr Doktor Stresemann, also haben sie schon eine sehr genaue Vorstellung davon, wie wir das machen sollten, die beiden Arbeiterparteien zu gewinnen, sie geradezu in die Gruppe der staatstragenden Parteien aufzunehmen. Meine Güte, wenn ich diese Zielsetzung meinem Vater oder Ludendorff oder Stinnes ausbreite, dann halten die mich für komplett verrückt geworden! Aber gut. Ich begreife, lieber Doktor Stresemann, dass sie für die Zukunft eine andere deutsche Gesellschaft wollen, und dass sie diese neue, modernere Gesellschaft für vereinbar erachten mit dem Kaisertum, mit den Tugenden des deutschen Beamten, der preußischen Armee und der streng lutherischprotestantischen Gottesfurcht.
Also bitte, damit ich mich nicht irrigen Vermutungen hingebe: Was wäre ihr Angebot an die Herren Erzberger und Ebert und Scheidemann, ja wenn sie der Kaiser wären, wenn sie so ganz alleine zu entscheiden hätten?“
Die Formulierung des Kronprinzen belustigt mich und dennoch ist sie verlockend. Sie steigert meine Einschätzung über dieses Treffen als höchst vertrauliche und konspirative Sitzung.
„Ich versetze mich in die Lage meines Gegenübers, kaiserliche Hoheit. Ich beginne bei Herrn Erzberger, weil die Konstellation der Interessen diesbezüglich einfacher ist. Herr Erzberger steht in seiner Partei und in der deutschen Öffentlichkeit für die Friedensresolution und für das gleiche Wahlrecht in Preußen. Also sollte er eines seiner beiden Ziele erreichen. Dann kann er sein Gesicht wahren und den von uns gewünschten Einfluss auf die eigene Anhängerschaft zur Geltung bringen.“
Kronprinz Wilhelm nickt und wirft kurz ein:
„Der Friede ohne Erwerbungen wird es ja nun nicht mehr sein.“
„Eben, also benötigen Erzberger und wir eine Übereinkunft zum Wahlrecht. Da müssen wir es schaffen, dass die Regierung Seiner Majestät in dem schon vorher von mir besagten Sinne eine Gesetzesänderung in den Reichstag einbringt, die für die nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus gilt und diese Wahlen binnen drei - nein besser binnen sechs - Monaten nach Friedensschluss zusagt. Denn wer von uns will heute schon wissen, wie viel Zeit die Rückführung unserer ruhmreichen Truppen aus Frankreich und Belgien in Anspruch nehmen wird?“
„Eine konkrete, eine kühne Aussage, Herr Doktor Stresemann. Mit dieser Zielsetzung gehe ich aber nicht alleine zu meinem älteren Herren und Graf Hertling! Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt, getragen von der Euphorie des gestrigen Kronrates und der Erwartungen in Bezug auf Russland, politisch vollkommen lebensmüde! Also müssen wir beide uns in aller Ruhe etwas einfallen lassen, wie wir überzeugen können.“
„Das geht in Ordnung kaiserliche Hoheit. Ich bin gerne bereit, sie zu dieser Unterredung zu begleiten. So eilig ist es damit ja noch nicht, denn die Belastungsprobe für die innere Einheit im Reich kommt ja erst, wenn der Friede mit den Russen zustande kommt. Dann allerdings muss die Regierung sofort handeln, bevor die USPD oder andere mit politischen Forderungen aufwarten. Verpassen wir diesen Zeitpunkt, quasi gleichzeitig mit der Friedensmeldung nach vorne zu gehen, verpuffte fast der gesamte gewünschte Effekt: Die Arbeiterschaft erhielte den Eindruck, Seine Majestät handelte erst dann, wenn er durch öffentliche Forderungen dazu gedrängt werde.“
„D`Accord!“
Der Kronprinz lässt die weiche französische Intonation mit sichtlichem Genuss förmlich von seiner Zunge perlen.
„Lieber Doktor Stresemann. Ich erfahre wohl binnen einer Woche, ob die Russen an den Verhandlungstisch in Brest zurückkehren und der Friede kurz bevorsteht. Dann suche ich sofort um ein Gespräch beim Kaiser nach.“
„Soweit abgemacht, kaiserliche Hoheit. Dann hätten wir die Linie zu Herrn Erzberger und zum Zentrum abgesteckt. Ich mache weiter mit den Sozialdemokraten, ihrer Mehrheit versteht sich, wenn es recht ist.“
Wilhelm fordert mich mit einer Handbewegung dazu auf.
„Herr Scheidemann ging in unsere Gespräche vom Frühjahr 1917 eigentlich mit drei Forderungen hinein. Zwei sind identisch mit den eben behandelten Zielen des Zentrums. Die dritte Forderung aber hat es in sich, ruft möglicherweise seine Exzellenz Ludendorff und vor allem die Herren Stinnes, Hugenberg und Co. auf den Plan. Es handelt sich dabei um die Errungenschaften des Gesetzes über den Vaterländischen Hilfsdienst. Die dort gebildeten Arbeiterausschüsse sind annähernd das, was die Sozialisten gerne als Betriebsausschüsse oder sogar Betriebsräte bezeichnen. Diese Belegschaftsvertretungen in den Großbetrieben sind ja eigentlich das, wovon die SPD träumt, um die deutsche Gesellschaft in Richtung von mehr Gerechtigkeit zwischen den Klassen, zwischen Arbeiterschaft und Großkapital, entwickeln zu können. Scheidemann und Ebert hoffen zugleich, dass ein Erfolg in dieser Frage den Radikalen um Liebknecht gehörig den Wind aus den Segeln nähme. Das wiederum könnte man nun schon als gemeinsames Ziel der Sozialdemokraten - aber jetzt muss man wohl genau Mehrheits-SPD sagen - dann weiter von ihnen und mir, der kaiserlichen Regierung, der OHL und Seiner Majestät selbst kennzeichnen.“
„So weit reicht die Analyse. Doch eine eher noch abstrakte Vorstellung von den zukünftigen gesellschaftlichen Verhältnissen zu entwickeln, mein lieber Doktor Stresemann, bedeutet in meinen Augen noch keineswegs eine Lösung für die praktische Frage, wie der Kompromiss denn nun wirklich aussehen soll. Sie haben ja auf die Ruhrbarone zu Recht verwiesen. Ich bring es in meinen Worten auf den Punkt: Hugenberg und Konsorten sind die Beibehaltung des Herr-im-Hause-Standpunktes in den Großbetrieben der Eisenindustrie und auf den Steinkohlezechen ebenso wichtig wie die Annexion von Longwy/Briey! Welchen Trick haben sie denn auf Lager, um diese aus meiner Sicht sogar unüberwindliche Hürde zwischen den Klassen zu nehmen?“
„Das ist die Kernfrage der Macht im Reich, euer Hoheit! Können die Herren von der Ruhr beides bekommen, den totalen Sieg und die Stutzung der Rechte der Arbeiterschaft? Dürfen die Herren von der Ruhr tatsächlich die entscheidende Machtinstanz sein, die anstelle von Kaiser und Reichskanzler darüber entscheidet, wie die Strategie des Reiches zur erfolgreichen Beendigung des weltweiten Völkerringens ausfällt?“ Ich blicke dem Kronprinzen fest, fast provokativ offen und lange in die Augen. Er hält dem stand und sinniert offenbar ernsthaft über meine Worte. Er kneift die Lippen leicht aufeinander und dokumentiert mir damit, wie sehr wir hier einen zentralen Aspekt unserer Friedensstrategie erreicht haben.
„In der Tat, lieber Doktor Stresemann, das ist eine kleine Revolution, eine weiße Revolution, eine Revolution von oben! Sie vertreten die These, dass wir ganz im Sinne Hegels – der Staat steht über den Dingen, den Interessen und Gruppen und hat nur das Gemeinwohl im Blick – die Partikularinteressen der Arbeiterschaft über die Einzelinteressen der Industrie stellen sollen, und das auch noch im Namen und mit ausdrücklicher Billigung der Krone.“
Wilhelm wechselt den Gesichtsausdruck von ernst und nachdenklich auf schalkhaft lächelnd.
„Nachher sind es nicht die Millionen Arbeiter, die Revolution machen in Deutschland, lieber Stresemann, sondern die Ruhrbarone, die Junker und die Militärs, die den Kaiser absetzen.“
Da muss ich lachen. Dann fange ich mich, sortiere sehr wohl den wahren Kern, der in der humoristisch vorgetragenen Befürchtung des Kronprinzen steckt, und sortiere meine Gedanken.
„Das wird nicht geschehen, euer Hoheit, da bin ich sehr sicher. Aber nicht nur aus dem einen Grund, dass der preußische Junker niemals gegen seinen Herrn und König rebellieren wird. Es gibt noch wichtige andere Gründe dafür: Die Millionen Arbeiter würden für den König und Kaiser auf die Straße gehen, würden in den Fabriken die Räder still stehen lassen und den Ruhrbaronen damit die Grenzen ihrer Macht aufzeigen.
Für mich ist etwas ganz anderes jedoch noch wichtiger für unser beider reines Gewissen, für die Überzeugungskraft unserer Initiative: Das Reich, die Regierung, der Kaiser würden nicht einfach die Verfolgung des einen Gruppeninteresses durch die Ziele einer anderen Gruppe ersetzen. Ganz im Geiste Hegels würde der Staat identifizieren, was seine eigenen, überlebenswichtigen Ziele und gesellschaftspolitischen Interessen sind. Und dann stellen wir fest, welche Übereinstimmung besteht zwischen den Voraussetzungen für die militärische Erkämpfung des Sieges hier, für die Sicherung des inneren Friedens nach dem Krieg und für lange Zeit dort. Und schließlich würden wir erkennen, welche breite Übereinstimmung besteht zwischen der Staatsräson hier und den Forderungen und dem nachvollziehbaren Selbstwertgefühl der Millionen zählenden Mehrheit unseres Volkes dort.
Kaiserliche Hoheit, wie 1806 steht Preußen wieder am Scheideweg. Wir haben die Wahl zwischen Reformen, die Deutschland erneut an die Spitze der Völker bringen werden, sowohl was den gesellschaftlichen Fortschritt als auch was seine Macht in Europa betrifft, oder aber zwischen dem Festhalten an der alten Macht, die vielleicht niemals so untergraben wird wie in Russland derzeit, die aber vermutlich allein zu schwach sein dürfte, um unsere nun wahrlich mächtigen Feinde Frankreich, England und Amerika zu bezwingen.“
„Jetzt sind sie in Rage, lieber Doktor Stresemann! Konservieren sie bitte ihren Schwung, ihre Leidenschaft, ihre Überzeugungskraft und – ja auch ihre Staatsräson für Preußen und das Reich. Genau so müssen wir in das Gespräch mit meinem Vater hinein gehen! Und wir müssen taktisch im Vorfeld alles daran setzen, dass da nicht wieder der gesamte Kronrat sitzt, der dann alles nur in Frage stellt und klein redet. Was wir brauchen, ist im besten Falle ein Gespräch unter acht Augen. Nun gut, mein Vater wird den Chef seines Zivilkabinetts Rudolf von Berg wohl hinzuziehen wollen, aber das schadet nichts, es wäre dann die ideale Konstellation.“
„Sehr gut haben sie das auf den Punkt gebracht, kaiserliche Hoheit. Sie werden mir zustimmen, dass ich diesbezüglich über keinerlei Einfluss auf Seine Majestät verfüge. Wären sie so freundlich, zur Anbahnung eines solchen, höchst vertraulichen Gespräches tätig zu werden?“
„Was bleibt mir anderes übrig, wenn wir Erfolg haben wollen, lieber Doktor Stresemann? – Ich möchte festhalten: Wir haben es nicht leicht mit all dem, was wir uns heute so vorgenommen haben, aber wir sind im Geschäft!“
Ich atme tief ein und aus. Die Erinnerung an mein erstes vollständig vertrauliches Gespräch mit Seiner Majestät dem Kronprinzen hinterlässt in mir ein wohliges Gefühl. Meine Schulter schmerzt. Sie ist vom langen Liegen verspannt. Ich wälze mich in meinem Krankenhausbett und öffne die Augen. Die hohe Zimmerdecke zeigt an ihrem umlaufenden Rand zu den Wänden einen feinen Putz. Das Muster wird wohl dem Stil des Empire entstammen, so schlicht und handwerklich präzise das klassische griechische Muster gestaltet ist. Kurz darauf schließe ich erneut die Augen und atme ein weiteres Mal tief und erleichtert aus.
Neujahr 1918 am Hofe des griechischen Königs Alexandros I.. Der seinem Vater erst 1917 auf Drängen der britischen Verbündeten auf den Thron gefolgte, erst 24-jährige Monarch gibt ein rauschendes Silvesterfest für seinen nach europäischen Maßstäben eher kleinen Hof, dafür aber mit einem wahrlich imposanten Feuerwerk für sämtliche Bewohner seiner Hauptstadt. Neben dem König und seiner deutschem Hochadel entstammenden Mutter Sophie steht auch Alexandros zwei Jahre jüngere Schwester Helene. Sie ist erst zwei Wochen vor Weihnachten von einem beinahe halbjährigen Aufenthalt am Hofe des Deutschen Kaisers in Berlin zurückgekehrt. Als die bunten Leuchtraketen den sternenklaren Athener Nachthimmel mit lautem Krachen erstrahlen lassen, schreckt Helene zusammen. Sie denkt unwillkürlich an das Granatfeuer der Artillerie in Nordfrankreich, das Franzosen und Briten hüben, Deutsche drüben todbringend aufeinander abfeuern. Und während der Athener Silvesterhimmel für mehr als zwanzig Minuten unter einem wirklich beeindruckenden pyrotechnischen Meisterwerk erleuchtet, bleiben der jungen Prinzessin Helene lange Momente der Muße für einen Tagtraum, der sie fast genau vier Monate zurück in die Vergangenheit nach Berlin entführt.
Damals, am 2. September 1917, hatte ihr Onkel Kaiser Wilhelm II. den Hof und die Spitzen der Berliner Gesellschaft ins Stadtschloss zum großen Ball anlässlich des Tages von Sedan geladen. Die Schlacht von Sedan bedeutete 1870 die Entscheidung im deutsch-französischen Krieg. Ihr folgte im Januar 1871 die Gründung des Deutschen Reiches im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles durch die deutschen Fürsten. So wie dieser Gründungsakt bereits einen Affront für die Grand Nation bedeutete, so unvergesslich und inakzeptabel wirkte seitdem für Frankreich der Verlust des fortan deutschen „Reichslandes“ Elsass-Lothringen. Für Frankreich war die Rheingrenze, die es 1648 offen gefordert und bis 1733 endgültig erreicht hatte, seit der französischen Revolution von 1789 gleichbedeutend mit dem unveräußerlichen, unverletzlichen Kernsbestand der Nation selbst. Nicht die elsässische Zunge, sondern der gemeinsame Glaube aller Franzosen an die hehren Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit konstituierten seitdem im nationalen Selbstbewusstsein Frankreichs die Ausdehnung der Nation nach Osten. Also trafen im Elsass seit 1871 mit Frankreichs Bild von der politischen und Deutschlands Bild von der Kulturnation zwei Grundverständnisse der nationalen Frage aufeinander, die den Gegensatz beider Nationen stetig verschärfen sollten.
Am Tag von Sedan war Prinzessin Helene im Kreise ihrer Freundinnen von Hofe, etwa gleich alte junge Damen aus preußischen Adelsgeschlechtern oder gar deutschen Fürstenhäusern, frohen Mutes auf den Ball geeilt, insbesondere um fesche und stattliche junge Gardeoffiziere zu bewundern und auch das eine oder andre Tänzchen zu wagen. Für Helene war der Ball ein einprägsames Ereignis, weil sie nicht nur das eine um das andere Mal mit einem jungen Herren tanzte, sondern weil ihr der Oberleutnant der Artillerie Thorsten Ballin vom 109. Preußischen Artillerieregiment, an der Somme in Frankreich stationiert, seitdem nie mehr so ganz aus dem Kopf ging. Was war denn eigentlich so besonderes an diesem ein wenig schüchternen, introvertierten Offizier? Dass er groß und schlank war, gut aussah mit kurzen dunkelblonden Haaren und aufgeweckten blauen Augen, das hob ihn nun nicht wirklich von der Mehrzahl seiner Berufskollegen ab. Dass er nicht von Adel ist, sondern der Sohn eines der reichsten Hamburger Großbürgers, des Reeders und Eigentümers der HAPAG, Albert Ballin, machte ihn für Helene nicht minder attraktiv. Diese Sicht der Dinge mochte zwar ihre Mutter keineswegs teilen, da war sich Helene sicher. Doch zugleich wurde sie zutiefst von der Überzeugung erfüllt, dass mit und nach diesem Kriege eine Zeit anbrechen werde, in der die königliche Geburt weit weniger zählen mochte als der Charakter und die Liebe.
Übrigens hatte sie an jenem Abend der Übermut gepackt, so dass sie sich Oberleutnant Ballin nicht als Helene, sondern getrau ihrer Heimat Hellas gleich als Helena vorstellte. Gefangen nahm Helene an Thorsten Ballin seine ruhige, nicht aufschneidende Art, wie es bei deutschen Offizieren nicht so selten vorkommt. Vor allem aber konnte sie sich mit ihm tatsächlich unterhalten, und zwar nicht nur über das Wetter und den Alltag bei Hofe. Sehr schnell erlangte ihr Gespräch eine gewisse Tiefe, als es um die schmerzhaften Fronterfahrungen des jungen Mannes ging, oder dann ebenfalls um die leidvollen Erinnerungen Helenes an ihren Vater und dessen Abdankung im Frühjahr 1917. Das große persönliche Opfer hatte der König nur auf sich genommen, um die Dynastie auch unter den neuen Bedingungen des von der Entente aufgezwungenen Bündnisses zu bewahren.
Am Ende dieses Abends versicherten sich Helene von Griechenland und Thorsten Ballin recht knapp, sehr aufgeräumt und kein bisschen wehmütig über die Trennung, dass sie sich wohl gerne wiedersähen. Seitdem jedoch ging für Helene diese Leichtigkeit ein über das andere mal verloren, weil ihre Erinnerungen an jenen Oberleutnant Thorsten Ballin nicht mehr vergehen wollten, weil sie immer häufiger die Sehnsucht nach einem Wiedersehen erfüllte, und weil sie eigentümlich feststellte, dass kein anderer junger Mann in den letzten Jahren eine solche, nachhaltige und bleibende Wirkung bei ihr hinterlassen hatte. Helenes Abschied von Berlin und die lange Zugfahrt bis an die kroatische Adriaküste, um von dort aus das Schiff nach Athen zu besteigen, gaben ihr viel Zeit, über ihre Monate in der Reichshauptstadt nachzudenken, ihre starken Gefühle für ihre Freundinnen - und eben auch für Thorsten Ballin - zu erinnern. Jetzt steht Prinzessin Helene erneut hier und wird durch ein zufälliges Ereignis, das schlichte Explodieren von Feuerwerksraketen, an jenen Thorsten Ballin erinnert, von dem sie doch noch so wenig weiß, den sie aber wieder sehen und besser kennen lernen möchte. Und dann ist da plötzlich auch wieder, wie bereits während der Zugfahrt durch Österreich, die unbestimmte Angst davor, dass Oberleutnant Ballin diesen Krieg, dieses neue Kriegsjahr vielleicht gar nicht überleben werde.
Die letzten Gerüchte bei Hofe vor Prinzessin Helenes Abreise aus Berlin lauteten: Jetzt kommt der Waffenstillstand mit Lenin, dann sehr bald der Frieden mit Russland und dann wird das mächtige deutsche Heer millionenfach seine kampferprobten Männer von Ost nach West schicken, um in einer Offensive, wie die Welt noch keine gesehen hat, den Krieg auch endgültig in Frankreich für sich zu entscheiden. Helene durchfährt dabei eine einzige Gefühlsregung: Möge Gott geben, dass Oberleutnant Thorsten Ballin diesen Sturm und auch den gesamten noch vor uns liegenden Teil des Krieges gesund überstehen möge - ja, auch deshalb, damit ich ihn einstmals wiedersehen kann.