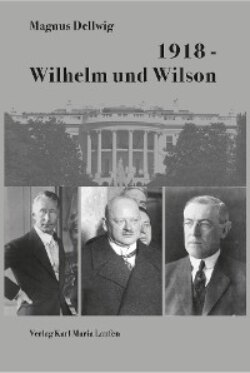Читать книгу 1918 - Wilhelm und Wilson - Magnus Dellwig - Страница 8
2 1917 - Das große Vorspiel
ОглавлениеLenin reist auf Geheiß der deutschen Reichsregierung nach Sankt Petersburg.
Deutschland eröffnet erneut den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen Großbritannien.
Deshalb treten die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg ein.
Der Deutsche Reichstag verabschiedet die Friedensresolution.
Der Kaiser entlässt während der Beratungen Reichskanzler Bethmann-Hollweg.
In Russland bricht nach der Februarrevolution auch noch die Oktoberrevolution aus. Die Bolschewiki scheinen bereit zum Frieden.
All das war das unglaubliche, das wahnsinnige Jahr 1917. So ein Jahr hatte ich noch nie zuvor erlebt. Und ich bin mir recht sicher: die meisten Politiker im Deutschen Reich und in vielen weiteren Teilen Europas auch nicht.
Doch was ist in meinem Gedächtnis eigentlich das Wichtigste an jenem Vorbereitungsjahr für die Entscheidung über den weiteren Gang unseres Jahrhunderts geworden? Es waren für mich persönlich gar nicht all die eben in meine Erinnerung gefluteten großen Ereignisse. Es waren für mich selbst der Beginn meiner Freundschaft mit Walther, mit Walther Rathenau, mit dem ich fortan auf das Engste würde zusammenarbeiten dürfen, zuerst in der Friedensdelegation des Reiches und dann über viele Jahre in der Reichsregierung. Das verbrecherische, zum Glück gescheiterte Attentat auf ihn riss mich dann 1922 aus der trügerischen Illusion, alle bedeutenden Gruppen der deutschen Gesellschaft hätten ihren eigenen Frieden mit der großen Errungenschaft des Weltfriedens von 1919 gemacht. Und doch ist da eine zweite Erinnerung an 1917, denn es war das Jahr der großen Vorbereitung auf eine neue Zeit. In mir begann ein abgründiger Zweifel zu nagen, ob meine bisherigen, unverbrüchlichen politischen Überzeugungen davon, was für das Wohl unseres Vaterlandes nicht nur das Beste, sondern zugleich das allein Richtige sei, noch in Gänze Bestand hätten. Durch all die besagten großen Ereignisse der Geschichte im Inneren wie in der Weltpolitik wurde mir, Gustav Stresemann, damals 1917 noch stellvertretender Vorsitzender der Reichstagsfraktion der Nationalliberalen Partei, jedoch wegen der fortschreitenden Erkrankung des armen Bassermann schon ihr meistbeachteter Redner, plötzlich bewusst, wie weit meine eigenen, sehr persönlichen politischen Anschauungen im Sinne althergebrachter Vorstellungen von links und rechts, liberal und konservativ doch auseinander lagen. Im Äußeren passte zwischen die westdeutsche Schwerindustrie und mich kein Blatt, denn ich trat für Annexionen im Westen, für den U-Boot-Krieg als tödliche Waffen gegen England, somit gegen jedes Ansinnen nach einem Verständigungsfrieden ein. Im Inneren erkannte ich im Sommer 1917 dagegen, wie brüchig die Herrschaft der Monarchie zu werden drohte, falls es uns, Adel und Bürgertum, nicht gelänge, die einzigen beiden großen Volksparteien des Reiches, nämlich das katholische Zentrum und die Sozialdemokratie, in Gesellschaft und Staat zu integrieren und damit alle Gruppen unseres Landes mit dem Ziel großer gemeinsamer Überzeugungen zu versöhnen. Ich erinnere mich plötzlich wieder an so wichtige Gespräche, die sich in den Logen des Reichstages mit den Großen der sich am Horizont der Zukunft abzeichnenden Parlamentsmehrheit abspielten: Erzberger vom Zentrum, Ebert und Scheidemann von der Sozialdemokratie. Und außerhalb des Hohen Hauses traf ich schon seit dem Herbst 1916 immer wieder die Wirtschaftsmagnaten Albert Ballin von Deutschlands größter Schifffahrtsgesellschaft, der HAPAG, und natürlich Walther Rathenau von der AEG. Diese Begegnungen begannen mein Weltbild zu formen, und darüber veränderten sie mein politisches Denken, Fühlen und Handeln. Ohne diese tiefe Veränderung, die in mir selbst sich vollzog, wäre mein tatkräftiges Mitwirken an den bahnbrechenden Ereignissen hin zum Friedensschluss 1918 gar nicht vorstellbar geworden.
Was war es denn noch einmal, das meine Sicht auf die deutsche Innenpolitik so deutlich verschob? Es war nicht, wie für die meisten Sozialdemokraten, der tiefe Eindruck, den die Februarrevolution im Russischen Reiche bei der öffentlichen Meinung in Deutschland hinterließ. Durchaus subtiler nahm ich bereits im Frühjahr - so ab März 1917 - wahr, wie sich der Umgang der führenden Leute des Zentrums und der SPD miteinander wandelte. Und auch nicht wenige Liberale suchten merklich den Kontakt, das Gespräch mit jenen Herrschaften. Noch 1916 waren mir selbst die Herren Erzberger und Scheidemann ziemlich, nein ich muss sagen eher vollkommen zuwider. Da gibt es nichts zu beschönigen. Beide traten als Wortführer ihrer Parteien im Reichstage offen für einen Verhandlungsfrieden und gegen die Wiederaufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegen England ein. Für mich bedeutete dies damals noch Verrat an unserem Vaterland, an seinen lebensnotwendigen wirtschaftlichen Interessen. Dennoch vermochte ich zu jener Zeit meine persönlichen Meinungen und Antipathien sehr wohl von den Geboten der politischen Klugheit zu unterscheiden. Wie mancher Liberaler in der Fortschrittspartei rechnete ich mir aus, dass SPD und Zentrum bei den ersten Wahlen zum Reichstag nach dem Kriege zusammen vielleicht die absolute Mehrheit erringen würden. Dann rückten sie in eine unsägliche strategische Vetoposition: Kein Haushalt mehr, kein Flottengesetz und keine Heeresvorlage, ja nicht einmal mehr ein Steuergesetz würden zukünftig noch ohne die Massenparteien zu beschließen sein. Man bedenke, es handelte sich um jene zwei Parteien, welche der ehrwürdige Fürst Bismarck noch als die Feinde des Reiches öffentlich verurteilte und auszugrenzen trachtete. - Spätestens im März/April 1917 wusste ich unwiderruflich: Die Ausgrenzung der Katholiken im Westen sowie der sozialistischen Arbeiter überall im Reich war endgültig gescheitert! Wollte die Monarchie selbst nicht am Ende dieses wahrlich großen Volkskrieges scheitern, musste sie sich bewegen: Preußen und das Reich, Adel, Industrielle und der Kaiser selbst würden entweder die deutsche Gesellschaft weit öffnen, oder aber sie liefen hohe Gefahr, in einem zukünftigen, vielleicht gar nicht all so fernen Bürgerkriege selbst von Grund auf überrollt, von der Geschichte hinweggefegt zu werden, zu großen Teilen gegen ihren Willen versteht sich.
So wurde ich im Frühjahr 1917 vom Wolf des Annexionismus insgeheim zum Brückenbauer einer parlamentarischen Volksgemeinschaft ganz anderer Art, als die etablierten Eliten im Reich sich das damals noch vorzustellen vermochten. Das besagte indes keineswegs, dass ich zu jener denkwürdigen Zeit bereits meine Vorstellungen von den Kriegszielen des Reiches nennenswert zu ändern begonnen hätte. Nein, Nein! Davon war ich noch ein gehöriges Stück entfernt. - Doch halt! Meine Gedanken werden unsystematisch, kreisen mehr um mich selbst denn um die großen Linien unserer nationalen Geschichte am Ende des Weltkrieges. Dem will ich Einhalt gebieten! Das Einzige, und das ist freilich gar nicht wenig, was wirklich von nationaler Bedeutung war am Wirken des Gustav Stresemann im Jahre 1917, war seine Verwobenheit in die Netzwerke gewichtiger Teile der Entscheidungsträger auf recht verschiedenen Ebenen unseres deutschen Volkskörpers. Es waren tatsächlich drei kleine Gruppen, Zirkel gar von konspirativer Kraft, in denen mir vergönnt war mitzuwirken. Und ich selbst war wohl der Einzige, der in allen drei Kreisen zugleich tätig wurde. Das mutete mir schon damals einzigartig an und ich beschloss im Frühling und im Frühsommer 1917, daraus das Beste zum Wohle unseres Vaterlandes zu machen. Nun, um welche Kreise handelte es sich denn?
Zum ersten, da mir persönlich so sehr vertraut und nahe stehend, gab es ein Grüpplein von Wirtschaftsführern, Vertretern der modernen, auf den Export gerichteten Industrien und von Dienstleistungen mit ähnlichen Interessen. Die unangefochtene Autorität hatte der ehrwürdige Albert Ballin, Generaldirektor der HAPAG-Schifffahrtslinie, inne. Ich lernte ihn 1913 kennen, als wir beide eine Reise in die USA und nach Kanada unternahmen. Damals übte ich das Amt eines Syndikus der sächsischen Industrievereinigung aus. Dieses Erlebnis festigte in uns beiden die Überzeugung, dass der freie Welthandel und die Kooperation des Reiches mit den Vereinigten Staaten als der größten Wirtschaftsnation der Erde zentrale Weichenstellungen für eine gute Zukunft sein sollten. Ebenso wichtig wie Albert war mein inniger Freund Walther Rathenau, Präsident der AEG und anerkannter Experte auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft seit seinen Tagen als Leiter des Kriegsrohstoffamtes 1914 und 1915. Aus jenen ersten Monaten nach Kriegsbeginn einte Walther und mich die Überzeugung davon, dass der freie Markt unter so besonderen Umständen wie im Krieg der Lenkung durch etwas noch Größeres, nämlich unseren deutschen Staate bedürfe. Uns verbanden zudem nicht mehr zu zählende subtile Erlebnisse vom alltäglichen, unterschwelligen Antisemitismus in Deutschland. Während Walther Rathenau selbst prominente Zielscheibe war, musste ich für meine liebe Frau Käte erfahren, was es bedeutete, aus der ja schließlich zum Protestantismus konvertierten jüdischen Industriellenfamilie Kleefeld zu stammen. Nie werde ich Walthers unglaublich scharfes und zugleich so bitter wahres Zitat zum Judenhass vergessen: „Der Antisemitismus ist die vertikale Invasion der Gesellschaft durch die Barbaren.” Wie sehr sollte der Anschlag auf sein Leben von der Hand radikaler, verblendeter Mörder ihm Recht geben!
Wir drei, Albert, Walther und ich, trafen uns seit 1916 regelmäßig, mindestens einmal monatlich, um über den Krieg, die Lage in Deutschland, das Notwendige in der Politik zu beratschlagen. Selten kamen weitere führende Repräsentanten der Wirtschaft hinzu. Doch Wert legten wir sehr wohl auf die Meinung der IG-Farben-Direktoren Carl Duisberg und Carl Bosch, die vereinzelt unsere Treffen in Berlin bereicherten. Ich selbst sprach ferner noch häufig mit Karl Helfferich, einer wahrlich schillernden Persönlichkeit. Er vereinigte den Vorstand der Deutschen Bank, den Staatssekretär des Inneren vor Kriegsausbruch und den konservativen Politiker in sich. Es versteht sich von selbst, dass wir unsere Treffen möglichst geheim hielten, schließlich hätte dies meinen „Parteifreunden” bei den Nationalliberalen aus den Kreisen der Kohle, der Eisen- und Stahlerzeugung gar nicht gefallen. Forderten jene vehement die Eingliederung der französischen Erze in Lothringen in das Reich, stand bei uns eine kontinentaleuropäische Zoll- und Wirtschaftsunion unter deutscher Lenkung im Vordergrund der Kriegsziele. Beharrten jene mit dem „Herr-im-Hause-Standpunkt” in den Betrieben auf dem Dreiklassen-Wahlrecht in Preußen, konnten wir uns auch andere Lösungen vorstellen. - Doch jetzt schweife ich erneut ab von den persönlichen Netzwerken hin zu den politischen Streitfragen von 1917. Zuvor will ich mich erinnern, welche weiteren Zirkel mein Denken und Handeln bestimmten, als im Februar die Revolution in Russland begann und damit eine Kette unabsehbarer Ereignisse auslöste.
Die Spitze von Staat und Armee, Reichsregierung und Oberster Heeresleitung, war 1917 selbstverständlich das starke Machtzentrum unseres Reiches. Mir als designiertem Vorsitzenden der Nationalliberalen Reichstagsfraktion, also einer ohne jeden Zweifel wichtigen staatstragenden Kraft, der Repräsentanz des Industriebürgertums aller Schattierungen, standen so manche Türen und Ohren offen, wie das sich die Vertreter der nur ein wenig weiter links im Parteienspektrum verorteten Fraktionen oftmals sehr gewünscht hätten. Deshalb wurde ich ja zu genau jener Zeit im März 1917 deren privilegierter Gesprächspartner über die Reform der Reichsinstitutionen selbst, obgleich nicht jeder von ihnen auf meine absolute Loyalität gewettet hätte. - Aber zurück zur Reichsleitung: Im Mittelpunkt meiner informellen Gespräche schon 1916 standen zwei herausragende Persönlichkeiten unseres Landes, nämlich seine königliche Hoheit, Kronprinz Wilhelm höchst persönlich, und weiter der Generalquartiermeister der Obersten Heeresleitung, Generalleutnant Erich Ludendorff, der starke Mann hinter dem geistig weit weniger wendigen Oberbefehlshaber Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Mittelsmann zu Ludendorff war der damals legendäre Oberst Max Bauer, der Vertraute Ludendorffs schlechthin und sein Mann für zuweilen delikate politische Kontakte, ob nun in den Reichstag hinein oder zu solchen Vereinigungen wie dem säbelrasselnden Alldeutschen Verband mit seinen maximalistischen Kriegszielen. Der Kronprinz und Ludendorff betrachteten mich als den zukünftigen starken Mann der Nationalliberalen, meine Partei wiederum als den Dreh- und Angelpunkt des politischen Systems in unserem Lande. Die Konservativen als Partei des Adels und der Bauern standen bei aller Staatsräson zu weit rechts, um mit den beiden größten Fraktionen, dem Zentrum und der Sozialdemokratie überhaupt nur sprechen zu können. Folglich fiel mir in den Augen der alten ostelbischen Elite wie selbstverständlich die Rolle zu, für die Politik der Regierung zu werben, gleichzeitig auszuloten, welche Kompromisse möglich waren, aber ebenso, welche Zugeständnisse das alte Reich wohl würde machen müssen, um die eigene Macht im Lande nicht zu schwächen oder gar zu gefährden.
Ich denke wohl, den Herren Hohenzollern, Ludendorff und Bauer nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Dafür sprach allein schon mein fortwährendes Werben für einen Ausbau der sozialen Systeme aus der Vorkriegszeit. Zu wichtig war mir nämlich, die wachsenden Schichten der Angestellten mit der preußisch-deutschen Monarchie zu versöhnen und darüber in der Zukunft liberale Wähler zu gewinnen. Letzten Endes doch verlässlich erschien ich den kaiserlich-militärischen Herren indes wohl deshalb, weil ich 1916 und auch sehr wohl 1917 aus vollster Überzeugung und ohne Unterlass für die Kriegsziele des Reiches in aller Öffentlichkeit, im Reichstag und in allen Blättern eintrat. Sicher trauten wir uns nicht restlos, aber jeder von uns Dreien gab etwas auf das Wort, die Meinung des anderen und dachte gehörig darüber nach, ob nicht das wohl unseres Landes danach verlangte, ein inniges Bündnis aus Reichsleitung und Nationalliberaler Reichstagsfraktion zu schmieden und zu wahren.
Wie sehr ein Bündnis ganz anderer Art zum Wohle unseres Vaterlandes würde gedeihen mögen, darüber spekulierte ich mit völlig anderen Herren: Wieder war es ein vertrauter Dreier-, dann Viererkreis, in dem sehr geheime Gespräche über die Zukunft der politischen Ordnung unseres Landes geführt wurden. Matthias Erzberger vom Zentrum, Conrad Haußmann von der Fortschrittlichen Volkspartei, also den Liberalen links von uns Nationalliberalen, und Philipp Scheidemann von der Sozialdemokratie trafen sich im März 1917. Als ich davon erfuhr, beantragte ausgerechnet ich, der Nationalliberale, im Reichstag hoch offiziell die Einrichtung des Verfassungsausschusses. Ich war mir sicher, dass eine tragfähige Übereinkunft der demokratischen Mehrheit im Parlament mit uns Nationalliberalen eben nur über die behutsame Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechtes zu erzielen war. In jenem März 1917 zogen mich die drei Fraktionsführer zu ihren Gesprächen hinzu, weil sie für ihr Vorhaben der Unterstützung meiner Fraktion dringend bedurften. Die drei Kollegen Reichstagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende einte die Erwartung, dass die soeben begonnene Revolution in Russland nicht ohne Folgen für die beiden Kaiserreiche der Mittelmächte bleiben würde. Wir vier dachten ähnlich. Wir befürchteten ein Erlahmen der Kriegsunterstützung bei den Massen an der Heimatfront. Und sehr bald bestätigten sich unsere Erwartung. Vom 6. Bis zum 8. April fand der Gründungskongress der so genannten „Unabhängigen“ SPD statt, getragen von 20 Abweichlern aus der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion samt ihres Anhangs.
Wenn nun aber die Männer und Frauen in den Fabriken nicht mehr ihr Bestes gaben, um zehn Stunden am Tag Munition und Waffen, Uniformen und alles Weitere herzustellen, ja wie sollten wir dann diesen brutalen Material- und Abnutzungskrieg gegen einen materiell und zahlenmäßig überlegenen Gegner gewinnen? Unsere Gespräche kreisten um zwei Themen, das Wahlrecht in Preußen und eine denkbare Friedensinitiative des Reichstages. Jeder von uns hatte wiederum in seinen Reihen wichtige Gesprächspartner, die uns stets das Gefühl vermittelten, in unseren Parteien jeweils nicht alleine da zu stehen. Für Scheidemann war sein Parteivorsitzender Friedrich Ebert wohl ein genau so bedeutender Rückhalt wie mein noch Parteivorsitzender Ernst Bassermann für mich. Dieser gute alte Freund, so gebrechlich er in seinen letzten Lebensmonaten bis zum Juli 1917 auch wurde, so uneingeschränkt hat er mir Mut zugesprochen, zum Wohle des Reiches eine große Koalition aus linken wie rechten Liberalen, Zentrum und eben auch SPD zu erreichen.
Doch erneut springe ich von den inneren Kreisen der Macht zu den Inhalten der Politik in jenem Schicksalsjahr 1917. Also will ich nur die wichtigsten Ereignisse einmal der Reihe nach zusammen bringen.
Februar 1917, der Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Krieges des Deutschen Reiches gegen Großbritannien, anschließend werden die diplomatischen Beziehungen durch die USA gegenüber dem Reich abgebrochen.
März 1917, Sankt Petersburg, in der Hauptstadt des Russischen Reiches bricht die Revolution aus. Die Liberalen, die Demokraten und die Menschewikí als die gemäßigten Sozialdemokraten bilden in der Folge eine Regierung. Russland bleibt zwar an der Seite der Entente, doch seine Kampfkraft sinkt rapide, nicht zuletzt durch Massendesertationen der einfachen Soldaten, die endlich wieder nach Hause, auch die Ernte einfahren wollen.
März 1917, die Sozialdemokraten im Deutschen Reichstag fordern unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Russland so vehement wie niemals zuvor die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes in Preußen. Wer millionenfach für sein Vaterland als Soldat sein Leben riskiere oder diszipliniert bis zur Erschöpfung in den Fabriken arbeite, so die Argumentation, habe das uneingeschränkte Wahlrecht verdient - ein Wahlrecht, das übrigens ja seit 1871 für die Wahlen zum Deutschen Reichstag bereits Gültigkeit besitze.
7. April 1917. Kaiser Wilhelm II. kündigt auf erheblichen Druck Bethmann-Hollwegs hinter den Kulissen der Reichshauptstadt in seiner Osterbotschaft die Aufhebung des Preußischen Drei-Klassen-Wahlrechtes für die Zeit nach dem Kriege an.
April 1917, 20 Abgeordnete der SPD im Reichstag gründen die USPD. Der Parteiführer der radikalen russischen Sozialdemokraten, der Bolschewiki, Lenin, durchquert im berühmt gewordenen blombierten Eisenbahnwaggon - Ausdruck der Exterritorialität seines Verkehrsmittels - aus dem Schweizer Exil kommend Deutschland bis zur Ostseeküste, um dann über Schweden und Finnland ankommend ab Ostern in die Russische Innenpolitik einzugreifen.
Ebenfalls April 1917, die Vereinigten Staaten von Amerika erklären dem Deutschen Reich den Krieg. Im Juni beginnt die Mobilmachung von Truppen, deren erste Verbände im Juli in Frankreich eintreffen.
Juli 1917, am 2. des Monats weicht der Reichskanzler uns vier Fraktionsführern gegenüber in der Frage der Wahlrechtsreform und des Friedens auf unerträgliche Art und Weise aus. Mit der Friedensresolution des Deutschen Reichstags vom 16. Juli befürwortet die Parlamentsmehrheit aus Zentrum, Sozialdemokraten, Fortschrittlichen und einem Teil der Nationalliberalen die Aufnahme von Friedensverhandlungen, im Grundsatz auf der Grundlage des Status quo ante Bellum.
Zeitgleich im Juli 1917, nach acht Jahren Kanzlerschaft wird Theobald von Bethmann-Hollweg als Kanzler des Deutschen Reiches entlassen. Wegen seiner Sympathien für eine Wahlrechtsreform und seiner - angesichts der Debatten um die Friedensresolution sichtbar werdenden - Distanz zu Kriegszielen, die mit der Entente wegen ihrer Maßlosigkeit schlicht nicht verhandelbar sind, betreiben Konservative und Schwerindustrie, Oberste Heeresleitung und der Kronprinz den Vertrauensentzug durch den Kaiser. Aber auch wir von der Reichstagsmehrheit stehen nicht mehr hinter ihm, nachdem er uns noch im Gespräch am 2. Juli jede Unterstützung versagt hatte. Gewonnen hatten wir dadurch leider nichts, denn die OHL alleine bestimmte mit Michaelis den neuen Kanzler. Auch ich war noch nicht reif, oder besser gesagt abgebrüht genug, um schon damals klug modellierte, selbst für Kaiser und OHL unabweisbare Forderungen nach einer Regierungsbeteiligung meiner Partei und der drei demokratischen Fraktionen zu erheben.
September 1917, Gründung der Deutschen Vaterlandspartei unter dem Vorsitz von Admiral Alfred von Tirpitz. Mit der Parteigründung verfügen die Alldeutschen erstmals über eine parteipolitische Organisation zur Verfolgung ihrer maximalen Kriegsziele zur Annexion großer Gebiete in West- und Osteuropa.
November 1917, Wilhelm II. ernennt den bayerischen Zentrumspolitiker Georg Graf von Hertling als Nachfolger von Georg Michaelis zum Reichskanzler. Oktober - Revolution in Russland, die Bolschewiki an der Macht.
Dezember 1917, Beginn von Friedensverhandlungen zwischen Russland, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn in Brest-Litowsk.
Denke ich an jene rasante Abfolge zukunftsträchtiger Entwicklungen aus dem Jahre 1917 zurück, so scheint eine gewisse Zwangsläufigkeit vorgeherrscht zu haben und alles auf den Zeitpunkt der großen Entscheidung über Krieg und Frieden, Sieg oder Niederlage im Folgejahr 1918 zugesteuert zu sein. Aber das stimmt so selbstverständlich nicht! Aus der Warte eines der Beteiligten fehlte dem Jahre 1917 über lange Zeit die klare Richtung, die Tendenz, wohin uns der Weg tragen werde. Umschwünge, Rückschläge, Ratlosigkeiten herrschten immer wieder vor. Genau so lösten Hochgefühle Tage oder Wochen von überwiegender Niedergeschlagenheit ab. An alles erinnere ich mich auch tatsächlich nicht mehr. Doch es bleiben mir Szenen von erheblicher Bedeutung als Schlüsselereignisse in meinem Leben und im Leben meiner Nation tief ins Gedächtnis eingebrannt. An sie werde ich immer aufs Neue denken, solange unser Herrgott mir vergönnt, jeden Morgen wieder die Sonne am Himmel über Berlin aufsteigen zu sehen.
18. März 1917. Vor zwei Tagen hatte Zar Nikolaus II. in Petrograd abgedankt. Als mich die Nachricht am frühen Abend erreichte, griff ich sofort zum Telefonhörer und rief meinen Freund Albert Ballin in Hamburg an. Albert wirkte auf mich verstört, sogar verwirrt. Dann gab er unumwunden zu, sich noch keinen rechten Reim auf die neue Lage machen zu können. Er würde dennoch oder gerade deshalb gerne mit mir sprechen. Ich lud ihn spontan nach Berlin ein, da ich hier derzeit nicht abreisen könne. Albert nahm sogleich an und wünschte unser Treffen um Walther Rathenau zu erweitern. Selbstverständlich war ich einverstanden. So kam es, dass wir drei am frühen Nachmittag des 18. März zusammenkamen.
Und plötzlich werden aus Gedanken Bilder. Jetzt habe ich die Erinnerung wie im Film vor mir: Als ich in Walthers Villa in der Koenigsallee 65 in Grunewald eintreffe, zündet sich Albert Ballin im Wintergarten erst einmal eine Zigarre an. Bei Kaffee und Kuchen sitzen wir etwas wortkarg beisammen - und benötigen erst einmal ein wenig Zeit, um ins Gespräch zu kommen. Nach ein paar belanglosen Sätzen über das Wetter, die Reichsbahn und den Sport kommt Albert dann zur Sache.
„Vielleicht hast du, lieber Gustav, es bemerkt, als wir miteinander telefonierten: Ich war vollkommen perplex. Die Nachricht von der Revolution in Petersburg nahm ich am 14. März recht euphorisch auf, weil ich mir davon zuallererst eine größere Aussicht auf Frieden versprach. Als dann aber der Zar abdankte und sein Bruder gleich mit auf den Thron verzichtete, da war ich erschüttert. Ich empfand das so, als bräche eine Welt, unsere moderne Welt, gepaart mit ihren zugleich alten, ehrwürdigen Dynastien plötzlich auseinander.”
„Was hast du denn geglaubt? Bist du so erschreckt, Albert, weil du dich fragen musstest, ob unser Kaiser denn überhaupt noch fest im Sattel sitze?”
Walther Rathenau trägt seine Bemerkung mit einem verschmitzten Lächeln und einem süffisant-oppositionellen Tonfall vor. Albert Ballin blickt ihn unvermittelt betroffen und niedergeschlagen an.
„Ja genau. Unter uns dreien darf ich das ja wohl sagen, was ich in Gesellschaft niemals so zugeben würde. Alles, woran ich glaube, die große preußische Monarchie, unser Staat, der getreu dem Geiste Hegels als fairer Sachwalter über den niederen Interessen gesellschaftlicher Gruppen steht, ja dieses Königtum und unser Reich spürte ich Wanken, und den Boden unter meinen Füßen gleich mit. Ich dachte mir, das überlebst du nicht, falls auch bei uns in Deutschland die Revolution und das Chaos ausbrechen sollten. Für solche Fälle hast du in deiner Schreibtischschublade zu Hause in Hamburg, im Arbeitszimmer im ersten Stock deines Hauses an der Elbe, deinen kleinen, handlichen Damenrevolver liegen. Ich meine, falls ich einmal nicht mehr ertragen möchte, was aus unserer Welt zu werden droht.”
„Na, na, lieber Albert. Werde doch nicht zum Defätisten! Das passt doch ganz und gar nicht zu dir. Ich bin ja nun auch zwanzig Jahre jünger als du. Aber bei aller vaterländischen Liebe zum Hause Hohenzollern denke ich immer nur an die Zukunft und wie ich zu ihr beitragen kann. Ich denke indes niemals an mein Ende.”
„Jawohl, mein lieber Gustav. Das macht nun einmal den guten Politiker aus, dass du immer nur an deine Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme denkst. Albert und ich sind da wohl doch noch etwas mehr Männer der Wirtschaft, um zuvörderst die Folgen für die Welt der Arbeit zu erblicken, falls es zur Revolution in Deutschland kommen sollte. Aber ich gebe euch unter den aktuellen Umständen unumwunden Recht: Die Verhältnisse sind ganz besondere. Und weil das so ist, erfordern sie ebenfalls sehr besondere Handlungen. Ich habe deshalb auch etwas unternommen, dass ich mir nur eine Woche zuvor wohl kaum zugetraut hätte.”
Walther Rathenau lehnt sich in dem bequemen, dick gepolsterten Strohsessel zurück und lächelt uns ein wenig herausfordernd an.
„Ihr kommt einfach nicht darauf, wen ich gestern Mittag angerufen habe.”
Walther lässt die Stille einige Sekunden im Raum stehen, und uns regelrecht vor Spannung schmoren. Doch ich bleibe ganz ruhig, und still. Auch Albert strahlt völlige Ruhe aus, obgleich das Leuchten in seinen Augen mir die Spannung verrät, unter der er steht.
„Na schön, meine Freunde. Ihr seid richtige Spielverderber, dass ich euch so wenig aus der Reserve zu locken vermag. Ich habe bei einem prominenten Mitglied der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion angerufen.”
„Nein! Das kann doch nicht wahr sein.” So entfährt es mir vor Überraschung.
„Wer war es denn und was wolltest du von ihm?”
„Na, jetzt habe ich euch aber doch neugierig gemacht, nicht wahr? Selbst der stets sehr beherrschte Albert kann seine Neugierde kaum verbergen. Tja, ich habe mit Scheidemann gesprochen.”
„Ausgerechnet der, der unseren Kaiser vor dem Krieg gleich mehrmals im Reichstag auf derart unverschämte Weise beleidigt hat!”
Albert Ballin vermag aus seiner Geringschätzung der Person Philipp Scheidemanns, des Vorsitzenden der SPD-Reichstagsfraktion, keinen Hehl zu machen. Doch das ruft nur erneut Walther auf den Plan.
„Das habe ich mir schon gedacht, lieber Albert, dass du von Scheidemann nichts wissen willst. Aber ich habe mal gedacht wie ein Politiker, und ich glaube, unser Freund Gustav wird mir gleich recht geben müssen:
Philipp Scheidemann ist neben dem Parteivorsitzenden Ebert allen verbalen Attaken der Vergangenheit zum Trotz der Mann der Zukunft innerhalb der deutschen Sozialdemokratie. Er kann nicht nur reden, er hat das nötige pragmatische Gespür für die Notwendigkeiten der Situation. Er hat ferner den nötigen Ernst, um die durchaus prekäre Lage zu erkennen, in welcher Reich und Monarchie sich befinden. - Und ich habe ihn angerufen, weil ich darauf vertraue, dass Scheidemann allen Vorwürfen vom vaterlandslosen Gesellen zum Trotz doch der Mann ist, der als deutscher Patriot in der Stunde der Not zum Reich steht und bereit ist, die von ihm geführte Arbeiterschaft in der nun beginnenden Entscheidungsphase des Krieges vollends in den Dienst der Nation zu stellen. - Aber das gilt sehr wohl nur dann, wenn hier ein Handel auf Gegenseitigkeit gelingt. Kannst du dir vorstellen, was Scheidemann verlangt, lieber Gustav?”
Ich bin tief in die Polster meines Sessels gesunken und starre Walther mit offenkundigem Erstaunen im Gesicht an. Das hindert mich allerdings nicht daran, den Ausführungen Rathenaus zu folgen und insgeheim blitzschnelle Auswertungen vorzunehmen.
„Scheidemann hat sich im Jahr 14 für die Bewilligung der Kriegskredite eingesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er seinen Beitrag dazu leisten würde, den Krieg von nun an für das Reich zu gewinnen. Ich habe auch eine persönliche Vermutung, dass es ihm neben der höchst bescheidenen Lebensmittelversorgung um etwas anderes, größeres für die Gestaltung der Nachkriegszeit geht. Machtvolle Entscheidungen, zum Beispiel über die öffentlichen Finanzen, fallen gar nicht im Reichstag, sondern im Preußischen Abgeordnetenhaus. Ein Staat, der zwei Drittel aller Bürger, der Wirtschaftskraft und aller Steuern des Reiches stellt, wird auch in Zukunft so mächtig sein, dass die Sozialdemokratie auf respektablen Einfluss dort drängen muss. Und was finden wir dann vor? Das preußische Dreiklassenwahlrecht. Selbst wenn alle Arbeiter die SPD wählten, käme die Partei realistisch betrachtet auf weniger als 30 Prozent der Mandate im Abgeordnetenhaus. Denn ein Arbeiterlohn reicht einfach nicht aus, um in der zweiten Steuerklasse wählen zu dürfen. Das ist für Ebert und Scheidemann unter keinen Umständen akzeptabel.”
„So ist es, Gustav. Ich habe Scheidemann gerade heraus gefragt: Was verlangen sie von Adel und Bürgertum, von den herrschenden Eliten in Deutschland, damit der deutsche Arbeiter weiter kämpft und arbeitet, damit unser Reich den Krieg zumindest im Osten gewinnt und einen ehrenvollen Frieden erlangt? Seine Antwort folgte wie aus der Pistole geschossen: Das allgemeine und gleiche Wahlrecht in Preußen natürlich.”
Nachdenklich sitzt Albert Ballin in seinem Sessel.
„Wäre das wohl das Ende der Hohenzollern-Monarchie? Oder aber wäre es ganz im Gegenteil die Grundlage dafür, die Russen zum Frieden zu zwingen und die Westmächte daraufhin zu überzeugen, dass sie gegen uns nicht mehr zu gewinnen vermögen? Ich weiß es nicht! Aber ich gebe euch natürlich recht, dass wir uns diese Frage schonungslos stellen müssen. Und Walther hat deshalb sicher auch recht, wenn er auf die Sozialdemokraten zugeht und sie einfach mal fragt: Wie geht es denn jetzt weiter?”
„Da sind wir am springenden Punkt angelangt, lieber Albert. Dürfte ich darauf vertrauen, dass Gustav oder sein Parteifreund Bassermann für die Nationalliberalen und dann am besten auch ebenso das Zentrum auf die SPD zugingen und dort meine Frage anbrächten, ja dann hätte ich nicht gefragt. Dass der Reichskanzler selbstverständlich eine solche Sondierung nicht durchführen darf, ohne sein Amt zu verspielen, versteht sich von selbst. Habe ich nicht recht, Gustav?”
Ich fühle mich von Walther Rathenaus Erwartung, dass auch ich auf die SPD zugehen müsse, einigermaßen überrollt. Ich brauche einige Sekunden, um mich zu fassen. Das gelingt am besten mit einem genüsslichen Schluck Bohnenkaffee, der mir eine kleine Verschnaufpause verschafft.
„Die Ereignisse in Petersburg sind auch für mich noch all zu frisch, um schon heute mittels spontaner, vielleicht nicht ganz zu Ende gedachter politischer Aktionen tätig zu werden. Ich bin sicher, dass unser Freund Walther zunächst einmal der Schnellste war, im Denken wie im Entschluss zum Handeln. Halt ein wahrer Mensch der Tat! Es könnte sich tatsächlich als richtig erweisen, dass wir neue Wege beschreiten müssen, um die Stabilität des Reiches im Inneren durch ganz neuartige Maßnahmen zu bewahren. Wenn die russischen Arbeiter den Zaren davonjagen und nach Frieden verlangen, dann dürften nicht wenige deutsche Arbeiter rufen: Tun wir es ihnen gleich! Das ist internationale Solidarität der Arbeiterklasse und zugleich wird dann an einer unserer Fronten schon nicht mehr gekämpft und gestorben. Das müssen wir natürlich verhindern! In einem solchen Fall wären nicht allein all unsere großen Kriegsziele im Osten verloren. Ebenfalls stünden wir dem Westen gegenüber einigermaßen hilf- und machtlos dar, sobald auch nur die Möglichkeit bestünde, dass die ruhmreiche preußische Armee nicht mehr ohne Zweifel hinter Seiner Majestät, dem Kaiser, stehe.”
„Wenn die von Walther soeben herauf beschworene Gefahr jedoch einen wahren Gehalt hat, lieber junger Freund Gustav, dann hätte Walther selbstverständlich auch mit seiner Schlussfolgerung vollständig Recht: Dann müssten wir Arbeitgeber und mit uns die Regierung den Sozialdemokraten und ihren Gewerkschaften erklären: Wir stellen die deutsche Gesellschaft zukünftig auf eine neue Grundlage. Adel, Bürger und Arbeiter sind gleicher maßen die Stützen. Adel, Bürger und Arbeiter dürfen daher in Zukunft auch als gleichberechtigte Staatsbürger wählen und Gerechtigkeit erwarten.” Trotz aller messerscharfen Nüchternheit und Konsequenz seiner Worte blickt Albert Ballin dabei ungläubig drein. Zu unfassbar erscheint ihm wohl weiterhin die Vorstellung, aus den „Staatsfeinden” der Sozialdemokratie zukünftig ehrbare Partner und Verbündete der etablierten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Eliten des Deutschen Reiches zu machen. Ich spüre die Spannung, die im Raum liegt, eine Spannung, die aus der ungeheuerlichen Tragweite der eben gesprochenen Worte entspringt. Ich möchte diese Betroffenheit bei Albert überwinden und weiß, dass dies nur gelingen kann mit Walthers Hilfe, der die Lage weniger emotional betrachtet. An Nüchternheit indes scheint es meinen beiden Gesprächspartnern und Freunden nicht zu mangeln.
„Na, was hat der tolle Reichstagsabgeordneter Philipp Scheidemann denn nun genau gesagt, als du mit ihm gestern telefoniert hast, Walther?”
Meine Frage reißt Albert aus der Melancholie und Walther aus einem kurzen Tagtraum, denn er schüttelt leicht sein Haupt und entgegnet:
„Entschuldige Gustav. Ich war mit meinen Gedanken gerade ganz woanders. Natürlich, ihr wollt erst einmal wissen, wie die sozialdemokratische Reichstagsfraktion denn nun Position einnimmt. Scheidemann hat eigentlich gar nicht viel gesagt: Der deutsche Arbeiter, der preußische Arbeiter dürfe nicht mehr länger abgespeist werden. Er dürfe nicht mehr länger in dem Bewusstsein kämpfen, dass der Wert seines Lebens für den Staat abhängig sei von seiner Lohntüte, statt von seinem Mut und seiner Pflichterfüllung im Felde. Und dann sagte er etwas höchst bemerkenswertes:
ˏSehr geehrter Herr Doktor Rathenau, es ist ja sehr schön, dass sie sich bei mir erkundigen, welche Auswirkungen die Ereignisse im jüngst umbenannten Petrograd auf das Leben in Deutschland wohl haben mögen. Und immerhin ist ihr Unternehmen ein wahrlich wichtiger Arbeitgeber. Doch sie sind seit bald zwei Jahren nicht mehr Inhaber eines öffentlichen Regierungsamtes. Für meine Partei wird alles darauf ankommen, ob die Herren der Regierung das Gespräch mit mir suchen werden. Und falls die Reichsleitung selbst über diesen Schatten nicht zu springen vermag, so bin ich doch sehr gespannt, wie sich die bürgerlichen Parteien vom Zentrum über die Fortschrittlichen bis zu den Säbel rasselnden Nationalliberalen des feinen Herrn Stresemann zu verhalten gedenken. Sie dürfen ihren Freunden auf der Wilhelmstraße oder im Reichstag getrost einen herzlichen Gruß von mir bestellen. Die deutsche Sozialdemokratie ist zu Gesprächen über die Zukunft des Reiches bereit, wenn es dabei auch und gerade um die Zukunft Preußens gehen darf.ˋ
So war das. Dann war unser Telefonat auch bereits beendet. Ich blieb wie benommen zurück, beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, von der Geradlinigkeit, die aus Scheidemanns Worten sprach. Und ich war beim zweiten Gedanken natürlich froh und glücklich darüber, dass wir drei unsere heutige Verabredung bereits unter Dach und Fach hatten. Denn mit wem auf der ganzen Welt könnte ich besser, vorausschauender und unabhängiger über Scheidemanns Offerte reden als mit euch, meine lieben Freunde?” Walther Rathenau lächelt Albert und mich dann so herzlich an, dass wir von seiner Zuversicht über die neuen Möglichkeiten einer Kooperation mit den „Vaterlandslosen Gesellen” inspiriert bis tief in den Abend Plan- und Gedankenspiele anstellen. Als Ergebnis halten wir schließlich fest: Bethmann-Hollweg dürfe es sich niemals erlauben, einen Emissär zu Scheidemann zu schicken, um über das preußische Wahlrecht zu verhandeln. Aber die staatstragenden Parteien der politischen Mitte in Deutschland könnten es wohl riskieren, zu einem informellen Austausch einzuladen. Ich selbst bleibe indes gespalten in meiner Abwägung der Vorzüge und Nachteile eines solchen Vorgehens. Würde uns die nationale Presse nicht zerfleischen, falls sie von einem solchen Austausch Wind bekäme?
„Du hast völlig recht, lieber Gustav. Deine Nationalliberalen mit den Hugenbergs und Thyssens dieser Welt würden es dir nie verzeihen, der Initiator einer solchen Gesprächsrunde zu sein. Ich könnte Erzberger von den Ultramontanen bitten, aktiv zu werden. Er sollte sich im ersten Schritt vielleicht auf ein Treffen mit Scheidemann und einem ihm geeigneten, vertrauten Vertreter der Fortschrittlichen verständigen. Falls das gut liefe, kämst du, lieber Gustav dazu. Dann käme keiner mehr auf den Gedanken, dass wir hier die ganze Geschichte ausgeheckt und eingefädelt hätten. Dann könnte dich auch kein Stahlbaron von der Ruhr mehr zu Fall bringen wegen so einiger weniger, gänzlich zu nichts verpflichtender Gespräche unter Reichstagskollegen.”
Und so machten wir es tatsächlich. Eine wichtige Weichenstellung der deutschen Innenpolitik war an jenem Nachmittag des 18. März 1918 bei Walther Rathenau im Wintergarten seiner Grunewalder Villa bei Kaffee und Kuchen, später am Abend dann bei einer hervorragenden Zigarre und einem milden Portwein auf die Reise gebracht worden.
Ich schrecke auf. Was für ein Geräusch hat mich da aus meiner Erinnerung gerissen? Die schwere Türe meines Krankenhauszimmers fällt mit einem satten Klicken ins Schloss. Jemand von der Ärzteschaft oder vom Pflegepersonal muss eben im Zimmer gewesen sein. Ja tatsächlich. Ich bemerke, neu gebettet zu sein. Das Bettzeug duftet noch eine Spur frischer als bei meinem letzten Wachen. Ich fühle mich beinahe wohl, wäre da nicht jene vollständige Mattigkeit, die mir jede Kraft raubt. Mit Mühe gelingt es mir, meinen linken Arm über den Oberkörper zu beugen und ein Wasserglas auf meinem Nachtschrank zu erreichen. Der Durst lässt mich die Distanz überwinden und ich trinke mit Genuss und zittriger Hand. Ich bin froh, als ich das geleerte Glas ohne Schaden erneut auf dem Nachtschrank abstelle. Mein Oberkörper sinkt erschlafft noch tiefer in das frisch aufgeschlagene Kopfkissen. Ich schließe wieder meine Augen und es dauert nicht lange, bis der Schlaf mich erneut übermannt.
Ich erinnere mich genau: Am 2. April muss es gewesen sein, dass die Herren Reistagsabgeordneten Scheidemann von der SPD, Erzberger vom Zentrum und Haußmann von der Fortschrittlichen Volkspartei zu einem vertraulichen Gespräch zusammenkamen. Inzwischen hatte meine Initiative im Reichstag zur Gründung des Verfassungsausschusses einiges Aufsehen erregt. Vor allem aber sicherte mir der Vorstoß einen kräftigen Vertrauensvorschuss bei all jenen Vertretern der drei demokratischen Parteien, die in mir bislang einen glasklaren Verfechter imperialer, ausgreifender Kriegsziele erblickt hatten. Erst meine jüngste Initiative ebnete den Weg zu jenen vertrauensvollen Gesprächen, die fortan jenseits offizieller Parlamentsgremien folgen sollten.
Walther Rathenau hatte Matthias Erzberger gegenüber unter vier Augen von der Möglichkeit eines Austausches zwischen den bürgerlichen Parteien und der Sozialdemokratie zur Sicherung der Zukunft unseres Reiches gesprochen. Ungläubig verlangte Erzberger nach Belegen für die Bereitschaft der SPD, gerade jetzt, nach den „revolutionären Ereignissen“ im ehemaligen Zarenreich. Walther führte mich daraufhin als Zeugen für die ehrlichen Absichten Scheidemanns an. Also traf ich Erzberger zwei Tage später im Reichstag. Mir gelang es, seine Neugierde zu wecken. Schwerer fiel es mir allerdings, ihn davon zu überzeugen, dass ein erstes Treffen ohne mich, nur mit Conrad Haußmann von den Fortschrittlichen stattfinden müsse. „Warum?”, hatte Erzberger wissen wollen.
„Weil Scheidemann Rücksicht nehmen muss auf diejenigen in seiner Fraktion, die mich als Ausgeburt der Expansionisten verachten. Aber ebenso, weil ich auf jene in meiner Partei Rücksicht nehmen muss, die ein Gespräch mit der SPD per se als Hochverrat bezeichnen würden.”
Da hatte Erzberger gelacht. Er stimmte dem Treffen mit Scheidemann und Haußmann unter zwei Bedingungen zu:
„Sie müssen an einem Folgetermin, sagen wir noch im April, unbedingt teilnehmen. Und zweitens müssen Sie Herrn Hugenberg und Herrn Stinnes bei Ihrem nächsten Parteitreffen mit der Schwerindustrie so ganz beiläufig einen schönen Gruß von mir ausrichten. Nichts weiter. Sollen Sie doch rätseln, weshalb ich so etwas mache.”
Und wieder hatte Erzberger gelacht.
Meine Abstimmung mit Conrad Haußmann dagegen war ein Kinderspiel. Wir trafen uns zum Mittagessen im Adlon. Ich hatte eingeladen. Dann bat ich ihn um das besagte Treffen zu dritt und sagte gleich zu, am Folgetermin teilzunehmen.
„Und Sie sind sich dessen absolut gewiss, lieber Doktor Stresemann, dass Scheidemann unser Treffen nicht propagandistisch ausnutzen wird?”
„Auf keinen Fall, Herr Scheidemann wird die Ziele des inneren und äußeren Friedens über sämtliche parteilichen Erwägungen stellen, dessen bin ich mir sicher.” So antwortete ich aus dem Brustton tiefster Überzeugung. Und schon war es abgemacht.
So wunderte es mich nicht, dass es Haußmann war, der mich noch am Abend des 2. April zu Hause per Fernsprecher davon unterrichtete, wie das Gespräch zu dritt verlaufen war. Das Ergebnis ist kurz erzählt: Scheidemann verlangte nach der Unterstützung des Bürgertums für die Wahlrechtsreform in Preußen, anderen Falls werde die Sozialdemokratie die Arbeiterschaft nicht mehr daran hindern können, vom um sich greifenden Schlendrian allmählich zu spontanen Arbeitsniederlegungen überzugehen. Conrad Haußmann entgegnete darauf scharf und emotional, das sei Erpressung, und dieser werde sich die Fortschrittliche Volkspartei niemals beugen. Erzberger dagegen bat die Herren um Mäßigung und sinnierte nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner der Dreierrunde. Er vermutete diesen in einer möglichst zeitnahen Beendigung des Krieges. Dies sei nur zu erreichen, indem die Summe der politischen Kräfte auf Junker und Stahlbarone, auf OHL und Reichsregierung einwirkten. Man müsse den alten Eliten endlich klar machen, dass wir mit unseren deutschen Maximalforderungen niemals einen Frieden erreichten, es sei denn es gelänge uns, die Engländer und Franzosen bei Calais ins Meer und über die Pyrenäen nach Spanien zu treiben.
Plötzlich musste auch der bis dahin recht ernsthafte Scheidemann lachen. Er stimmte zu, dass die Fraktionen der Gesprächsteilnehmer bitte sehr beide Zielsetzungen zu verfolgen hätten: über den Reichstag auf die Wahlrechtsreform wie auf einen Verhandlungsfrieden zu drängen. Erzberger brachte das Ergebnis dann gleich unter Dach und Fach, indem er erklärte, das wolle er umgehend dem Herrn Stresemann mitteilen. Die drei waren sich nämlich nun auch noch darin einig, dass ihre Initiative nur dann Aussicht auf Erfolg haben werde, falls es ihnen gelänge, die Nationalliberale Partei auch noch für eine Kooperation zu gewinnen. Als Haußmann mir das berichtete, sprudelte es gleich aus mir heraus:
„Recht haben Sie da! Nur wenn Konservative und Bayernpartei an dem einen Rand des politischen Spektrums, die Unabhängigen Sozialdemokraten an dem gegenüberliegenden Rande erkennen, dass sie als die einzigen Gegner einer neuen Reformpolitik verbleiben, können Ludendorff und Bethmann begreifen, gar nicht mehr an der Einsicht vorbei sehen, dass sie sich bewegen müssen!”
„Das sind ja ganz ungewohnte Töne aus Ihrem Munde, lieber Doktor Stresemann. Ich war bislang immer davon überzeugt, die Nationalliberalen seien in solchem Maße eine staats- und regierungstragende Partei, dass sie niemals ein politisches Bündnis zur Beeinflussung der Reichsleitung eingehen würden. Das gibt mir die Hoffnung, dass dieses maßlose Schlachten im Westen ein Ende finden möge, bevor im Felde Millionen gefallen und zu Hause Millionen verhungert oder erfroren sein werden.”
So kam es, dass wir vier uns fast vier Wochen später, am 29. April, in meinem Privathaus trafen. Denn wir waren zuvor übereingekommen, ein Gespräch in der Öffentlichkeit einer gastronomischen Restauration käme ebenso wenig in Frage wie in den manchmal papierdünn anmutenden Wänden des so wuchtigen Reichstagsgebäudes.
„Die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts im Königreich Preußen ist die Basis für alles, vor allem dafür, dass Preußen auch noch länger ein Königreich bleibt. Vor unserem heutigen Treffen hat mir mein Parteivorsitzender Friedrich Ebert mit auf den Weg gegeben, dass er gerade angesichts der Agitation von Lenin in Petersburg mittlerweile von einem überzeugt sei: Besser eine Monarchie bleiben und die Anarchie auf der Straße damit vermeiden, als sich die volle politische Freiheit mit Elend und Chaos zu erkaufen.”
„Lieber Herr Scheidemann, falls es mir jemals gelingen sollte, meine Fraktion und meinen Vorsitzenden Ernst Bassermann von der Unvermeidbarkeit der Kooperation mit Ihren Sozialdemokraten zu überzeugen, dann wird es mittels dieser Überzeugung von Herrn Ebert sein.”
Ich war durchaus euphorisch in Anbetracht der Scheidemannschen Wortwahl. Und so wurde ich vom nüchternen Erzberger gleich wieder auf den harten Boden der tristen Tatsachen zurückgeworfen.
„Ob Sie da nicht übertreiben, lieber Stresemann? Ich habe Ihre nationalen Blätter stets so gelesen, dass die großen Fabrikherren aus dem Westen zwar die Erzgruben von Longwy und Briey von Frankreich verlangen, aber dafür noch lange nicht bereit sein werden, mit der Arbeiterschaft einen Frieden zu schließen für mehr Mitwirkung im Betrieb. Das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst haben die Hugenbergs dieser Welt doch nicht wirklich aus innerer Überzeugung akzeptiert. Sie versuchen doch weiter die Bildung von Arbeiterausschüssen zu verhindern oder diese, sobald vorhanden, zu schikanieren, wo es nur geht.”
Natürlich hatte Erzberger Recht. Aber das wollte und konnte ich doch hier gegenüber der Sozialdemokratie nicht so unumwunden zugeben. Scheidemann hätte mich sogleich für einen Hanswurst gehalten, mit dem keine weiteren Konsultationen zu halten sein würden, und vor allem hätte er seiner Fraktion genau so berichtet. Also musste ich mir etwas Überzeugendes einfallen lassen.
„Meine Herren, denken Sie denn tatsächlich, Herr Bassermann und ich hätten daran nicht zuvor gedacht, bevor wir uns zu meiner Teilnahme an diesem Gespräch entschlossen? Wir wissen um die stark divergierenden Flügel und Interessen gerade unter den Wirtschaftsvertretern meiner Partei. Die Vertreter der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie und der Steinkohle sind noch weit davon entfernt, die Sozialdemokratie als Verhandlungs-, geschweige denn als Kooperationspartner anzuerkennen. Doch wenn es einer gesellschaftlich-politischen Kraft in Deutschland gelingt, die Stahlbarone aus dem Bündnis mit den konservativen Junkern zu locken, dann wird dies einzig und allein die nationalliberale Heimat jener Industriellen sein. Ich habe die Chance, Hugenberg und Stinnes das hier zu vermitteln: Sobald ihr nur noch die Konservativen als Bündnispartner habt, aber SPD, Zentrum, Fortschrittler, und die Mehrheit der Nationalliberalen gemeinsam für Reformen streiten, um das Reich zu erhalten, werdet ihr unwiederbringlich an Macht verlieren! Sie aber, Herr Scheidemann, werden politisch auf sich allein gestellt diese Chance auf die Einleitung eines Gesinnungswandels bei jenen Herren von der Ruhr niemals erhalten! Deshalb würden sie mir und Deutschland einen großen Gefallen tun, falls Sie bereit wären zu akzeptieren, dass wir vier hier ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und voraussichtlich wird es uns auch lediglich gemeinsam mit vereinten Kräften glücken, unsere übereinstimmenden Vorstellungen zu verwirklichen. Sollten Sie versuchen, mich in meiner eigenen Partei zu schwächen, dann können Sie vielleicht meinen Abstieg besiegeln. Das gleiche Wahlrecht in Preußen aber oder gar einen Verständigungsfrieden, die bekommen Sie dafür aber nicht!”
Stille herrschte in der Runde. Conrad Haußmann atmete tief ein und aus, blickte mich an und lächelte fast unmerklich, dennoch ein wenig verschmitzt. Matthias Erzberger dagegen starrte gerade aus in die Leere. Er traute sich wohl nicht, einem von uns beiden vermeintlichen Kontrahenten, Scheidemann oder mir, sofort ins Gesicht zu blicken, und damit dem anderen zu signalisieren, wem er gerade eben die größeren Sympathien entgegen bringe. Weil er wohl die Befürchtung hegte, der jeweils andere könnte das zum Anlass nehmen, sich als isoliert zu betrachten und die Runde womöglich für immer als gefühlter Verlierer zu verlassen. Da stand etwas auf Messers Schneide, das spürte ich wohl. War ich vielleicht zu weit gegangen, mit meiner forschen Sprache, die Scheidemann als ein wenig arrogante Zurechtweisung würde begreifen können? Ich wartete einfach ab und konzentrierte mich scheinbar darauf, meinen Kaffee genussvoll zu trinken.
„Ja, ja, so ist das mit den großbürgerlichen Nationalliberalen. Da glauben sie, uns kleinen Sozialdemokraten Vorhaltungen machen zu dürfen, weil wir vielleicht nicht das große Ganze der deutschen Politik im Auge hätten. Lieber Stresemann, wäre das hier gerade in einer Debatte des Reichstags geschehen, so erlebten wir jetzt sogleich einen heftigen Schlagabtausch, der das Klima zwischen unseren Parteien kaum würde zum Besseren wenden helfen.”
Scheidemann machte eine Pause und wartete ein wenig ab. Er genoss die Spannung in Erzbergers Gesichtszügen. Ich war indes um ein Pokerface bemüht. Ob es mir restlos gelang, mag ich im Nachhinein bezweifeln, so wie es in jenem Moment damals in meinem Innersten aussah.
„Doch meine Herren, wir sind ja hier nicht im Deutschen Reichstag, glücklicherweise. Denn weil dies anders ist, ist es uns gestattet, einfach als ehrliche deutsche Männer weiter miteinander um den Austausch der besten Argumente zu ringen. Weil das so ist, verspüre ich keineswegs eine Neigung, polemisch oder auch nur heftig zu reagieren. Mein Wunsch ist statt dessen, das Gespräch mit Ihnen, Herr Doktor Stresemann, einfach und ernsthaft fortzusetzen. Weil wir hier hinter verschlossenen Türen sprechen, weil wir uns versichert, ja sogar geschworen haben, dass kein Wort aus diesem Raume draußen über unsere Lippen kommt, es sei denn, es ist einvernehmlich so vereinbart, ja deshalb hat unserer Runde zu viert eine echte Aussicht auf Fortschritte. Meine Herren, möge es uns gelingen, einen Beitrag zur Gerechtigkeit in Preußen und Deutschland, einen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten!”
Mit diesen durchaus theatralisch über Scheidemanns Lippen kommenden Worten endete unser erstes Treffen. Viele weitere sollten bis Ende Juni folgen, das Vertrauen zwischen uns stärken, das Verständnis füreinander schaffen, welche ernst zu nehmenden Motive jeder einzelne für seine Haltung hatte. Am Ende musste ich lernen, dass meine eigene Partei noch nicht bereit war, die Macht in Preußen zu teilen. Somit behielt Erzberger Recht mit seiner nüchternen Kritik vom ersten Tage. Und auch Matthias Erzberger war es, der den Schlüssel zum Erfolg unserer Gesprächsrunde schmiedete, indem er immer aufs Neue Vorschläge für einen Frieden ohne großes deutsches Kriegszielprogramm formulierte. Wir rieben uns daran, arbeiteten uns daran ab. Ab Pfingsten 1917 schließlich zeichnete sich ab: Wir würden für unsere vier Parteien die Chance sehen, eine Resolution des Abgeordneten Erzberger mit der Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen mit der Entente zur Erzielung eines Verständigungsfriedens zu unterstützen. Ein herrliches Gefühl! Ich empfand es als einen wichtigen Anfang, auf den hoffentlich weitere handfeste Ergebnisse aus der Zusammenarbeit von Fortschrittlern, Nationalliberalen und Zentrum mit der Sozialdemokratie folgen würden. Ich wusste indes Ende Juni genau: Vor einer tatsächlichen Friedensinitiative, oder gar vor einer echten Wahlrechtsreform in Preußen, standen nicht allein Reichskanzler Bethmann-Hollweg, Generalleutnant Ludendorff, sondern ebenfalls der Kaiser und sein leider all zu oft Säbel rasselnder Sohn. So sehr ich Kronprinz Wilhelm persönlich mochte und in zahlreichen persönlichen Begegnungen zu schätzen gelernt hatte, so tief beunruhigte mich, wie inbrünstig es Wilhelm danach verlangte, seinen vermeintlich so zahmen und überlegten Vater an vaterländischer Gesinnung und vor allem an nationalen Taten zu übertrumpfen.