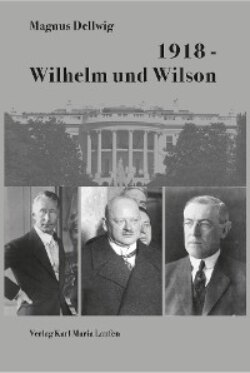Читать книгу 1918 - Wilhelm und Wilson - Magnus Dellwig - Страница 9
3 Seine Majestät
ОглавлениеIch wache auf und zucke zusammen. Eine schallende Geräuschkulisse verheißt eintretende Stiefelschritte. Schwach fühle ich mich und sehe zuerst nur wie durch einen feinen grauen Schleier aus Gaze: Weiße Ärztekittel halten sich zu meiner Überraschung im Hintergrund. Vorn und in der Mitte ein Mann im dunklen Anzug mit Weste, daneben ein größerer Mann in feldgrau, ja genau, in Uniform: Spiegelkragen der Generalität in rot und gold, etliche Orden auf der linken Brust, goldene Knöpfe auf dem Rock. Mein Blick ist immer noch getrübt, so dass es mir schwer fällt, Gesichtszüge zu erkennen. Doch indem ich wieder einen klaren Gedanken fassen kann, kommt mir gleich eine Ahnung.
„Lieber Freund Gustav, was machst du denn nur für Sachen!
Professor Kraus hat mir Rapport erstattet: Es sei nicht nur dein Herz. Es komme auch noch deine Niere dazu. Dabei will ich doch gar keine Hiobsbotschaften hören! Ich will doch nur, dass du wieder hier heraus kommst, aus unserer so anerkannten Charité. Deutschland braucht dich im Auswärtigen Amt. Und ich ganz besonders brauche dich als Freund, als Berater, als Begleiter auf meinen Auslandsreisen. Nun sag mir schon, dass es dir schon viel besser geht.”
Danach fühle ich mich nun mal gar nicht. Wenn aber der Kaiser einen Krankenbesuch im Klinikum abstattet, ist es natürlich meine Pflicht, Zuversicht zu verbreiten und vor allem gute Laune.
„Euer Majestät, lieber Wilhelm, wie schön, dass du zu mir kommst.”
Mein Lächeln erscheint mir tadellos, doch die Stimme ist derart schwach und brüchig, dass sie meine Worte Lügen straft. Das ist mir indes gleich. Bei diesem Besuch sollen alle wenigstens für einige Minuten so tun, als hätte der Patient hier nicht mehr als eine erfolgreich operierte Blinddarmentzündung hinter sich.
„Meine liebe Käte wusste heute morgen schon zu berichten, dass du dich höchst persönlich nach meiner Gesundheit erkundigt habest. Nicht so viel der Ehre, Wilhelm! Gib mir bitte einfach die Zeit und die Muße, wieder auf die Beine zu kommen.”
„So gefällst du mir, Gustav. Immer voller Tatendrang, immer optimistisch, immer tief stapeln, was seine eigenen Verdienste anbelangt.”
Jetzt lacht Seine Majestät, Kaiser Wilhelm III. laut und schneidig auf. Sein Blick zum Internisten Professor Kraus bringt unverhohlen die Erwartung zum Ausdruck, es ihm an Freundlichkeit und Wohlgemut gleich zu tun. Allein dafür, für seine gute Laune, mag ich Wilhelm von Preußen so sehr. Auch wenn die Zeichen für eine echte Freundschaft zu Beginn unserer Bekanntschaft und dann auch manches weitere Mal in den schicksalsschweren Monaten gegen Kriegsende 1918 nicht zum Besten standen. Heute indes bin ich so schwach, kaum die Kraft für weitere Worte bündeln zu können. Deshalb hoffe ich inständig, dass der Kaiser die kurze Stille durchbrechen möge.
„Heute Morgen, das ist wahrlich gut, lieber Gustav. Gestern war deine verehrte Gattin hier zu Besuch und du wachtest. Seitdem aber hast du dir einen wahrlich langen und tiefen Genesungsschlaf genehmigt. Ich hoffe, du hast gut geträumt.”
Ja, wenn du nur wüsstest, lieber Wilhelm! So geht es mir durch den Kopf und ein zufriedenes Schmunzeln legt sich um meine Mundwinkel.
„Ich bin jetzt jedenfalls überhaupt nicht hier, um dich mit deiner Arbeit zu behelligen oder dich regelrecht auszufragen. Falls du dich etwas unpässlich fühlen solltest, um mir viel zu erzählen, so will ich gerne einspringen und dir ein wenig berichten von meiner letzten großen Jagd in der Johannisberger Heide. Das war ein Vergnügen!”
Ich bin dankbar und erleichtert. Daher nicke ich Wilhelm freundlich zu und entspanne mich in dem sogleich von einer kräftigen Schwester aufgestellten Kopfelement meines Bettes. Zwei Pfleger tragen soeben einen bequemen Sessel herein und stellen diesen nur etwa einen Meter und fünfzig Zentimeter von meinem Bett für den Kaiser auf. Wilhelm III. nimmt in aller Seelenruhe Platz, streckt die Beine weit aus und beginnt.
Und Seine Majestät sind in Erzähllaune! Er berichtet von der Treibjagd auf Füchse. Gibt mir an, in der Welt sei ja ohne mich wenig los, so dass er auch gar keinen Bericht zu den aktuellen Taten der Briten oder Amerikaner abzugeben habe. Aber das seien ja noch Zeiten gewesen, als wir beide - und ganz wenige andere natürlich auch - 1918 all unsere Intelligenz, all unsere Scharfsinnigkeit in der Analyse der weltpolitischen Möglichkeiten und vor allem all unseren Tatendrang zusammen genommen hätten und schließlich einen hervorragenden Friedensschluss für das Reich erzielt hätten. Die anwesenden Mediziner in der zweiten Reihe kommen nicht umhin, die Worte des Kaisers durch unmissverständliche Gesten und Minen zu bestätigen.
Mir dagegen fällt nach anfänglich großem Vergnügen das Zuhören immer schwerer. Der Kopfschmerz legt wieder zu, mir schwindelt, ich kann die Augen kaum noch offen halten. Dann muss ich tatsächlich für einen Sekundenschlaf eingenickt gewesen sein, denn ich schrecke durch ein lautes Wort auf, zucke zusammen und sehe Wilhelm mit großen Augen an.
“Das ist ausgesprochen nett und höflich, lieber Gustav, dass du mir so aufmerksam zugehört hast. Da ich aber gekommen bin, um dich zu unterhalten, und nicht, um dich anzustrengen, möchte ich dich wieder der Ruhe deines Zimmers und nicht weniger der Obhut deiner Ärzte überlassen. Wir sehen uns schon sehr bald wieder!“
Wilhelm lächelt, steht auf, beugt sich zu mir hinunter und drückt mir die Schulter. Das tut gut. Auch wenn das für andere schwer vorstellbar zu sein scheint, aber Seine Majestät der Kaiser ist mein wahrer Freund und ich damit natürlich auch seiner. Nachdem mit Wilhelm die gesamte Schar der weiß bekittelten Begleitung mein Zimmer verlassen hat, bin ich froh und dankbar für seinen Besuch, und in diesem Moment noch mehr dafür, jetzt erneut meine Ruhe zu finden. Ich bin müde und ich möchte schlafen. In meinem Zustand ist es auch tatsächlich kein Problem, diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Es dürften nur einige Sekunden sein, bis ich dem wach Sein entschwunden bin. An die Stelle des geräumigen Krankenhauszimmers tritt vor mein inneres Auge die herrliche Blüte der Büsche und Bäume im Tiergarten. Es ist Frühling, der Frühling 1917. …
Der Mai 1917 geht zu Ende, meine Gespräche mit den Kollegen Haußmann, Erzberger und Scheidemann konzentrieren sich nach anfänglich hitziger Debatte über das preußische Wahlrecht inzwischen eindeutig auf die Frage nach der Möglichkeit eines Verständigungsfriedens. Es liegt in der Natur der Sache, nämlich in der Natur unserer unterschiedlichen inhaltlichen Positionen zu Fragen des Kriegszielprogramms, dass bei meinen drei Gesprächspartnern ein Rest Zweifel, vielleicht sogar auch Misstrauen mir gegenüber bleibt. Das ist wohl kaum verwunderlich, wenn ich mir selbst meine Haltung zu den Kriegszielen des Reiches seit dem Septemberprogramm Bethmann-Hollwegs in Erinnerung rufe. Der Reichskanzler war damals vorgeprescht, doch zugleich musste er wohl zu dieser alles entscheidenden Frage der deutschen Politik im Herbst 1914 selber Stellung beziehen. Seine Stellungnahme war de facto das Angebot zum Kompromiss in viele Richtungen, was die maßgebenden Kräfte der inneren Politik anbelangte. Unter Druck geriet Bethmann-Hollweg allerdings gerade 1916 mehr von rechts denn von links; vielen Vertretern der Schwerindustrie gingen seine Forderungen nicht weit genug. Woran lag es eigentlich, dass Bethmanns Kriegszielprogramm kaum Anhänger fand? Junkern und Stahlbaronen gingen seine Ziele nicht weit genug. Der Sozialdemokratie dagegen war jeder Friede suspekt, der eindeutig einen Sieger und einen Besiegten kannte. Was wollte der Reichskanzler im September 1914 also wirklich und was hatte er damals wirklich geregelt? Neben zahlreichen schwammigen Aussagen zu so interessanten Fragen wie Kolonien, Flotte und Welthandel beschränkten sich die einigermaßen fassbaren Inhalte auf vier Positionen, die sich für die Verhandelbarkeit des Programms mit dem Feind als entscheidend erweisen mussten:
Im Westen sollte erstens eine irgend geartete Oberhoheit des Reiches über Belgien stehen. Was das genau bedeuten sollte, blieb ungewiss. Folglich reichten die Spekulationen in Berlin, Brüssel, Paris und London von der Kontrolle über die Außen- wie Wirtschaftspolitik unseres Nachbarn bis zu seiner Eingliederung in das Reich selbst. Zweitens wurden von Frankreich territoriale Zugeständnisse in Lothringen verlangt. Vielleicht kam gar französisch Flandern mit Dünkirchen hinzu. Dies rief selbstverständlich Britannien ganz besonders auf den Plan, strebte der Gegner doch offenkundig nach der Beherrschung der kontinentaleuropäischen Kanalküste. Drittens sollte eine mitteleuropäische Zollunion unter deutscher Leitung geschaffen werden. Unter Mitteleuropa verstand die Reichsregierung nicht nur die Mittelmächte, sondern zudem die Beneluxstaaten, nach Möglichkeit Polen und Teile Skandinaviens. Damit sind wir bei Bethmann-Hollwegs viertem zentralen Kriegsziel, der Herauslösung Polens aus dem Zarenreich, seine politisch und wirtschaftlich enge Anbindung an die Mittelmächte. Im Osten hinzu kam die nur vage Vorstellung, weitere Teile des Zarenreiches, insbesondere das Baltikum, zukünftig an Berlin zu binden.
Heute, im Jahre 1929, kann ich nicht verhehlen, dass mir meine eigene Haltung zu jenen Fragen ein wenig unangenehm ist. In guter nationalliberaler Tradition hatte ich ja bereits seit meinem ersten Einzug in den Reichstag 1907 jegliche koloniale Erwerbung und eine starke Flotte vehement befürwortet. Vom Herbst 1914 bis zum Jahresbeginn 1918 gar gehörte ich dann zu denjenigen, die ebenso wie die Herren Stinnes oder Tirpitz nun gar nicht genug davon bekommen konnten, in euphorisierenden Phantastereien immer größere Teile Europas dem unmittelbaren hegemonialen Herrschaftsbereich des Reiches einzuverleiben. Dass dies dazu führte, nicht einmal einen Ansatz für Verhandlungen mit unseren Feinden von damals zu finden, störte mich durchaus nicht. Denn ich vertraute so sehr auf den Erfolg unserer Waffen und unserer Rüstungs- und Kriegswirtschaft, ich war von unserer Überlegenheit über alle drei gegnerischen Weltmächte derart unverbrüchlich überzeugt, dass mich diese Haltung im Frühjahr 1917 tatsächlich in eine schwierige Situation gegenüber den drei Parlamentariern brachte, mit welchen ich in der Frage des Wahlrechts ja sehr wohl eine gewisse Gemeinsamkeit fand.
Sowohl meine Auffassung in Angelegenheiten der Kriegsziele waren der militärischen Reichsleitung bekannt als auch die im April und Mai 1917 regelmäßig geführten Gespräche zwischen Erzberger, Haußmann, Scheidemann und mir. Das hatten wir zwar nicht beabsichtigt, doch Berlin ist und war halt ein sehr kommunikatives Pflaster, in Bezug auf die Mitglieder der politischen Führung vielleicht gar ein Dorf. So kam es, dass ich vor dem 20. Mai eine Einladung von einem gewissen Oberst Bauer aus der Obersten Heeresleitung erhielt. Der mir bis dahin nur namentlich bekannte Herr schrieb mir einen sehr förmlichen, aber auch ein wenig offenen Brief, handschriftlich, und lud mich für den 22. des selben Monats in sein Büro im Berliner Kriegsministerium an der Wilhelmstraße ein. Er reise dann für kurze Zeit von der OHL in Spa in die Reichshauptstadt. Anlässlich eines Abendessens Bauers mit Herrn Generalleutnant Ludendorff habe der Generalquartiermeister den Wunsch geäußert, mehr über die aktuelle Zusammenarbeit zwischen den maßgeblichen Fraktionen des Reichstags zu erfahren. Als er, Bauer, Ludendorff daraufhin angedeutet habe, es gebe Gerüchte über geheime Gespräche zwischen den obersten Führern von Zentrum, Fortschrittspartei, Nationalliberalen - und ja sogar der Sozialdemokratie, habe der General erstaunt reagiert. Nein, es sei wohl mehr gewesen, Entrüstung! Die Herren Ludendorff und Bauer seien sich einig, einzig und allein die treu zu Kaiser und Reich stehende Nationalliberale Partei in diesem Fall kontaktieren zu können. Wegen der gesundheitlichen Unpässlichkeiten von Herrn Fraktionsvorsitzenden Bassermann bäte er, Bauer, daher nun dessen Stellvertreter und prospektiven Nachfolger, Herrn Doktor Stresemann, um eben diese Unterredung. Wegen der Bedeutung der Angelegenheit wäre er ausgesprochen dankbar, falls ich den vorgeschlagenen Termin einrichten könne. Eine fernmündliche Zusage im Sekretariat des Generalstabschefs genüge.
Mir war unwohl damals. Die OHL wollte mich geradezu ausquetschen. Ich durfte einerseits keine vertraulichen Gesprächsinhalte preisgeben. Ich musste andererseits meine unbedingte Zuverlässigkeit gegenüber der Reichsleitung unter Beweis stellen. Ein kaum zu vollbringender Spagat würde mir abverlangt werden. Um so erleichterter war ich dann über den Verlauf der Unterredung mit Oberst Bauer selbst.
Oberst Max Bauer übte in der OHL diverse rüstungswirtschaftliche Aufgaben, insbesondere die Entwicklung und Beschaffung von Artillerie betreffend, aus. Vor allem anderen aber war er von überragender Bedeutung, da Bauer als der Vertraute von General Ludendorff überhaupt galt. Generalquartiermeister Ludendorff wiederum galt in allen maßgeblichen Kreisen Berlins bereits wenige Monate nach Bildung der dritten OHL im August, also spätestens seit Weihnachten 1916 noch vor Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg als der wirklich starke Mann der militärischen Reichsleitung. Ludendorff galt in meiner Reichstagsfraktion sogar als der mächtigste Mann Deutschlands, vor dem Reichskanzler und vor dem Kaiser. Also war Bauer wichtig, sehr wichtig. Wir trafen uns in seinem unscheinbar kleinen Büro im dritten Geschoss des Ministeriums. Oberst Bauer eröffnete unser Vieraugengespräch in für mich überraschend schonungsloser Offenheit. Angenehm war mir gleich, dass der Herr entgegen der Gewohnheit beinahe aller maßgeblichen Militärs völlig ohne Pathos sprach, eher wie in einem kleinen Zirkel alter Freunde, die über das Privileg verfügen, auf Taktik im Umgang miteinander gänzlich verzichten zu können.
„Sehr verehrter Herr Doktor Stresemann, sie sind ein viel beschäftigter Mann in Berlin. Daher betrachte ich es keineswegs als selbstverständlich, dass sie ihren Kalender so kurzfristig für mich und mein Anliegen frei geräumt haben. Dabei äußerte ja schließlich nicht der Herr Generalquartiermeister selbst, sondern ein einfacher Stabsoffizier der OHL diesen Wunsch. Dafür möchte ich mich gleich mit einer einleitenden Bemerkung bedanken: Es liegt mir vollständig fern, sie an meinem Schreibtisch über den Inhalt ihrer Gespräche mit den Herren - ja es sollen die Abgeordneten Haußmann, Erzberger und sogar dieser Scheidemann sein - über das Wahlgesetz des Königreiches Preußen auszufragen. Das brächte sie in unvertretbare Loyalitätskonflikte, und das wiederum liegt Herrn Generalleutnant Ludendorff fern. Außerdem hat Seine Majestät der Kaiser ja auch erst gerade in seiner Osterbotschaft den Massen und damit vorrangig der Sozialdemokratie in Aussicht gestellt, das Wahlrecht in Preußen nach dem Sieg zu reformieren.
Mir geht es heute allein um die sehr wichtige Angelegenheit der deutschen Kriegszielpolitik. Und da ist der Obersten Heeresleitung bekannt geworden, dass der Herr Reichstagsabgeordnete Erzberger einen Pfeil im Köcher zu haben scheint. Sind sie einverstanden, dass wir hierüber heute einen vertraulichen Austausch unter patriotischen deutschen Männern pflegen?”
Mir gefiel Bauers ehrliche Art sehr, auch wenn ich ihn gerne dahingehend korrigiert hätte, dass Wilhelm II. am 7. April nicht nur in Aussicht gestellt, sondern sogar öffentlich zugesagt hatte, das Dreiklassenwahlrecht in Preußen nach dem Sieg zu verändern. Ich war zugleich erleichtert, zu diesem Thema keinerlei Loyalitätskonflikten entgegen zu sehen. Und mir wurde schlagartig klar, dass ich Oberst Bauer nicht abschlagen konnte, über die Kriegszielfrage mit ihm zu sprechen.
„Herzlichen Dank, Herr Oberst, für ihre klaren Worte.
Bitte richten sie Herrn Generalleutnant Ludendorff die herzlichsten Grüße von mir aus. Zuletzt begegneten wir uns, sofern mich die Erinnerung nicht trügt, beim Neujahrsempfang Seiner Majestät im Januar. Ich schätze es sehr, dass der Generalquartiermeister insbesondere in Fragen der deutschen Kriegsziele so unmissverständliche Worte findet. Das war auch damals im Schloss Charlottenburg der Fall, als wir mit Herrn Ballin und einigen Herren von der Ruhr zusammen standen.
Was die Gegenstände meiner Erörterungen mit den eben von ihnen benannten führenden Herren der Reichstagsfraktionen betrifft, möchte ich die ihnen zu Ohren gekommenen Hinweise durchaus bestätigen. Wir sprechen des Öfteren und dabei steht das Wahlrecht in Preußen im Mittelpunkt. Dabei ist uns selbstverständlich bekannt, dass angesichts der preußischen Verfassung und wegen der Mehrheiten im preußischen Abgeordnetenhaus Seine Majestät das letzte Wort hat und ansonsten das Zusammenwirken von Konservativen und Nationalliberalen erforderlich bleibt, um Mehrheiten zu bilden. Fernerhin nehme ich ihr Angebot hiermit dankend an, keine vertiefenden Inhalte zu berichten und den übrigen drei Herren damit ein verlässlicher Partner zu sein und zu bleiben.
Was die Kriegsziele des Reiches betrifft, stehen die Verhältnisse insofern anders, als dass die Äußerungen von uns vieren in den öffentlichen Sitzungen des Reichstags seit September 1914 für sich sprechen und der deutschen Öffentlichkeit hinlänglich bekannt sind. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass ich persönlich und meine Fraktion unverbrüchlich zu den Septemberzielen des Herrn Reichskanzlers stehen. Es ist ebenso unverrückbar, dass die Fraktionen der Fortschrittlichen, des Zentrums und der Sozialdemokraten vor allem anderen einen Verhandlungsfrieden anstreben. Und wer solche Prioritäten setzt, der kommt nicht umhin, sich in seinen Forderungen zu bescheiden, ja sogar der populären sozialistischen Forderung im Grundsatz - ich betone nur im Grundsatz - zuzustimmen, ein Frieden ohne Annexionen und Kontributionen sei auch für unser Reich ehrenhaft und verhandelbar.”
Oberst Bauer hörte mir aufmerksam und offenkundig zufrieden zu, ob der ebenfalls klaren Worte, die er meinem Munde entnahm.
„Und die Herren haben detailliert zu erkennen gegeben, worin ihr Kriegszielprogramm für eine internationale Friedenskonferenz bestünde?”
„Nun, Herr Oberst, so ist das nicht. Das liegt sehr einfach daran, dass diese Frage, die für die OHL verständlicherweise im Mittelpunkt ihre politischen Arbeit steht, gar nicht im Mittelpunkt der Überlegungen der drei Herren steht.”
„Ach, darauf habe ich, und mit mir der Generalquartiermeister, aber sehr wohl gesetzt.”
„Sehr verehrter Herr Oberst Bauer, das politische Geschäft des Reichstags vollzieht sich tatsächlich nach etwas anderen Gesetzen, als man das in Spa so wahrzunehmen scheint. Insbesondere Herr Erzberger vertritt die These, es solle gar nicht so konkret wie möglich gesagt werden, was den Frieden kennzeichnen dürfe. Das sei doch schließlich die Verantwortung der Regierung. Er und auch Herr Scheidemann sinnieren manches Mal in unserer Runde über die Option einer Resolution des Deutschen Reichstags, die möglichst alle Fraktionen - bis auf die Konservative selbstverständlich - annehmen mögen. In einem solchen Text solle die Reichsregierung dann sehr deklaratorisch und wenig präzise, somit nur der Sprachwahl gemäß machtvoll aufgefordert werden, zu einer internationalen Konferenz einzuladen und wirklich einen Frieden ohne nennenswerte Abweichungen vom Status quo ante Bellum zu verhandeln.
Ich habe es abgelehnt, namens meiner Fraktion ein solches Ansinnen zu unterstützen. Ich habe das maßgeblich damit begründet, dass eine solche Friedensinitiative wie noch keine zweite zuvor von der Welt als Schwäche Deutschlands aufgefasst werden müsste. Und daraufhin gäbe es keine Aussicht auf Annahme des Vorschlags. Ich habe weiter den Kollegen Erzberger und Scheidemann gegenüber erklärt, es sei weiterhin meine unverrückbare persönliche Überzeugung, dass unser Reich in der Welt von morgen nur dann werde bestehen können, falls es uns gelänge, unsere Stellung in der Mitte Europas zum wenigsten so weit zu konsolidieren, dass wir auf unabsehbare Zeit keinen feindlichen Angriff mit ernst zu nehmender Erfolgsaussicht an zwei Fronten mehr erleiden müssten. Und and dieser Stelle stehen wir heute. An dieser Stelle ist es auch keineswegs möglich, dass die vier Fraktionen, die ja eigentlich Konsultationen über das Wahlrecht zu führen beabsichtigten, zu einem Konsensus in Fragen des Krieges an sich gelangen werden.”
„Und das würden sie, sehr verehrter Herr Doktor Stresemann, auch Herrn Generalleutnant Ludendorff persönlich berichten?”
Ich stutze, doch nur für eine Sekunde der Überraschung.
„Aber selbstverständlich, lieber Herr Oberst. Sofern man mir die Vertraulichkeit der Unterredung zusicherte, würde ich jeder Persönlichkeit der Staatsleitung, sogar dem Herrn Reichskanzler oder Seiner Majestät, dem Kaiser selbst, diese Erklärung abgeben.”
„Ein schönes Stichwort, lieber Herr Doktor.
Es ist nicht Seine Majestät, der dieses Anliegen vorbringen könnte. Doch wie wäre es wohl, falls seine kaiserliche Hoheit, der kommandierende General der Heeresgruppe deutscher Kronprinz, Kronprinz Wilhelm höchst persönlich, ein Gespräch mit ihnen zu führen gedächte? Wäre das für sie vorstellbar?”
„Ich empfinde es als meine Pflicht gegenüber dem deutschen Kaiserhause, seine Mitglieder in allem zu unterstützen, das dem Wohle unseres Landes und der Krone dienen möge. Ich bleibe dabei, im Fall der zweifelsfreien Vertraulichkeit eines Gespräches stehe ich zur Verfügung.”
Sodann wechselten wir das Thema hin zu diversen Fragen der Rüstungsproduktion, der Ausstattung unseres Heeres mit Waffen und Munition, natürlich einschließlich der Einschätzung darüber, wie lange unsere Feinde, vornehmlich Großbritannien, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wohl noch überstehen könnten, ohne wirtschaftlich in Not zu geraten. Es war intensiv und anregend, sich mit Oberst Bauer zu unterhalten. Als wir uns verabschiedeten, meinte er nur recht knapp:
„Sie werden bald von mir hören, lieber Herr Doktor Stresemann. Zurück in Spa berichte ich seiner Exzellenz, Generalleutnant Ludendorff, und er wird dem Kronprinzen berichten. Vielleicht sehen wir uns schon recht bald wieder.”
So kam es. Genau eine Woche später empfing mich seine kaiserliche Hoheit im Berliner Stadtschloss im Beisein des Generalquartiermeisters und des Obristen Bauer. Es wurde ein mindestens für mich denkwürdiges Gespräch, weil es mein Bewusstsein dafür schärfte, welche gravierenden innerparteilichen Unstimmigkeiten daraus in Zukunft wohl resultieren mochten, falls meine Fraktion und ich den Weg der Annäherung an die fortschrittlichen Kräfte in der Innenpolitik wählen sollten, während der nationalliberale Weg in der Außen- und Kriegszielpolitik weiterhin eng an der Seite der Reichsleitung bliebe. An jenem 29. Mai 1917 im Berliner Stadtschloss beschritt ich sehr zaghaft einen Weg, der mich im Folgejahr an der Seite guter Freunde und in harten Verhandlungen mit großen Gegnern zu einer Friedensordnung führen sollte, die - das darf man sicherlich heute bereits so sagen - die Grundfesten für die Weltordnung des 20. Jahrhunderts bedeuteten.
„Mein lieber Doktor Stresemann, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?”
„Kaiserliche Hoheit, haben sie herzlichen Dank für die freundliche Einladung zu dieser Unterredung. Ich freue mich sehr darüber.
Was ihre Frage anbelangt, es war zum Neujahrsempfang Seiner Majestät, ihres verehrten Herrn Vaters, dass wir uns im Charlottenburger Schloss zuletzt begegneten. Es war mir ein Vergnügen mit ihnen und Herrn Generalquartiermeister Ludendorff einige Worte wechseln zu dürfen.”
Ich reichte Ludendorff die Hand und verneigte mich dabei, wie es unter Offizieren und selbst seitens deutscher Zivilisten gegenüber einem wahrlich hoch stehenden Militär üblich ist.
„Aber noch im letzten Jahr, mein lieber Stresemann, da haben wir uns des Öfteren gesehen. Mir hat es wichtige Erkenntnisse erbracht, im letzten Herbst mit ihnen über das Vaterländische Hilfsdienstgesetz plaudern zu dürfen. Unser gemeinsames Treffen mit Herrn Rathenau ist mir da besonders eindringlich in Erinnerung geblieben. Der Präsident der AEG beeindruckte mich ohne Zweifel. Er fügte seine Erfahrungen als Leiter des Reichsrohstoffamtes und seine Kenntnisse über die Industrie damals zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Rathenau zeigte mir damals, dass unsere Rüstungswirtschaft mit Arbeiterausschüssen besser funktionieren werde als ohne.”
Ich musste schmunzeln, als ich daran zurückdachte, wie verwundert Walther nach dem Treffen über die zuweilen offensichtliche Naivität des Kronprinzen urteilte. Seine kaiserliche Hoheit hatte kaum eine Vorstellung davon, wie scharf die Abwehrmaßnahmen gerade der Schwerindustrie gegenüber jeglicher gewerkschaftlicher Organisation im Betrieb ausfielen.
„Für mich und meine Fraktion war zusätzlich von größter Bedeutung, kaiserliche Hoheit, welche Aussichten uns Herr Rathenau für die Nachkriegszeit eröffnete: Die Erprobung der Arbeiterausschüsse im Kriege werde den Betriebsfrieden fördern, die Arbeitsmotivation der Arbeiterschaft insgesamt steigern und damit der deutschen Industrie einen schönen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkte verschaffen. Das sehe übrigens Herr Duisberg von der IG Farben genau so.”
„Ich erinnere dies, mein lieber Stresemann. Und ich hoffe doch sehr, dass die Herren Vertreter der Exportindustrien auf der ganzen Linie recht behalten werden.”
Wilhelm lachte, Ludendorff stimmte mit ein, ich lächelte und war auf den nächsten Schachzug gespannt.
„Aber heute treffen wir uns ja, lieber Stresemann, weil wir nicht mehr 1916 haben, sondern 1917, und da dringen manch beunruhigende Nachrichten an mein Ohr. Die führenden Herren der so genannten demokratischen Fraktionen im Deutschen Reichstag scheinen sich zusammen zu tun. Aber wozu, oder wogegen?
Geht es gegen die Krone, gegen das Wahlrecht im Königreich Preußen oder geht es gegen unsere auswärtige Politik mit all den Zielen, die das Reich verfolgen muss, um in Zukunft auch in einer Welt von Feinden bestehen zu können? Ich gebe freimütig zu, das beunruhigt mich, das beunruhigt uns, also auch die Oberste Heeresleitung mit seinen Exzellenzen Hindenburg und Ludendorff, auf das Außerordentlichste!
Und doch bin ich frohen Mutes zu wissen, dass eine so integere und vaterländisch gesinnte Persönlichkeit wie sie, lieber Stresemann, von jenen demokratischen Herren zu Rate gezogen wird. Das bestärkt mich in der Hoffnung, dass ein Brückenschlag weiterhin möglich bleibt. Ich meine, eine Brücke sollte errichtet werden von der Krone und der zivilen wie der militärischen Reichsleitung aus. Diese erstrecke sich dann über die ohne jeden Zweifel erhabenen, die vaterländischen Parteien der Konservativen und der Nationalliberalen bis ganz weit nach links im politischen Spektrum des Reiches, bis zu den Sozialdemokraten. - Halten sie meine Hoffnung für begründet?”
Die Frage des Kronprinzen kam abrupt. Ich muss gestehen, ich war ein wenig überrumpelt. Ich weiß es noch ganz genau: Um Zeit zu gewinnen, sehe ich langsam und der Reihe nach in die drei mir gegenüber sitzenden Gesichter. Einzig Bauer wirkt auf eine überzeugende Weise entspannt, so als träfen wir uns hier tatsächlich im privaten Rahmen.
„Kaiserliche Hoheit, eure Sorge um Deutschland zeigt den ehrenhaften Charakter unseres heutigen Treffens. Mir geht es ganz ähnlich wie euch, dass ich mir ein wenig wie das Scharnier zwischen zwei Flügeln des politischen Lebens im Reich vorkomme. Da sind die nationalen Kräfte auf der einen, die linksliberalen und demokratischen Kräfte auf der anderen Seite. Und ja, ich habe Hoffnung, Hoheit, weil ich in sehr intensiven Erörterungen mit drei hoch intelligenten und auch verantwortungsbewussten Menschen, den Herren Haußmann, Erzberger und Scheidemann, erfahren durfte, dass dort zwar der Geist der Demokratie, indes nicht der Geist des Aufruhrs herrscht.”
Ludendorff hat sich vorgebeugt und darüber sein Interesse bekundet, in das Gespräch eingreifen zu mögen.
„Das müssen sie uns näher erklären, lieber Doktor Stresemann, das könnte ja durchaus etwas Neues bedeuten.”
„Ob neu oder nicht, ist vielleicht gar nachrangig, Herr Generalquartiermeister. Schließlich haben Ultramontane und Sozialisten bereits 1914 die Kriegskredite mitgetragen. Doch was sie von mir zu erfahren verlangen, ist ja vornehmlich dieses: Das Zentrum ist selbstverständlich nicht der Träger revolutionären Gedankengutes in Deutschland, solange die Katholiken ihre kulturelle Autonomie wahren können. Die Sozialdemokraten dagegen sind tief gespalten. Das verstellt uns wohl gar manches Mal den Blick dafür, wohin die Reise dort geht.
Herr Haase, Herr Liebknecht oder Frau Luxemburg lehnten schon die Kriegskredite und das Hilfsdienstgesetz ab. Sie lehnen auch heute weiterhin die Monarchie ab. Aber berechtigt das zu eurer Sorge, kaiserliche Hoheit? Ich bin mir gewiss: Nein, keineswegs! Ihnen, den Aufrührern, stehen die Vorsitzenden von Partei und Reichstagsfraktion, die Herren Ebert und Scheidemann gegenüber. Diese wissen eine breite Mehrheit in Volk und Partei hinter sich. Ebert und Scheidemann wollen nichts weniger als eine Revolution in Deutschland. Die aktuellen Ereignisse in Russland lehren sie das Grauen. Es passiert dasselbe, was von 1790 bis 1794 in Paris geschah: Die Revolutionäre putschen gegenseitig die Stimmung hinauf und fördern damit nur die immer radikaleren Kräfte. Sie fürchten solches auch für unser Reich. Und was in Russland die Liberalen und die Menschewiki sind, könnten bei uns das Zentrum und die Mehrheits-SPD sein. Was jedoch in Russland Lenin und Kamenew sind, das würden bei uns Liebknecht und seine Freunde.
Um ein revolutionäres Chaos in Deutschland zu verhindern, im Keime zu ersticken, finden sich die Herren Ebert und Scheidemann mit der Monarchie als für Deutschland und Preußen kulturell vorherbestimmter und zum Fortschritte fähiger Regierungsform ab. Das sagen sie in den eigenen Reihen inzwischen sogar hinter den berüchtigten geschlossenen Türen. Doch was ihnen noch fehlt, um die eigene Anhängerschaft sicher zu überzeugen, sind unmissverständliche Zeichen des Entgegenkommens der Monarchie selbst.”
„Lieber Stresemann, wie kann man an dem aufrichtigen Willen meines Vaters, des Kaisers und seiner Regierung zweifeln? Ich nenne da das Hilfsdienstgesetz aus dem vorherigen Jahre. Ich betone da die ganz frische Osterbotschaft mit der Zusicherung, das Wahlrecht in Preußen werde nach dem Kriege geändert. Die Monarchie ist modern und sie ist ihren Arbeitermassen dankbar für den aufopferungsvollen Einsatz an der Heimatfront wie an der heißen Front. In meiner Eigenschaft als Befehlshaber der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz habe ich die Leistung des deutschen Landsers nicht nur einschätzen, vor allem habe ich sie schätzen gelernt. Ich kenne inzwischen auch seine tiefe Sorge um die gesunde Ernährung der Lieben daheim. Das Königreich Preußen, der Staat nach dem Vorbilde Kants, Hegels und Friedrichs des Großen, mein lieber Stresemann, sorgt sich um seine Untertanen!”
„Aber sicher doch, kaiserliche Hoheit, das wissen nicht nur sie und ich. Das weiß auch die Führung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Doch die Arbeitszeiten werden immer länger, das Leben entbehrungsreicher, die Versorgung immer knapper. Das wirkungsvollste Zeichen für die Bildung der solidarischen Volksgemeinschaft, die keines Sozialismus mehr bedürfe, wäre nach wie vor die Reform des preußischen Wahlrechtes schon jetzt, im Kriege. Auch das ist Gegenstand meiner Gespräche mit den Herren Erzberger, Haußmann und Scheidemann.
Und eben an dieser Stelle laufe ich Gefahr, in einen Loyalitätskonflikt zwischen der Krone und dem Reich hier, den besagten drei Herren dort zu geraten. So gut ich es vertreten konnte, ihnen alles bisher Gesagte zu berichten, so sehr ist es meine Pflicht gegenüber den Herren, nichts weiter zum preußischen Wahlrecht verlauten zu lassen. Ich setze auf ihr Verständnis.”
„Zuverlässigkeit ist eine hohe Tugend. Ich möchte gar nicht weiter in sie dringen, sofern sie mir versichern können, dass ihre Erörterungen in keinster Weise einen Akt des Hoch- und Landesverrats zum Ergebnis haben könnten.”
Die Bemerkung des Kronprinzen lässt die Spannung bei den beiden Militärs am Tisch schlagartig steigen. Ich jedoch lächele.
„Da dürfen sie ganz beruhigt sein, kaiserliche Hoheit. Keiner meiner drei Gesprächspartner aus dem hohen Hause des Reichstages verfolgt ein staatsfeindliches Ziel oder auch ein anderes Ziel, dies dann aber mit staatsfeindlichen Mitteln. Und sollte sich dies ändern, empfände ich es als meine vornehmste Pflicht gegenüber der Monarchie, sie ins Vertrauen zu ziehen.”
Kronprinz Wilhelm lehnt sich gemächlich zurück. Er bietet seinen drei Gästen Zigarre oder Zigarette an. Selbst wählt er eine leichte kubanische Zigarre und zündet diese genussvoll an.
„Stresemann, sie sind ein Mann von Ehre und Format! Ich danke ihnen für die klaren Worte, noch mehr für die tadellose Gesinnung, die dahinter steht. In Angelegenheiten des Wahlrechtes zum Abgeordnetenhaus der preußischen Monarchie gibt es nunmehr von meiner Seite nichts mehr zu sagen. Doch etwas anders fällt mein Bedürfnis aus, die Sicherheit des Reiches auf der Ebene seiner auswärtigen Politik zu beurteilen. Ich bin davon unterrichtet, dass der Herr Abgeordnete Erzberger und mit ihm die gesamte Fraktion des Zentrums einen Coup vorbereitet. Dieser soll dem Vernehmen nach darin bestehen, dem Deutschen Reichstag den Entwurf einer Resolution vorzulegen, mit der der Reichskanzler und die OHL auf womöglich unerträgliche Art und Weise unter Druck gesetzt werden könnten, offiziell die Mächte der Entente um Verhandlungen über einen Verständigungsfrieden anzugehen. War davon so ganz am Rande ihrer Erörterungen mit den Herren Haußmann, Scheidemann und eben auch Erzberger einmal die Rede?”
Die Höflichkeit im Vortrag seiner kaiserlichen Hoheit erstaunt mich. Er spricht beinahe wie ein Diplomat. Dabei will er sehr klar von mir wissen, ob auf dem Gebiete der Kriegsziele eine Lage eintreten könnte, die die Reichsleitung sehr viel eher als im Falle des Wahlrechts als einen Akt des Hochverrats bewerten dürfte. Hier muss ich ansetzen.
„Am Rande wohl, kaiserliche Hoheit, ist das eine oder andere Wort bezüglich der deutschen Kriegsziele gefallen, auch über die stets lauter werdenden Forderungen aus Petersburg, einen Frieden ohne Sieger und Besiegte ins Auge zu fassen. Noch seltener folgte eine Andeutung dazu, wie die Herren Vertreter der demokratischen Parteien gedächten, ihrer unverhohlenen Sympathie für jene Forderung in der deutschen Öffentlichkeit wirkungsvoll Gehör zu verschaffen.
Wenngleich ich wenig Handfestes aus jenen vereinzelten Anmerkungen entnehmen kann, so entwickelt sich vor meinem geistigen Auge dennoch ein klares Bild. Kein mir näher bekanntes Mitglied des Reichstages beabsichtigt, Geheimnisse aus den jeweiligen Kriegszielerörterungen mit der Reichsregierung Preis zu geben. Alle drei Teilnehmer an meinem Austausch über das Wahlrecht hingegen könnten sich sehr wohl als probates Instrument vorstellen, den Deutschen Reichstag einmal öffentlich mit dieser Frage der Verhandelbarkeit eines Verständigungsfriedens zu befassen. Ein Fall von Hochverrat droht also nicht!”
Oberst Bauer klopft sich auf den rechten Schenkel und lacht. Das nötigt den Kronprinzen und Ludendorff gleichfalls dazu, Gelassenheit zu demonstrieren. Sie schmunzeln und der Generalquartiermeister entgegnet:
„Sie haben Humor, mein lieber Doktor Stresemann!”
„In der Tat”, unterbricht ihn gleich Wilhelm, „rein formal betrachtet stellt eine Befassung des Reichstags keinen Hochverrat dar. De facto würde eine solche Initiative mit sämtlichem, dazugehörigem Presseecho unsere Feinde so massiv in die Hände spielen, dass ich vom Ergebnis her gesehen durchaus einige Züge von Hochverrat zu erkennen glaube. Das gilt um so mehr, als dass eine denkbare Friedensresolution des Reichstages ja genau diese Absicht des oder der Verfasser verfolgte. Ich meine damit, nämlich die militärische wie die zivile Reichsleitung erheblich unter Druck zu setzen durch die Mobilisierung der zunehmend kriegsmüden deutschen Öffentlichkeit.
Doch ich sitze hier nicht mit dem zukünftigen starken Mann der Nationalliberalen Fraktion, um mich in kleingeistigen Formalia zu ergehen. Stattdessen und ganz im Gegenteil möchte ich mit Ihnen erörtern, was die voraussichtlichen Effekte einer derartigen öffentlichen Debatte sein könnten, und ich möchte dabei nicht aus dem Blick verlieren, welche wahren Absichten die demokratischen Parteien dabei im Schilde führten.”
Der Kronprinz sieht mich geradezu provozierend auffordernd an. Doch ich schweige, und behalte die Ruhe. Ich bin mir fast sicher, dass er für diesen Fall schon eine eigene Interpretation der politischen Wirklichkeit im Reich parat hält. Und tatsächlich, Wilhelm lässt sich gar nicht lange bitten. Nach einem ganz schnellen Abaschen seiner Zigarre setzt er seine Rede fort.
„Es dürfte sich doch wohl so verhalten:
Herr Erzberger entwirft als Initiator einen oder gleich mehrere Texte für eine Resolution, die eine Aufforderung an die Reichsregierung enthält, anlässlich der Revolution in Russland an einen oder mehrere Gegner das Angebot zum Frieden auf der Grundlage des Status Quo ante Bellum, oder ohne Annexionen und Kontributionen zu unterbreiten. Herr Scheidemann, der dies vollinhaltlich unterstützt, kündigt das Wohlwollen, nein vermutlich gleich die Zustimmung seiner Fraktion an. Herr Haußmann wird da eher von Gewissenbissen geplagt, ob es selbst bei gleichen Zielen - dem baldigen Frieden unter beinahe jeder Bedingung - für eine liberale, bürgerliche Partei mit einer großen Tradition wie die Fortschrittliche opportun und ziemlich sei, mit Zentrum und Sozialdemokratie politische Händel zu veranstalten. Am Ende findet er es dann wohl zu verlockend, als dritte Kraft zu einer stabilen Reichstagsmehrheit beizutragen, die dieses Mal und in Zukunft immer aufs Neue in der Lage wäre, die Regierung mit öffentlichkeitswirksamen Forderungen vor sich her zu treiben. - Und so einer Dreier-Bande wollen Sie, lieber Stresemann, im Reich und in Preußen die Macht über das Budget anvertrauen?”
„Kaiserliche Hoheit, wir hatten uns doch eben noch darüber geeinigt, dass wir die Wahlrechtserörterung für heute hinten anstellen wollten.”
In den Augen des Kronprinzen blitzt eine Mischung aus Amüsement über und Anerkennung für den Gesprächspartner auf.
„Ja sicher, selbstverständlich lieber Stresemann. Da sind gerade nur die Pferde mit mir durchgegangen, so beunruhigend wie ich die Perspektive eines stabilen Bündnisses der drei so genannten demokratischen Parteien persönlich empfinde. Nur verstehen sie vielleicht jetzt, warum ich meinem verehrten Herrn Vater derzeit völlig beipflichte, dass wir der Arbeiterklasse vor Kriegsende nicht bereits den Lohn des noch nicht errungenen Sieges zugestehen sollten. Was wäre vielleicht die Folge? Dass die Herrschaften Arbeiterführer im Reichstag gleich zum Generalstreik aufforderten, um im nächsten Schritt ihre Vorstellung von Friedensverhandlungen zu erzwingen?”
Das war schlagfertig und dabei messerscharf analysiert und argumentiert. Meine Hochachtung vor dem politischen Esprit des Kronprinzen stieg bei seinen Worten merklich.
Insgeheim beschlichen mich seit Wochen ähnliche Sorgen um die unbedingte Erhaltung der Wehrkraft unserer Nation, falls die Resolution Erzbergers käme. Und allein schon wegen dieser Resolution mochte ich mir erst gar nicht weiter ausmalen, welche weiteren Folgen das gleiche Wahlrecht in Preußen zeitigen könnte. Für mich war es damals noch unglaublich und unvorstellbar mir auszumalen, dass wir auf Erwerbungen im Westen verzichten sollten. Denn es war für mich ebenso unvorstellbar, dass es eine andere Möglichkeit zur Beendigung dieses größten Krieges aller Zeiten geben könne als den vollständigen Sieg der deutschen Waffen - mit der unabdingbaren direkten Konsequenz einer starken Vorherrschaft Deutschlands über Kontinentaleuropa. Ich dachte damals selbstverständlich an das gesamte Kontinentaleuropa wohl gemerkt, so dass den Engländern nur noch ihre Insel und das Empire bliebe, nicht mehr aber das alte Spielchen der Balance of Power, um die jeweils größte Macht auf dem Kontinent in Schach zu halten. An diesem Punkt war ich nun wirklich einige preußische Landmeilen von den Herren Erzberger, Scheidemann und Haußmann entfernt. Diese hatten längst begriffen, dass sie durch unsere Gespräche niemals würden erreichen können, dass ich für die Nationalliberale Reichstagsfraktion auf Erwerbungen und den mitteleuropäischen Zollverein verzichten würde. Sie hofften indes weiterhin stark darauf, dass ich die Nationalliberalen in eine kultivierte Opposition gegen die Friedensresolution hineinführen möge. Das brachte mich plötzlich auf eine Idee für die Argumentation gegenüber den Herren von der militärischen Reichsleitung.
„Es gibt einen offenkundigen und unverrückbaren Hintergrund dafür, warum die Herren vom Fortschritt, vom Zentrum und von der SPD mit mir weitaus lieber über das Wahlrecht in Preußen sprechen als über die Modalitäten eines Friedens für Europa. Alle drei wissen inzwischen sicher, dass es einen Grundton der Einigkeit in der Frage gibt, ob ein neues Wahlrecht die Heimatfront beruhigen, die Arbeitsmotivation in den Fabriken heben und das Reich vor einer Revolution würde schützen können. Hier bin ich zuversichtlicher als sie, kaiserliche Hoheit oder sie, Herr Generalquartiermeister, als führender Vertreter der OHL, was die patriotische Gesinnung der Millionen von einfachen Leuten in der Wählerschaft von Zentrum und SPD angeht. Deshalb bin ich in dieser Frage womöglich auch näher bei den Herren der demokratischen Fraktionen als bei der Reichsleitung.
In Angelegenheiten des Friedens dagegen fällt mein Urteil anders aus: Ich bin kein Phantast, der unseren Feinden auch nur einen Funken von Zurückhaltung zutraut, falls es darum gehen sollte, eine Schwäche des Reiches brutal und schonungslos auskosten zu können. Daher neige ich am Ende in dieser Frage sehr viel mehr zu Ihnen und dem Herrn Reichskanzler, die sie allesamt keinen Fuß breit deutscher Interessen auf dem Altar der Einigung mit der Reichstagsmehrheit zu opfern bereit sein werden.” Ludendorff wirkt erfreut über den von mir mit der OHL und der Reichsregierung geübten Schulterschluss.
„Bravo, mein lieber Doktor Stresemann. Auch wenn ich es als Vertreter des Militärs nicht so sehr mit Herrn von Bethmann-Hollweg halte. Der ist mir gelinde gesagt schnurz! Sagen sie uns doch bitte gleich auch noch, welche Gedankenkette Sie in unser Lager treibt.”
Ich fühle mich gut. Es ist eine vertrauensbildende Maßnahme gelungen. Ich hoffe sehr, dass das Gespräch von nun an noch offener und zielorientierter verlaufen möge. Aber ich weiß auch, dass ich dazu etwas Wichtiges beizutragen hätte. Wie nämlich würde sich meine Fraktion im Deutschen Reichstag verhalten, falls Erzberger und Kollegen so geschickt sein sollten, eine Resolution für einen Verhandlungsfrieden nicht mit zu vielen inhaltlichen Aussagen, gleichsam Bindungen für spätere Verhandlungen zu belasten?
„Kaiserliche Hoheit, Exzellenz Generalquartiermeister, Herr Oberst Bauer, was eint mich mit Ihnen? Das ist eine der Schlüsselfragen. Aber es ist bei Gott nicht die Einzige. Welche Chancen geben die verschiedenen politischen Kräfte und auch die Träger von Entscheidungen in der OHL einer Friedensinitiative? Jeder im Reichstag macht sich über diese Frage sicher so seine eigenen Gedanken. Und ich, das wissen sie drei bereits, bin nicht zufällig Mitglied der Nationalliberalen Partei. Mein persönliches Verständnis von vaterländischer Politik basiert auf einigen unverrückbaren, für mich immens wichtigen Grundsätzen:
Ich möchte die Regierung des Deutschen Reiches stets unterstützen, wenn ich eine Politik erkenne, die an der Zukunft, am Wohle und an der Größe unserer Nation ausgerichtet ist. Soweit erklärt sich national und vaterländisch wie von selbst.
Liberal hingegen bezeichnen sich längst nicht alle Vertreter jener gesellschaftlichen Schichten unseres Landes, die den Rückhalt der Monarchie und zugleich die maßgeblichen Entscheidungsträger bilden. Anders als zahlreiche Junker leitet mich die Überzeugung vom Vorzug der Modernität, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen. Modernität indes verbürgen die Wissenschaften und vor allem die Industrie mit jenen ihrer Zweige, die für den Endkunden fertigen und die Investitionsgüter herstellen, welche ebenso für den Weltmarkt wie für den Bedarf unseres Vaterlandes produzieren. Deshalb bedeutet für mich liberal, frei nach innen wie nach außen die Verhältnisse zu gestalten.”
Generalleutnant Ludendorff rümpft bei meinem letzten Satz die Nase, während der Kronprinz lediglich wohlwollend lächelt, Oberst Bauer dagegen die Stirn in Falten legt. Das wundert mich natürlich nicht. Zu viel weiß ich von seinen Kontakten zu den maßgeblichen Herren der Schwerindustrie an der Ruhr.
„Nun sind indes die Herren Stinnes und Hugenberg ebenso Mitglieder der Nationalliberalen Partei wie die Herren Duisberg und Ballin oder auch Stresemann. Als stellvertretender Vorsitzender unserer Reichstagsfraktion ist es meine Aufgabe, mir mehr als nur eine persönliche Meinung über eine gute Politik für Deutschland zu bilden. Gerade in Zeiten, in denen mein Freund Ernst Bassermann leider von schwerer Krankheit geplagt ist und sein Amt nur bedingt ausüben kann, spüre ich die große Verpflichtung und, ja das will ich zugeben, auch die besondere Verantwortung. Diese ist schließlich von der schweren historischen Stunde geprägt, die die große Prüfung dieses Weltkrieges in sich birgt.
All das führt mich dahin, für unser Reich als Nationalliberale Reichstagsfraktion Kriegsziele zu fordern, die eine Wiederholung jener unsäglichen Einkreisung unmöglich machen, mit derer unsere Gegner ihr Netz über uns geworfen haben und uns 1914 keine andere Wahl ließen, als für die Zukunft der Weltmacht Deutschland ins Feld der Ehre zu ziehen. Somit lehne ich den Status quo ante kategorisch ab, meine Herren. Und genau daran, kaiserliche Hoheit, werden auch viele Sitzungen, womöglich unzählige Gespräche mit den Herren des Zentrums, der Fortschrittlichen oder der SPD nichts und niemals etwas ändern!”
„Bravo, bravo, mein lieber, lieber Stresemann! Wohl dem deutschen Manne, der so klare Worte findet und wählt wie sie.”
Kronprinz Wilhelm hat sich kerzengerade im Sessel aufgerichtet und bei seinen Worten mit der flachen Hand mehrmals anerkennend auf die holzvertäfelte Platte des Tisches vor sich geschlagen. Die Lautstärke des davon ausgehenden Geräusches erschreckt mich. Doch das hat auch sein Gutes, es führt zu einer schnellen Assoziation. Der Lärm erscheint mir wie Kanonendonner, Kanonen aus dem Hause Krupp - ach ja, Hugenberg und Stinnes, diese verfluchte Bande! Das erinnert mich sofort wieder daran, dass ich eine wahrlich wichtige Abgrenzung noch vorzunehmen habe.
„Eure Zustimmung ehrt mich und sie freut mich um so mehr, kaiserliche Hoheit, als dass ich ja die bedenkliche Einkreisung des Reiches durch gegnerische Weltmächte für alle Zeiten auszuschließen trachte. Wir sind hier im vertraulichen Kreise, daher äußere ich mich frei heraus: Meine Vorstellung von einem von Deutschland beherrschten Europa, von einem zum Nutz und Frommen, zum Wohlstande aller Nationen starken und einigen Kontinent habe ich mit wichtigen Männern des Reiches erörtert, und diese Vorstellungen sind nicht deckungsgleich mit den vielfach erhobenen Forderungen der führenden Vertreter der nordwestdeutschen Schwerindustrien und des Steinkohlenbergbaus. Ich verlange zwar eine unerschütterliche Stellung des Reiches gegenüber Frankreich für alle Zeit. Ich verlange jedoch nicht Gebietsabtretungen, die es dem Ehrgefühl der Grande Nation auf alle Zeit versagen würden, einmal wieder ein entspanntes, gar freundschaftliches Verhältnis zum Reich aufzubauen. Ich werde Ihnen gleich sogar noch erläutern, warum ich es gar nicht für erforderlich halte, größere Teile Ost- oder Nord-Frankreichs zu annektieren, lediglich um die Erzversorgung der deutschen Eisen- und Stahlindustrie sicher zu stellen. Aber vorab nenne ich Ihnen, was ich mir wünsche und zugleich hoffe, mit Ihnen gemeinsam für die Zukunft erstreben zu können.”
Ludendorff streckt seine Beine aus und ruft:
„Na, na, mein lieber Doktor Stresemann. Wir sind doch heute zu Ihnen gekommen, um etwas zu erfahren und unseren Nutzen aus dieser Unterredung zu ziehen.”
Dabei lächelt er sehr verschmitzt und ist sichtlich stolz auf den gelungenen humoristischen Einwurf.
„Wir wollen doch am Ende des Tages nicht von diesem Tische aufstehen und feststellen, dass sie uns auf ihre Seite gezogen haben, wir indes nichts vorzuweisen hätten. - Aber, Spaß beiseite. Sollten wir uns hier auf ein handfesteres Programm an Kriegszielen einigen, die wir unverbrüchlich gemeinsam fordern wollen, als es Herr von Bethmann-Hollweg bis heute zustande gebracht hat, so würden wir für die Diskussionen der Zukunft alle gestärkt und als Sieger von diesem Tische aufstehen dürfen.”
„Sehr erfreulich, dass es uns allen hier nicht um Gewinnen und Verlieren geht. Denn wir können alle gemeinsam gewinnen. Sofern wir mit der gleichen Zielrichtung gegen eine Friedensresolution des Deutschen Reichstages streiten werden, die unsere fundamentalen nationalen Interessen auf das Gefährlichste zu verscherbeln droht, zu verramschen regelrecht, erfüllen wir eine heilige nationale Pflicht! So schaffen wir nämlich die Voraussetzung dafür, dass unser Reich die Chance auf eine echte diplomatische Initiative erhält.”
Meine Worte lösen eine unmittelbare Reaktion aus.
„Oder auf eine militärische! Initiative meine ich.“
Der Zwischenruf des Kronprinzen überrascht mich nicht. Soll ich ihm jetzt zaghaft widersprechen? Nein, ich will es nicht tun. Denn sollte unser Heer einen großartigen Erfolg erzielen können, so würde es meinem Selbstverständnis eklatant widersprechen, einen solchen Erfolg durch unprofessionelle diplomatische Manöver oder eine von Zerwürfnissen geprägte deutsche Innenpolitik zu gefährden.
„Eben, oder auf eine militärische Initiative, die uns aber einen sichtbaren Vorteil gegenüber dem Feinde einbringen müsste, um in Friedensverhandlungen gewichtig in die Wagschale geworfen werden zu können. Doch, welchen Frieden meine ich?”
Ohne Worte nickt mir Ludendorff auffordernd zu und sitzt erwartungsvoll in seinem Sessel.
„Aus dem Septemberprogramm der Reichsregierung unterscheide ich zwischen den territorialen Forderungen, quasi als klassische Kriegsziele, wie wir sie schon seit Jahrhunderten kennen, und den ordnungspolitischen Vorstellungen für Europa. Was Landerwerb betrifft, so meine ich, die Möglichkeiten dazu hängen einzig und allein von der Machtposition ab, die eine Nation zum Zeitpunkt der Friedensverhandlungen erworben hat. Und diese Macht wiederum korrespondiert recht unmittelbar mit dem Erfolge auf dem Schlachtfeld. - Nun meine Herren Militärs, was soll ich darüber spekulieren? Nebenbei gelten sie in dieser Frage für mich als die größeren Experten als ich selbst oder auch der Reichskanzler. Wir müssen also abwarten. Wir müssen uns jedoch auch ganz ehrlich eingestehen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkte gar keine Friedensverhandlungen erreichen können. Warum ist das aber so?”
„Da bin ich aber sehr gespannt, ob wir nun auch noch übereinstimmen werden, lieber Stresemann.”
Wilhelm scheint sich zu amüsieren. Er hat sich neuen Kaffee einschenken lassen von einem Bediensteten, der stumm den Raum betreten hat. Mit einem Lächeln um die Lippen flüstert Wilhelm dem jungen Mann „Kognak” zu und sieht gleich darauf wieder mich an.
„Aber bitte, lassen sie sich doch von mir nicht stören.”
„Also, ich plädiere dafür, dass wir uns nichts vormachen:
Erstens, unsere Forderungen sind so weit reichend, dass sie die Machtverhältnisse auf dem Kontinent grundlegend und auf Dauer verschieben müssten. Darüber werden Franzosen und Briten nicht verhandeln.
Zweitens, die Forderungen unserer Feinde gehen gar so weit, dass sie Deutschlands Stellung als Großmacht unterminieren. Wir verlören die Autonomie der Entscheidungen über die Größe von Heer und Flotte. Unser Verbündeter in Wien würde zerstückelt, so dass Deutschlands Grenzen niemals wieder zu verteidigen wären. Im Westen und im Osten würden Teile unseres Reiches abgetrennt, vielleicht sogar ein Teilstaat unter Pariser Kontrolle am Rhein gebildet. Logisch also, dass wir unsererseits darüber niemals verhandeln werden, solange die Truppen der Entente nicht vor den Toren Berlins stehen.”
Oberst Bauer lacht lauthals auf.
„Die Franzosen an der Elbe und der Spree, das ich nicht lache. Wie sollen sie das denn schaffen?”
„Ich glaube ja nun gar nicht, dass der Feind in Deutschland einrücken könnte, sehr verehrter Herr Oberst. Doch zeigt das Beispiel im Umkehrschluss, wie unvereinbar die Positionen sind.
Jetzt aber drittens, sollten wir uns einmal in die Lage unserer Feinde versetzen. Was für uns als unakzeptabel gilt, empfindet der Feind umgekehrt ebenso. Also werden Clemenceau und Lloyd George niemals Verhandlungen zustimmen, es sei denn, sie wären militärisch praktisch erledigt, vollständig besiegt. Das träte aber erst ein, wenn wir die Front durchbrächen und Paris einnähmen. Zwar liegt Paris näher an der Front als Berlin, aber der Widerstandswille des Feindes wächst um so mehr, je stärker die Hoffnung wird, Amerika mit seinem ungeheuerlichen Industrie- und Rüstungspotenzial werde dem Westen doch noch zu Hilfe eilen.
Und zum guten Schluss, viertens: Was für die Franzosen Amerika ist, sind für uns die Revolutionäre in Russland. Unsere Hoffnungen auf den Zusammenbruch der politischen Ordnung im Osten nährt die Hoffnung auf die schleichende Auflösung der Front, dann auf das unweigerliche Ersuchen um Friedensverhandlungen seitens der Regierung des Fürsten Kerenski sowie der ihn unterstützenden Liberalen und Sozialrevolutionäre, oder auch ihrer weiter links stehenden möglichen Nachfolger. Wenn wir aber im Osten gesiegt hätten, wären sie drei, meine Herren, im Bunde mit Generalfeldmarschall von Hindenburg die allerletzten, die über Frieden mit Frankreich verhandeln würden. Sie würden vermutlich ihre Divisionen aus dem Osten in den Westen werfen und auf Sieg setzen.”
„Was wiederum fünftens bedeuten würde, verehrter Doktor Stresemann, beide Seiten sind von der Aufnahme von Friedensverhandlungen meilenweit entfernt. Das ist rein politisch-strategisch betrachtet, allen lärmenden Forderungen der linken Demokraten in allen Heimatländern der Kriegführenden zum Trotz.”
„Verehrter Herr Generalquartiermeister, sie sagen es. Mit meinen Überlegungen wollte ich nur auf eines hinaus: Es droht ein Patt, das dazu führen könnte, dass der bald drei Jahre währende Krieg noch über Jahre fortdauert. Und das, obgleich die Völker zusehends ausbluten. Wenn aber die Völker ausbluten, die Arbeiter kriegsmüde geworden sind, in Petersburg der revolutionäre Mob regiert, ist die Welt, ist unser altes Europa dann noch sicher? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Das eine um das andere Mal zermartere ich mir den Kopf darüber, ob es uns im Reich nicht gelingen könnte, diese gegenseitige Blockade der Krieg führenden Mächte zu durchbrechen. Wie? Mit neuartigen Kriegszielen, die, wie die Amerikaner seit neuestem immer so Mode beflissen sagen, für beide Seiten eine Win-win-Situation schaffen?”
„Und was soll das sein? Wie soll das denn funktionieren, lieber Stresemann?”
„Kaiserliche Hoheit. Ich glaube, dass wir nur Erfolg haben können, wenn wir die Sicherheitsordnung im Europa der Nachkriegszeit neu aufstellen. Deutschland ist mit Abstand die mächtigste und fortschrittlichste Wirtschaftsnation des Festlandes. Gelänge uns die Zollunion, gelänge uns die Schaffung eines lockeren Staatenbundes, in dem sich niemand wieder gegen seinen Nachbarn verbünden dürfte, dann setzte sich das Reich langsam aber sicher, so ganz allmählich als natürlicher Hegemon durch. Um so sicherer bin ich mir da, falls es uns gelänge, eine Dominanz über Österreich-Ungarn und das bald geschlagene ehemalige Zarenreich zu erlangen.”
„Und für solche Ziele hoffen sie sogar die Scheidemänner, die Eberts und Erzbergers dieser Welt gewinnen zu können?”
Oberst Bauers scharfe Frage erstaunt mich für einen Moment. Und doch muss ich anerkennend feststellen, dass es natürlich genau darum ging, als ich mich vor Monaten dafür entschied, mit den Demokraten in vertrauliche Konsultationen einzutreten.
„Meine Herren, die vier Herren, die sich seit etlichen Wochen als führende Vertreter ihrer jeweiligen Reichstagsfraktionen zu Gesprächen zusammen gefunden haben, verfolgen allesamt nuanciert unterschiedliche Interessen. Den einen, wie Herrn Scheidemann und auch Herrn Haußmann, ist der innere Friede am wichtigsten. Sie sind davon überzeugt, dass wir für die Zeit im Kriege und gerade auch danach diesem Ziel dann am besten dienen, falls es uns gelänge, jetzt schon das allgemeine Wahrecht in Preußen zu etablieren. Den anderen, wie Herrn Erzberger und mir, ist der äußere Friede zum mindesten ebenso bedeutsam. Doch ich verrate ihnen selbstverständlich nichts Neues, wenn ich ihnen sage, dass Herr Erzberger vornehmlich den Frieden als Selbstzweck anstrebt, während ich auf einen Frieden abziele, der Deutschland in der Welt von morgen auf jeden Fall sicherer macht, und auch ein wenig mächtiger als 1914.
Mit dem Streben nach Macht brauche ich den Herren Demokraten gar nicht zu kommen. Anders fällt die Nachdenklichkeit aus, wenn ich meine Position zum Mitteleuropäischen Zollverband erläutere. Denn der würde mehr Wohlstand schaffen für die Arbeiter. Dessen Grundkonstrukt könnte bei entsprechendem deutschen Einsatz dem Selbstbestimmungsrecht der Völker zu einer erheblichen Geltung verhelfen. Und er würde die Chance bieten, dass die Nationen Europas in Zukunft zur Partnerschaft fänden statt zur Gegnerschaft in immer neuen Bündniskonstellationen.”
„Das mit dem Selbstbestimmungsrecht meinen sie wohl nicht so recht ernst, lieber Stresemann. Ich möchte ihnen nicht kategorisch widersprechen. Doch ich beabsichtige sehr wohl, in einer fernen Zukunft einmal König von Preußen und Deutscher Kaiser zu sein, dann aber nach Möglichkeit auch noch König von Polen und Regent in Kurland, Livland und Estland. Ganz nebenbei, über Belgien haben wir da noch nicht gesprochen.”
„Kaiserliche Hoheit, sie wissen ohne Zweifel, ich bin ein unbedingter Verfechter der preußisch-deutschen Monarchie. Und ich wünsche mir selbst, dass Euer Hoheit als deutscher Kaiser einmal König von Polen sein werden. Denn wie sollten wir jemals eine verteidigungsfähige Grenze zu Russland erhalten, wenn nicht Polen in unseren Machtbereich aufgenommen würde?
Aber - und da bitte ich um eine vorurteilslose Betrachtung der folgenden Vergleichbarkeit: So wie der König von Preußen seinen Untertanen das gleiche Wahlrecht gewähren wird, so wird es der König von Polen ihm doch gleich tun können. Das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes beginnt zuallererst im Inneren. Und da hat die Monarchie der Hohenzollern den polnischen Bürgern und Adeligen unendlich mehr zu bieten als diejenige der Romanows in der Vergangenheit. Was die Selbstbestimmung nach außen anbelangt, ist das Königreich Polen seit dem letzten Jahr durch einen völkerrechtlichen Akt der Mittelmächte schließlich wieder erstanden. Auch das ist eine eklatante Verbesserung. Jetzt wird es noch darauf ankommen, die Nachkriegsgrenzen Polens und Deutschlands so abzustecken, dass sich die Polen nicht als die Verlierer des Krieges empfinden. Dazu gibt es aber Chancen.”
„Aha, und welche sind das? Gerade ich als Militär werde darauf bestehen müssen, dass unsere Ostgrenze unter strategischen Gesichtspunkte so einige Arrondierungen erfährt.”
Ludendorffs Einwand habe ich ganz sicher erwartet, zu bekannt ist seine Haltung, die er gleich beim Eintritt in die OHL im Vorjahr lauthals verkündete. Für diplomatisch klug hielt ich das schon damals nicht!
„Sehr verehrter Herr Generalquartiermeister, mir ist eines nicht verborgen geblieben. Sie und Generalmajor Hoffmann von der Ostfront haben eine solche Forderung erhoben. Auch die Konservativen mit ihrer lautstark vernehmbaren Junker-Fraktion unterstützen das natürlich aus gänzlich anderen, aus siedlungspolitischen Gründen. Hier gelangen wir indes an einen Punkt, der für die Grundfesten Europas, für die Philosophie der deutschen Außenpolitik in den Friedensverhandlungen alles entscheidend werden wird:
Eine neue Ordnung statt Land, aber das gegen einen echten, stabilen Frieden! Das ist mein Schlagwort. Dabei bitte ich sie, mich nicht misszuverstehen. Ich gedenke nicht, für Deutschland auf territoriale Erwerbungen zu verzichten. Doch sie sollen anders ausfallen als der Erwerb neuer Provinzen.”
„Haben sie das von Duisberg und Ballin oder auch von Rathenau?”
„Nein, nein, kaiserliche Hoheit. Ich tausche mich zwar des Öfteren mit allen drei von ihnen genannten Herren der deutschen Exportwirtschaft aus. Auf die eben von mir genannte Konklusion bin ich jedoch von selbst gekommen. Ich greife gerne die berechtigten Überlegungen von Herrn Generalleutnant Ludendorff auf: Das Heer verlangt nach strategisch sicheren Grenzen. Ob die Grenze zu Polen allerdings 50 Kilometer weiter westlich oder östlich verläuft, wird in dem Moment geradezu irrelevant, indem die Königreiche Polen und Preußen in Personalunion von der Dynastie der Hohenzollern regiert werden, indem Polen und Deutschland in einen Staatenbund unter deutscher Leitung eintreten, der eine gemeinsame Außenpolitik sicherstellt. Unser Grenzverlauf zu Polen hat dann gar keine strategische Bedeutung mehr, wenn Polen und Deutschland ein unauflösliches Militärbündnis eingehen, welches es dem deutschen Heere erlaubt, Garnisonen am Bug und in Galizien zu errichten, um von Osten her niemals wieder bedroht werden zu können.”
Es herrscht sekundenlanges Schweigen. Der Kronprinz greift zum eben servierten Kognak, schwenkt diesen im dickbauchigen Glas und sieht versonnen aus dem Fenster in eine unbestimmbare Ferne. Ludendorff scheint das Argument nicht zu gefallen, doch auch er schweigt. Oberst Bauer indes lässt die Körpersprache für sich selbst reden. Er lehnt sich entspannt zurück, spitzt den Mund zu einem zustimmenden Lächeln und blickt mich mit glänzenden Augen an. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, was ich gerade davon zu halten habe. Schließlich gilt Bauer nicht nur als der Vertraute des Generalquartiermeisters. Er ist zugleich sein Verbindungsmann in die Stahl- und Rüstungsindustrie an der Ruhr. Und deren führende Männer fordern ja bekanntlich lieber und lautstark Land. Denn als Alternative dazu lehnen sie, wie sie es abfällig nennen „diplomatische Kinkerlitzchen und handelspolitische Blütenträume allein” rundweg ab. Mir kommt ein etwas verwegener Gedanke, der nach sofortiger Verwirklichung verlangt:
„Verehrter Oberst Bauer, ihnen eilt der Ruf voraus, über glänzende Verbindungen in die höchsten Kreise der Ruhrkonzerne zu verfügen. Das ist ja schließlich auch dringend nötig, um die Ausstattung unserer Truppen mit dem besten Kriegsgerät zu gewährleisten. Erscheint es ihnen verantwortbar, mir einen Eindruck davon zu verschaffen, welche Positionen die dortigen Herren zur Kriegszielstrategie ihnen gegenüber vertreten. Womöglich ist das ja nicht dasselbe, ob sie mit der Nationalliberalen Reichstagsfraktion sprechen oder aber mit der Obersten Heeresleitung.”
„Ja wirklich, ein guter Gedanke, Bauer. Doktor Stresemann hat völlig recht. Das würde mich als Vertreter der Krone auch sehr interessieren, ob Hugenbergs und Stinnes Forderungen im vertrauten Kreise mit ihnen gar keine Grenzen mehr kennen.”
Oberst Bauer sieht seinen Chef Ludendorff fragend, aber auch ein wenig auffordernd an. Der zuckt die Schultern und hebt dabei mit der Geste der Hilflosigkeit beide Arme. „Wenn der zukünftige Kaiser sie auffordert. aus vertraulichen Unterredungen zu berichten, Bauer, dann ist das für einen deutschen Offizier ein Befehl!”
Der Oberst schmunzelt und nickt. Unangenehm scheint ihm das nun nicht gerade zu sein, aus Sicht der OHL gegenüber einem Fremden vertrauliche bis brisante Inhalte offen zu legen. Ich habe bisher immer gedacht, Oberst Bauer sei eigentlich ein Mann der Schwerindustrie. Doch womöglich ist er einzig und allein ein Mann des Militärs, der vor allem anderen gewinnen will. Und wenn er das vielleicht nicht vollständig kann, der dann zumindest einen so glänzenden Friedensschluss befördern möchte, dass niemand in Deutschland der dritten Obersten Heeresleitung jemals einen fundierten Vorwurf würde machen können, das Ergebnis des Krieges sei nicht mit einem vollständigen Sieg gleichzusetzen. Falls man also den Verzicht auf Maximalforderungen fürderhin werde so darstellen können, dass sie der langfristigen Eintracht der Nationen Europas dienten, so werde es ein leichtes sein zu betonen, dass jener Friede in der Zukunft selbstverständlich und hauptsächlich einer bestimmten Macht, nämlich jener Kraft ihrer Ressourcen natürlichen Vormacht des Kontinents zugute kommen müsse. -Zumindest hoffe ich, dass Bauer ein wenig so denkt und wertet wie ich selbst. Es dürfte für die kommenden Monate nur von Vorteil sein, einen solch exzellenten Netzwerker an der Seite Hindenburgs und Ludendorffs, und eben auch des Kronprinzen, zu den eigenen Vertrauten und am besten sogar Verbündeten zählen zu dürfen. - Und sofort rufe ich mich innerlich selbst zur Ordnung. Gegenüber einem so gewieften Taktiker wie dem Obristen bleibt für mich stets Vorsicht das oberste Gebot, keineswegs aber Anbiederung!
„Kaiserliche Hoheit, meine Herren, seit Investitur der dritten Heeresleitung ist es meine Aufgabe, in regelmäßigen Gesprächen mit den großen Stahlproduzenten und Metallverarbeitern des Reiches die Versorgung der Truppe mit Waffen und Munition sowie mit logistischem Gerät sicher zu stellen. Dabei reise ich mindestens einmal im Monat in das rheinisch-westfälische Industrierevier. Die Vorsitzenden der Vorstände der großen Aktiengesellschaften, ob Hugenberg, Thyssen, Vögler, Stinnes oder Reusch, sie alle suchen häufig die Gelegenheit, um sich mit mir auszutauschen. Man könnte meinen, sie hofften darauf, mich als ihr Sprachrohr bei den Herren Exzellenzen Hindenburg und Ludendorff einsetzen zu können. Weit gefehlt, schließlich bin ich doch vornehmlich das Sprachrohr der OHL gegenüber den Ruhrbaronen!”
Oberst Bauer lacht mit blitzenden Zähnen und hellwachen Augen kurz auf. Seine Aufgabe als wichtiger Kurier der militärischen Reichsleitung macht ihm offenkundig richtiggehend Freude. Somit darf ich davon ausgehen, dass er seinen Auftrag mehr als nur gewissenhaft, dass er ihn mit Hingabe erfüllt und dabei zugleich noch mit politischen Überzeugungen versieht. Ohne Zweifel, Bauer gehört zu jenen Strippenziehern hinter den Kulissen, die ganz vorne in der zweiten Reihe der Machtgeflechte des Deutschen Reiches stehen!
„Lassen sie mich kurz von meinem letzten Besuch in Essen, bei Herrn Hugenberg erzählen, zumal Herr Hugo Stinnes gegen Ende des Gespräches sogar vom Krupp-Chef noch hinzugezogen wurde.”
Bei Nennung dieser beiden Namen - neben Albert Vögler und August Thyssen unbestritten die maßgeblichen Sprecher der Ruhrindustrie - steigt mein Aufmerksamkeitspegel ungemein. Wie oft sind sie in den letzten drei Jahren bei Ernst Bassermann und mir aufmarschiert, um ihre Forderungen nach der Annexion Belgiens mitsamt der französischen Kanalküste, aber vor allem des lothringischen Erzbeckens von Longwy und Briey, das direkt an Deutsch-Lothringen grenzt, zu untermauern. Sicher, die Herren von der Ruhr wollen auch den Mitteleuropäischen Zollbund. Aber primär streben sie die Beherrschung ihrer europäischen Konkurrenten über die direkte Kontrolle der hochwertigen französischen Minette-Erze an. Nun denn, da habe ich dank der von Walther Rathenau beauftragten Recherchen noch einen Pfeil im Köcher. Walther hat nämlich ausgerechnet beim Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, vis-a-vis zur Villa von Hugo Stinnes am dortigen Auberg, eine Untersuchung durchführen lassen zur Eignung chilenischer und schwedischer Erze. Und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen.
„Also, ich besuchte die Krupp-Zentrale in Essen-Altendorf zu Gesprächen über die Lieferung von Geschützen. Generaldirektor Alfred Hugenberg empfing mich nach den Verhandlungen mit seiner zweiten Konzernebene dann entre nous zum Abendessen. Er war bester Stimmung und sehr vertraut im Umgang. Sehr bald kam unser Gespräch auf seine Auffassung, die dritte OHL packe endlich den Stier bei den Hörnern und sei zur Mobilisierung aller nationalen Kräfte bereit, um bald den Sieg zu erringen. Von der Industrie seien mit dem Hilfsdienstgesetz schwere Opfer verlangt worden. Doch er sehe ein, dass wir die Arbeiterschaft bei Laune halten müssten. Für die Bereitschaft der Industrie, über die Grenze des Zumutbaren hinaus zu gehen, was die Einschränkung des Direktionsrechtes im Betrieb betreffe, habe die deutsche Industrie für die direkten Regelungen des Friedensschlusses ein weitreichendes Entgegenkommen verdient. Er meinte damit die Sicherstellung der Dominanz der deutschen Eisenindustrie über diejenige Frankreichs, und damit letztlich über ganz Kontinentaleuropa. Schließlich sei das Eisen die Grundlage aller übrigen industriellen Leistungsfähigkeit. Jene Vorherrschaft der deutschen Schwerindustrie sei leicht zu erreichen, indem wir den Franzosen zwar ihre Kohle beließen, ihnen aber die wichtigsten Minette nähmen durch die Eingliederung der entsprechenden Teile Französisch-Lothringens in das Reich. Auch Lille wollte er gemeinsam mit Belgien in das Reich eingliedern. Jede Form der direkten Herrschaft, des Landerwerbs durch das Reich, sei indirekter wirtschaftlicher Einflussnahme vorzuziehen. Lediglich dann, wenn die besagten Regionen nun überhaupt nicht mehr grenznah seien, müsse der französische Staat dem deutschen Kapital durch den Friedensvertrag ein Investitionsprivileg einräumen. Höchstens Franzosen selbst dürften dem gleichgestellt werden, aber auf keinen Fall ausländische Kapitalgeber. Hier meinte er explizit die Erzgruben der Normandie.
Als sodann Herr Hugo Stinnes in unserer Zweierrunde erschien, wechselten die Herren das Thema und wollten von mir wissen, ob ihr Eindruck ein richtiger sei, zwischen der zweiköpfigen Führungsspitze der Heeresleitung und dem Herrn Reichskanzler tue sich ein wachsender Gegensatz auf. Sie bezweifelten, dass Bethmann-Hollweg überhaupt mit Überzeugung hinter dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg stehe, weil er Angst vor Amerika habe. Sie deuteten recht unverhohlen an, die Exzellenzen Hindenburg und Ludendorff in jeder nur denkbaren Art und Weise zu unterstützen, um die Mobilisierung der Kriegswirtschaft zu beschleunigen, offensive Operationen des Heeres durchzuführen und einen Wechsel in der Kanzlerschaft zu erzwingen.”
Es ist doch nicht wahr! Das denke ich. Diese Falken von der Ruhr geben sich immer blumigeren Illusionen hin, was die materielle Fähigkeit unseres Heeres zu Offensiven anbelangt. Und das angesichts der größeren Mannschaftsstärke unserer Gegner. Und das angesichts des Zurückbleibens unserer Industrieproduktion hinter dem Vorkriegsstand. Und dann auch noch angesichts der wachsenden sozialen Unruhe im Land, auf die der letzte Hungerwinter und die Revolution in Russland erheblich verschärfend wirken. Was sollte da erst werden, falls die Vereinigten Staaten wirksam in den Krieg eintreten wollten? Ich bin sauer auf Hugenberg und seine Bande. Diese Ignoranz, immer nur in einem Korridor zu denken, der zwei Leitplanken hat. Die eine heißt: Was nicht sein kann, das nicht sein darf. Die andere lautet: Sieg und vorwärts! Da wir ja zu Hause an der Ruhr mit der Arbeiterschaft auch keine Kompromisse schließen, braucht es das Reich in der Welt erst recht nicht! Meinen stillen Ärger unterbricht der Kronprinz mit einer sehr offenherzigen Aussage.
„Dass Hugenberg Bethmann loswerden will, dass pfeifen die Spatzen in Berlin ja seit Monaten von den Dächern. Aber was will er denn anders haben? Ich bin ja nun bekanntermaßen auch kein Freund des Reichskanzlers. Doch mein Herr Papa hält schließlich an ihm fest. Wenn ich etwas unternehmen wollte, dann würde ich mir Herrn Ludendorff bei der Hand nehmen und beim Kaiser vorsprechen. Schließlich kann nur er ihn entlassen. Und dennoch weiß ich nicht, ob Hugenberg den geraden Weg, unverhohlen seine Forderung vortragend, in den letzten Wochen gegangen wäre.”
„Ich ebenfalls nicht, kaiserliche Hoheit. Doch die Idee finde ich gut, dass wir beide um eine Audienz bei ihrem Herrn Vater nachsuchen und sagen: Bethmann ist gegen die totale Mobilisierung der deutschen Wirtschaft für den Krieg. Bethmann hat überhaupt keine Idee mehr, wie er den Krieg gewinnen und beenden will, weder politisch noch militärisch. Das Land versinkt allmählich in Trostlosigkeit, schlimmer als dass, in Lethargie und Trott. So kann man doch nicht alle Kräfte zusammen bündeln für das große Finale! Wenn ich Bethmann etwas Entscheidendes vorwerfe, dann ist es das: Er ist einfach nicht in der Lage dazu, dass ein Ruck durch Deutschland geht, vom Stahlarbeiter bis zum Junker. Ich meine einen kräftigen Ruck, der alle zusammenschweißt für die große letzte Anstrengung zum Sieg.”
„Sehr verehrter Herr Generalquartiermeister, ich bitte sie darum, nicht all zu leichtfertig den Parolen aus Essen zu folgen, die letzte große Offensive sei möglich und werde den Feind bis an die Pyrenäen treiben.”
„Aber, aber, mein lieber Doktor Stresemann, ich bin verantwortliches Mitglied der OHL. Ich will und ich muss an die Kraft der deutschen Waffen, an unsere Fähigkeit glauben, eine den Krieg zu unseren Gunsten entscheidende Offensive auszuführen. Das gebieten mir mein Amt und mein Ethos als deutscher Offizier. Sie wollen doch wohl nicht behaupten, das Reich könne sich nur noch verteidigen, es könne aber nicht mehr vorrücken.”
„Nein, nein, verehrter Herr Generalleutnant, ich meine das anders. Wir haben noch viele Chancen und Optionen. Nur schwindet unsere Kraft, im Westen den vollständigen Sieg zu erringen. Davon, ob wir hier in diesem Raum diese Beurteilung teilen, davon, ob wir uns das eingestehen, hängt so viel ab! Davon wird unsere Bereitschaft geprägt, unsere objektiven Sicherheitsbedürfnisse und Interessen mehr nüchtern zu analysieren und dann festzustellen: Das Reich kann auch dann die erste Macht Europas bleiben und an Gewicht gewinnen, wenn wir uns nicht vollumfänglich durchzusetzen vermögen sollten.”
„Das geht in Ordnung, lieber Stresemann. - Ich muss ein wenig auf die Uhr achten, meine Herren. Sie sind mir als Gäste lieb und teuer. Selten habe ich ein so anregendes und vielfältiges Gespräch geführt. Doch meine liebe Gattin wartet an diesem Abend noch auf mich, da ich endlich wieder einmal für mehrere Tage in Berlin weile. Private Pflichten, ein Dinné mit meinem Herrn Papa, sie verstehen. - Und doch, bevor wir auseinander gehen: Lieber Herr Doctor Stresemann, sie haben da eben etwas angedeutet. Wie sieht ihre Vorstellung von einem Frieden im Westen aus, der unsere Position in Europa und der Welt verbessert, ohne dass der Feind restlos geschlagen ist, ohne dass die Ziele von Herrn Hugenberg allesamt auf dem gedruckten Papier des Friedensvertrages stehen werden?”
Kronprinz Wilhelm hat recht. Im Westen wird der Krieg entschieden. Jetzt allemal, da die Russen im Zuge ihrer Revolution die Kampfmoral allmählich einbüßen und wir darauf spekulieren dürfen, mit ihnen einen Sonderfrieden zu schließen. Das kann schon dann eintreten, sobald die neue Regierung von der Sorge umgetrieben wird, die Front könnte zusammenbrechen und wir uns anschließend die Gebiete holen, die wir besetzen können. Vielleicht sogar die Ukraine einschließlich! Im Westen werden wir aber, davon bin ich seit dem letzten Hungerwinter und auch nach den nur marginalen Erfolgen der Produktionssteigerung durch das Hilfsdienstgesetz zutiefst überzeugt, den vollständigen Sieg nicht mehr erreichen. Auf dem Boden dieser Erkenntnis sollte unser Reich fortan Politik treiben. Wie wichtig wäre es, Wilhelm und Ludendorff für meine Position einstimmen, besser noch einnehmen zu können!
„Kaiserliche Hoheit, verehrter Herr Generalquartiermeister, Oberst Bauer, sie alle drei sind erfahrene und kompetente Militärs. Das bin ich nicht! Und doch muss ich mir als führendes Mitglied einer bedeutenden vaterländisch gesinnten Reichstagsfraktion meine Gedanken über den zukünftigen Kriegsverlauf im Westen machen. Bitte, hören sie mir zunächst einfach zu und wir erörtern anschließend, wo sie mir meine Sorgen nehmen können:
Zahlenmäßig sind uns Briten und Franzosen leicht überlegen. Was Disziplin und Kampfkraft betrifft, ist der deutsche Landser dagegen nicht zu schlagen. Doch fast drei Jahre Krieg haben uns eines gelehrt: Der moderne Krieg ist ein Abnutzungs- und Materialkrieg. Durch einen kühnen strategischen Erfolg lassen sich wenige Kilometer Gelände gewinnen, aber den Zusammenbruch des Gegners erreichen wir dadurch nicht. Warum aber ist dies so? Der moderne Massenkrieg kennt erstmals die geschlossene Front über hunderte von Kilometern. Da gelingt es nicht mehr, durch eine Entscheidungsschlacht die militärische Macht des Feindes vollständig zu schwächen. Und das technische oder strategische Instrument, die Front zu durchbrechen und anschließend regelrecht aufzurollen, das ist leider noch nicht erfunden.”
„Na, wer weiß? Ich möchte nicht ausschließen, dass die englischen Tanks so weit verbessert werden könnten, dass sie den Krieg revolutionieren würden.”
„Aber mein lieber Bauer, machen sie mir bloß keine Angst. Ich möchte die Zeit noch erleben, dass ich als Kaiser in einem glorreichen Frieden herrschen darf.”
Ludendorff und ich müssen lachen. - Ich werde mich etwa ein Jahr später an Oberst Bauers denkwürdige Worte erinnern und sie werden mich im Ringen um den Frieden einmal mehr zum Handeln bewegen. Doch zurück zur Frage des Kronprinzen. Wie steht es im Westen?
„Hinzu kommt, dass wir, um vom Kanal bis zu den Alpen anzugreifen, Millionen mehr an Soldaten bräuchten. Die Front ist heute schon etwa 900 Kilometer lang. Bei einem Durchbruch über die Marne und einem Vorstoß auf Paris würde sie sehr bald über 1.000 Kilometer lang. Vielleicht kämpfen auf der Seite der Entente bald auch noch Amerikaner mit. Auf jeden Fall ist die Rüstungswirtschaft des Gegners dazu fähig, mehr Geschütze und Flugzeuge herzustellen als unsere eigene. So kommt es, dass der Zivilist Stresemann, der große Stücke auf unsere Landser hält, für den Fall eines Friedens im Osten partielle Erfolge im Westen für möglich, die vollständige Niederwerfung der Feinde und die vollständige Besetzung Frankreichs aber für einen nicht mehr wahrscheinlichen Ausgang dieses fürchterlichen Ringens der Völker hält.“
Ich schweige und lasse das Ungeheuerliche meiner Worte im Raum stehen, auf meine Zuhörer wirken. Schließlich wären die Konsequenzen aus dieser Einsicht von fundamentaler Tragweite.
„Was aber, wenn wir im Westen unsere letzten großen Reserven ohne durchgreifenden Erfolg opfern? Wie kommen wir dann noch aus diesem Kriege heraus?
Meine Herren, aller spätestens hier kommt der Zivilist Stresemann wieder ins Spiel. Denn meine doch recht maßgebliche Reichstagsfraktion wird die erste sein, von der die zivile Reichsleitung und Seine Majestät, der Kaiser, einen regelrechten Spagat erwarten dürfen. Es wird darum gehen, Kriegsziele mit zu formulieren, die das kleine Wunder vollbrächten, sowohl dem Feind nicht unzumutbar für Verhandlungen zu erscheinen als auch unserem eigenen Volk nicht zu enttäuschend nach langen Jahren eines unvorstellbar entbehrungsreichen Krieges. Wollen sie nun meine Ideen hören?”
„Viel lieber würde ich ihnen ja zuerst einmal vehement und im Brustton tiefster Überzeugung widersprechen. Am liebsten würde ich selbstverständlich ein Szenario aufbauen, das uns zugleich Paris einnehmen als auch in einem weiten Bogen nach Südost die östliche Front von Verdun bis zu den Alpen umfassen ließe. Allein meine Zuversicht genügen dafür, lieber Doktor Stresemann. Jedoch mein kühler Verstand lässt mich immer wieder rätseln, wie angesichts der tatsächlichen Kräfteverhältnisse die Strategie für einen solchen Erfolg wohl aussehen möge. Und dennoch: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Falle eines Obsiegens in Russland gegenüber unserem Vaterland die heilige Pflicht als Heeresleitung erfüllen und den Angriff wagen müssen.”
Ludendorffs Worte überraschen mich in einem wichtigen Punkt: Eingedenk der so oft durchaus diplomatischen Winkelzüge in den Äußerungen des Generalquartiermeisters gibt er heute beinahe schonungslos offen zu erkennen, welche Zweifel ihm daran gekommen sind, wie der Sieg der deutschen Waffen gegen eine Welt starker Feinde auf den Schlachtfeldern Frankreichs wohl errungen werden möge.
„Ihre Pflichterfüllung ehrt sie vor dem Kaiser und der öffentlichen Meinung, Exzellenz Ludendorff. Vor der Geschichte indes meine ich, müsse die oberste Verantwortung zum Erhalt der Zukunft unseres Volkes im Vordergrund stehen. Und besagte Zukunft sehe ich am besten gewahrt, falls Deutschland auch ohne die Pyrenäen zu erreichen einen glanzvollen Frieden zu verhandeln im Stande sein sollte. Dafür aber bedarf es eines Zielkataloges, der von den Plänen der Herren Hugenberg und Stinnes abweichen darf.
Wir sollten auf Annexionen am Kanal oder von Lille gänzlich verzichten.
Wir sollten für Belgien eine Lösung finden, die das Land in den mitteleuropäischen Zollbund bringt und seine Außenpolitik unter die Führung des Reiches. Staatliche Selbstständigkeit wird ihm wohl erhalten bleiben müssen.
Wir sollten schließlich unsere territorialen Forderungen an Frankreich auf das Nötigste beschränken. Und das ist für mich das Erzbecken von Longwy / Briey. Zu erreichen sein dürfte selbst dies nur unter günstigsten Bedingungen: einem militärischen Erfolg und zugleich einem politischen Entgegenkommen gegenüber Frankreich in anderen Fragen. Da fallen mir vor allem zwei ein: maßvolle Forderungen in kolonialen Angelegenheiten sowie die weitgehende Anwendung des Selbstbestimmungsrechts der Völker bei der Gestaltung der deutschen Westgrenze.”
„Aber das kann doch nicht sein, lieber Stresemann. Dann wäre Metz verloren!“
Dieser Ausruf des Kronprinzen verlangt mir eine überzeugende Antwort, gleichsam eine kongeniale politisch-diplomatische Lösung ab. Die jedoch habe ich bis heute noch nicht gefunden. Lediglich grobe Züge schweben mir vor.
„Was halten sie denn davon, wir gäben Frankreich eine Hand voll Dörfer im Oberelsass vor der burgundischen Pforte zurück, die tatsächlich französischsprachig sind? Im Gegenzug handeln wir uns große Vorteile ein. Ich meine, wir müssen unseren Teil von Lothringen behalten und das Erzbecken hinzugewinnen. Aber auf dieser Grundlage könnten wir den Franzosen vieles anbieten: die Meistbegünstigung im Handel, vollen Zugang für französisches Kapital in Deutsch-Lothringen und meinetwegen sogar auch noch im Elsass, und ja, darüber grübele ich derweil: Vielleicht sogar die regionale Selbstverwaltung der französischsprachigen Gemeinden in Deutsch-Lothringen.”
„Nein!”
Das ruft Ludendorff voller Entrüstung aus.
„Exzellenz Ludendorff, ich sage doch, mein Vorschlag könnte einen Ausweg weisen. Er würde sogar den Briten und Amerikanern den Wind aus den Segeln nehmen, die inständig das Selbstbestimmungsrecht der Völker einfordern. Warum sollten wir ihnen nicht den Köder hinhalten und für Lothringen das bieten, das wir auch für Polen beabsichtigen: eine fast vollständige innere Autonomie, allerdings im wirtschaftlichen und staatlichen - für Polen auch im dynastischen - Bunde mit uns?”
Es waren eben diese, meine letzten Worte, die wie ein Sakrileg, und dennoch zugleich wie ein Fels in der Brandung, wie ein machtvoller Appell an eine vaterländische Realpolitik im Raume widerhallten. Widerspruchslos im Raume stehen blieben sie an jenem spät gewordenen Nachmittag im Berliner Stadtschloss allerdings nicht. Mit meiner Variation zu einem Frieden im Westen hatte ich eine Grenze überschritten, die der Generalquartiermeister nicht bereit war in Frage zu stellen.
„Sehr verehrter Doktor Stresemann, ich hege erhebliche Zweifel, ob ihre kühnen Pläne für unsere Kriegsziele im Westen von den maßgeblichen Herren ihrer Partei gestützt werden. Ob wohl Herr Bassermann bereit ist, deutsche Dörfer im Elsass aufzugeben? Ob wohl die Herren Hugenberg und Stinnes, Thyssen, Vögler und Reusch - so wie ich vernehme bedeutende Financiers ihrer Wahlkampagnen - daran interessiert sein mögen, ihre Erzminen zukünftig in einer Region zu betreiben, die unter der Selbstverwaltung der dortigen französischsprachigen Bevölkerung steht? Ich kann hier und heute nur für die OHL sprechen. Und ich erkläre hier im Beisein seiner kaiserlichen Hoheit: Die dritte Oberste Heeresleitung wird keinem Frieden zustimmen, in dem Territorium, das heute der uneingeschränkten Souveränität der zivilen Reichsleitung unterliegt, entweder abgetreten oder dem unkontrollierten Einfluss welfscher Separatisten überlassen bliebe. Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg und meine Wenigkeit werden kämpfen, solange es nötig ist, um einen solchen Frieden zu verhüten!”
Zum ersten Mal an diesem sehr diskussionsfreudigen und lang gewordenen Nachmittag zieht eine, ja ich möchte sagen ein wenig eisige Stimmung in unsere Runde ein. Offenbar ist die alte militärische Elite noch nicht so weit wie ich. Offenbar bedeutet die Metapher vom Verhandlungsfrieden, wenn sie dem Munde des Generalquartiermeisters entweicht, mehr eine Beruhigungspille für die demokratischen Reichstagsfraktionen als dass sie eine gewisse Flexibilität in den Anschauungen, als dass sie Wendigkeit beim Erzielen von Kompromissen einschließen würde. Ich bin ernüchtert, sogar etwas enttäuscht, weil die letzten zwei Stunden in mir die Hoffnung auf größere Gemeinsamkeiten geweckt hatten. Erwidern möchte ich eigentlich nichts. Ich möchte keine Gefahr laufen, die Stimmung weiter zu belasten. Und dennoch, Ludendorff hat mir widersprochen. Ergo ist es an mir, zu antworten.
„Sehr geehrter Herr Generalquartiermeister, ich schätze ihren unermüdlichen Einsatz für die Wehrhaftigkeit unseres Reiches in diesen schweren Zeiten. Ich habe großes Verständnis dafür, dass ein Mann, der solche enorme Verantwortung für eine der größten Nationen der Erde trägt, mit äußerster Wachsamkeit jeder Gefahr begegnet, hier könnten die Interessen des Vaterlandes zu Markte getragen werden. Ich stelle an diesem Punkte fest, dass wir beide keine völlige Übereinstimmung unserer Haltungen zu den möglichen Erfordernissen eines Friedensschlusses erzielen. Ich stelle aber zugleich mit größter Freude fest, in wie vielen unumstößlich bedeutsamen Fragen der Zukunft wir in den zurückliegenden Stunden gemeinsame Anschauungen austauschen konnten. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir unsere Unterredung zur Frage Frankreichs einmal fortsetzen dürften, nachdem die eben geäußerten Gedankengänge sich bei jedem von uns haben setzen können.”
Der Kronprinz blickte ein weiteres Mal sorgenvoll auf die Uhr, erinnerte an seine bereits wartende Gemahlin und an das in nur gut einer Stunde terminierte Dinné mit dem Kaiser. Auf mich wirkte es sogar befreiend, nicht weiter argumentieren zu brauchen. Ludendorff, Bauer und ich erhoben sich unverzüglich. Wilhelm verabschiedete uns nun endgültig. Wir verließen das Stadtschloss nach einer tiefen Verbeugung vor dem Mann, der in ferner Zukunft nach diesem Kriege wohl unser kaiserlicher Herr werden sollte. Uns vieren war klar, dass dies nicht das letzte Gespräch in diesem Kreise bleiben würde. Doch keines der nachfolgenden Gespräche, die bis in das Frühjahr 1918 folgen sollten, erreichte die Tiefe und Breite des ersten. Kein weiteres Gespräch lockte meine Partner von der Obersten Heeresleitung zumindest zeitweise so weit weg von ihren gewohnten Wegen, Zielen und sogar von ihren Partnern im Bündnis von Junkertum und Industriebaronen.