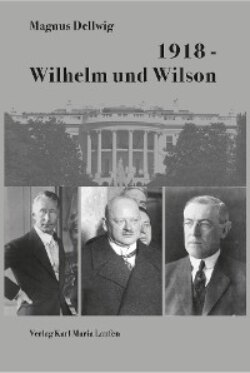Читать книгу 1918 - Wilhelm und Wilson - Magnus Dellwig - Страница 12
6 Wilsons Amerika
ОглавлениеAls am 15. Dezember 1917 der Waffenstillstand zwischen dem seit wenigen Wochen bolschewistisch regierten Russland und den Mittelmächten in Kraft trat, sah US-Präsident Woodrow Wilson seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Anders als manche seiner Berater und die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs in Washington, die davon überzeugt waren, Russland zur Fortsetzung des Krieges gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn bewegen zu können, befürchtete er jetzt die baldige Verlegung umfangreicher Kontingente deutscher Truppen von der Ost- an die Westfront. Zur gleichen Zeit aber befand sich das amerikanische Korps in Frankreich erst noch im Aufbau. Woodrow Wilson sann bis Weihnachten darüber nach, welche Möglichkeiten insbesondere die Vereinigten Staaten haben würden, den Bolschewiki hinreichend starke Anreize zur Wiederaufnahme des Kampfes zu bieten. Ihm ging es darum, nach Möglichkeit die Verlegung von einer bis zwei Millionen deutscher Soldaten, kampferprobt, gut organisiert und bestens geführt, in 60 bis 100 Divisionen nach Westen gänzlich zu verhindern. Mindestens aber sollte diese Kräfteverschiebung so lange hinaus gezögert werden, bis die USA selbst eine Million Soldaten oder mehr in Frankreich in die Kämpfe eingreifen lassen konnten. Das würde nach Einschätzung von Oberst House, Wilsons wichtigstem persönlichen Berater in sämtlichen Angelegenheiten des europäischen Krieges, im Sommer, wohl erst im Juli 1918 erreicht sein. Am zweiten Weihnachtstag zog sich der Präsident von einer Feier mit seiner Familie, zu der einige Geschwister nach Washington gereist waren, am frühen Abend mit der Begründung zurück, er sei nach dem reichlichen und guten Festtagsessen ein wenig unpässlich. In Wahrheit suchte Wilson umgehend sein Arbeitszimmer, das Oval Office im Weißen Haus auf. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, löschte das Licht und verharrte für eine gute Viertelstunde im Dunkeln, den schweren Kopf in die großen Hände gestützt. Seine Gedanken kreisten um die europäische Ostfront. Noch am 23. Dezember hatte er seinen Außenminister Robert Lansing zu einem ausführlichen Gespräch gebeten, ihm bohrende Fragen nach der Stabilität der Verhältnisse in Russland und nach den Eigeninteressen beim offenkundig zur Schau gestellten Zweckoptimismus der Entente-Mächte gestellt. Ihren Prophezeiungen von der Fortsetzung des Krieges in Russland schenkte er persönlich zunehmend weniger Glauben. Auch der Secretary of State Lansing traute den Briten und Franzosen in dieser Angelegenheit keinen Zentimeter über den Weg. Stattdessen meinte er, London und Paris wollten Amerika nur beruhigen. Die US-Botschaft in Petrograd hingegen meldete fortwährend, den Bolschewiki entgleite die soeben erst gewonnene Macht wieder aus den Händen. Menschewiki und Sozialrevolutionäre verfügten strukturell über eine Mehrheit in der Bevölkerung der beiden Hauptstädte. Deswegen sei es wohl realistisch, dass die Bolschewiki den Deutschen gegenüber auf Zeit spielten. Das erlaube ihnen, die in der Sache unakzeptablen Forderungen der deutschen Militaristen, Russland möge auf ausnahmslos alle nicht von Russen besiedelten Gebiete im europäischen Teil des vormaligen Zarenreiches verzichten, immerhin vorübergehend zu verunglimpfen und ins Leere laufen zu lassen. Schließlich müsste die Anerkennung der vollständigen militärischen Niederlage Lenins Gegner erneut stärken. Kerenski könnte sofort kontern, die Bolschewiki betrieben einen unverantwortlichen Ausverkauf nationaler Interessen und Territorien. Werde es indes ernst und die Deutschen setzten als äußerstes Druckmittel ihren Vormarsch auf Petrograd fort, würden Lenins Unterhändler Frieden schließen, um ihre eigene Haut und die Chance auf den Machterhalt im Inneren zu retten. Als Robert Lansing das Weiße Haus verließ, äußerte er noch die Einschätzung, es könne im Westen dann richtig gefährlich werden, falls die Deutschen schon zu Ostern in die Lage versetzt würden, eine starke Offensive über die Somme gegen Paris oder die Marne zu führen.
Ich muss eine neue Friedensinitiative starten. Die muss attraktive Angebote für die kleinen, unterdrückten Völker Europas enthalten. Sie muss zudem den Russen - und zwar egal, wer dort in Zukunft regiert - die Aussicht darauf eröffnen, dass nicht die Deutschen über ganz Mitteleuropa bis zu ihrer Westgrenze herrschen werden, sondern eine Mehrzahl selbstbestimmter Völker entstehen. Briten und Franzosen könnten da nichts gegen haben, denn sie wären ohnehin nicht in der Lage, östlich des Deutschen Reiches auf Dauer direkten Einfluss auszuüben.
Dann fragte sich der amerikanische Präsident, was eine solche Friedensinitiative denn wohl den Deutschen zu bieten vermöge. Woodrow Wilson atmete in seinem in Dunkelheit gehüllten Büro tief durch. Lediglich vom Kerzenschein des Tannenbaumes auf dem Rasen drang diffuses Licht hinein. Sogleich stieg wie des Öfteren in ihm eine Antipathie gegen dieses kaiserliche Deutschland auf. Für Wilson vereinte dieses Land in der Mitte Europas zu viele Widersprüche in sich. Gemeinsam mit den USA war das Reich die größte und modernste Wirtschaftsmacht der Erde. In den Zukunftsindustrien Chemie und Elektro liefen die Deutschen allen anderen sogar den Rang ab. Wäre das nicht so gewesen im Jahr 1914, hätten sie auch nicht vermocht auf Stickstoffbasis kurz nach Kriegsbeginn Sprengstoff herzustellen. Damit konnten sie ihren sicheren Untergang abwenden. Im Gegensatz zu dieser Fortschrittlichkeit aber sperrten sich die alten preußischen Eliten gegen die Demokratisierung. Kaiser, Junker, Militärs, Stahlindustrielle waren so rückwärtsgewandt wie in keinem anderen großen Land Europas, außer Russland. Und dort hatte ja gerade die Revolution gesiegt! Ob das im Deutschen Kaiserreich wohl auch möglich wäre?
Woodrow Wilson beschloss, eine Friedensinitiative zu ergreifen, die für die Demokraten in Deutschland annehmbar sein würde. Er empfand eine stille Freude daran, den Keil der Spaltung in die deutsche Gesellschaft zu treiben, von welcher Kaiser Wilhelm seit 1914 tönte, sie stehe auf dem Boden des Burgfriedens fest zur Monarchie. Dieser verfluchte militaristische Kaiser! Seine persönlichen Überzeugungen wurden gepaart mit dem unglaublich großen Einfluss der erzreaktionären Obersten Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff, die wiederum den maßlosen Kriegszielen der Zechen- und Stahlbarone nach Annexionen in Frankreich und der Eingliederung Belgiens ins Reich vollständig folgten.
Ich muss, ich will auf die inneren Verhältnisse in Deutschland achten! Sonst würde meine Friedensinitiative nichts weiter als eine PR-Nummer! Sie stachelte die Öffentlichkeit bei uns zu Hause, noch mehr in England und Frankreich erneut auf, weil die Deutschen sie ablehnen und sich wiederholt als friedensunwillig zeigen würden. Eine solche Aktion für die Öffentlichkeit hätte aber keine Chance das zu erreichen, was ich eigentlich anstrebe: Amerika sollte eine echte Chance suchen, den Ausstieg der Russen aus dem Krieg und anschließend eine große, gefährliche Offensive der Deutschen in Frankreich zu verhindern! Das wiederum erfordere zwei Dinge: In Russland muss Lenin besser heute als morgen von einer Regierung der nationalen Einheit abgesetzt werden! Und zweitens muss der Kaiser einige wichtige meiner Vorschläge für verhandelbar halten!
Woodrow Wilson atmete erneut tief durch, nahm den Kopf aus den aufgestützten Armen und lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück. Er schmunzelte und blickte versonnen aus dem Fenster in den parkartigen Garten des Weißen Hauses. Zwar hatte er bis jetzt noch kein Wort zu Papier gebracht, dennoch war er mit sich fürs Erste zufrieden. Denn seine Bestandsaufnahme über die Lage, in der sich die Krieg führenden Mächte befanden, half ihm, aus einer gesicherten Klärung seiner großen, übergeordneten Ziele heraus jetzt frisch ans Werk zu gehen. Zwei Aufgaben stellte er sich. Nach Weihnachten und unbedingt vor Silvester wollte der Präsident nacheinander mit seinen vielleicht wichtigsten Beratern in dieser Angelegenheit konferieren. Das war einmal Oberst Edward House, den Wilson nicht nur als Experten für alles Militärische, sondern auch für die Wirkungen der Außenpolitik in der amerikanischen Öffentlichkeit schätzte. Und da war zum zweiten der oberste Bundesrichter Louis Brandeis, der als einer der herausragenden Kenner der Weltwirtschaft und gerade auch der wirtschaftlichen Potenziale der europäischen Mächte galt. Mit seiner Hilfe hoffte Wilson eine Einschätzung darüber zu gewinnen, welche Aussichten die Westmächte hatten, 1918 weiter durchzuhalten, und welche Chancen die Deutschen tatsächlich hätten, nach dem hoffentlich eher unwahrscheinlichen Frieden mit Russland die entscheidende Offensive im Westen zum Erfolg zu führen. Doch halt, Wilson fiel plötzlich ein dritter Name ein: Der junge Journalist Walther Lippmann, in New York Herausgeber der Zeitschrift „The New Republic“ dürfe wohl wie kein zweiter die Stimmungslagen in der amerikanischen Bevölkerung, insbesondere die des dicht besiedelten Nordostens, am treffsichersten einschätzen. Ihn einzubinden konnte ebenfalls den Horizont erweitern, das Urteil differenzierter ausfallen lassen und ihm mehr Sicherheit für seine Entscheidungen geben.
Und dann war da die zweite Aufgabe: Woodrow Wilson nahm sich vor, niemanden zu beauftragen, einen Entwurf für seine Friedensinitiative zu erstellen. Nein, hier ist der Chef gefragt! Denn nur der Chef hat die klaren Prioritäten im Kopf, was erreicht werden soll und erreicht werden könnte. Es muss ja nicht ein Roman werden!
Wilson stellte sich vor, nur ein Dutzend zentrale Forderungen, Standpunkte, Zukunftsperspektiven für die Ordnung in Europa zu formulieren. Ein Dutzend ist eine gute, einprägsame Zahl. Nach den zehn Geboten sind es dann vielleicht die zwölf Punkte von Wilson, die hoffentlich einmal Weltgeschichte schreiben werden. Für einen kurzen Moment sonnte sich der Präsident in dem angenehmen Gedanken, derjenige zu sein, der diese unbefriedigende, unerträgliche gegenseitige Blockade der Krieg führenden Mächte aufzuheben vermöge. Sofort darauf schämte sich Woodrow Wilson für diesen Anflug von unverkennbar narzistischer Eitelkeit. Er zwang sich zur Nüchternheit. Nicht ins Schwärmen kommen, alter Junge! Das sagte er zu sich selbst und beschloss, sich noch an diesem Abend die ersten knappen Notizen für sein 12-Punkte-Programm zu machen. Es war 22.30 Uhr, da war noch eine produktive Phase möglich. Der Präsident betätigte den Lichtschalter seiner Schreibtischleuchte, griff optimistisch gestimmt zum Block und zu seinem Füllfederhalter in der obersten Schublade des massiven Eichenschreibtisches. Die ersten Stichworte, die er notierte, lauteten: Selbstbestimmungsrecht der Völker, unabhängiges Polen, unabhängiges Belgien, Elsass-Lothringen zurück an Frankreich. Sodann legte er seine Stirn in Falten und notierte weiter: Demokratisch gewählte Regierungen in ganz Europa? Zollunion? Deutschland verliert Kolonien? Oder muss es umgekehrt gerade welche hinzu bekommen? Österreich-Ungarn auflösen? Machtverhältnisse in Polen, im Baltikum anerkennen? Woodrow Wilson wusste mit einem Mal, wie schwierig sein Unterfangen werde, einen Friedensplan aufzustellen. Er grübelte noch eine Weile, machte lediglich einige weitere, knappe und belanglose Aufzeichnungen und beschloss daraufhin, die Arbeit am Schreibtisch für diesen Abend zu beenden. Sollten doch die Gespräche mit House und Brandeis und vielleicht noch Lippmann mehr Licht ins Dunkel bringen. Er löschte das Licht wieder und verließ das Oval Office.
Unruhe überfällt mich. Die Gedanken an meine Begegnungen mit dem amerikanischen Präsidenten im Jahr 1918 rufen in mir die Erinnerung an seinen festen Charakter, seine moralische Stärke, vor allem aber auch seine unverbrüchliche Autorität gegenüber seinen amerikanischen Landsleuten und schließlich auch gegenüber seinen europäischen Verbündeten wach.
Ich öffne meine Augen nur um die Breite feiner Schlitze. Die Schwester hat soeben mein Kopfkissen aufgeschüttelt, mich neu gebettet. Matratze und Bettzeug meines Krankenhausbettes fühlen sich weich und frisch an und sie duften angenehm nach einem Hauch von Waschmittel. Die Schwester hat nicht bemerkt, dass ich erwacht bin. Mit einem fürsorglichen Lächeln blickt sie ein Mal nach mir, bevor sie das Zimmer verlässt, darum bemüht, die Türe möglichst geräuscharm ins Schloss fallen zu lassen. Ich schließe die Lieder. Sofort formt sich vor meinem inneren Auge das große, längliche Gesicht Woodrow Wilsons, auf dessen Züge sich stets ein verschmitztes Lächeln legte, wenn sein heller Geist einen neuen, bestechenden Gedanken entwickelte. Mein Geist ist plötzlich in einem vertrauensvollen Vier-Augen-Gespräch, das wir beide im frühen Herbst 1918 im Weißen Haus in Washington führten, und in dem er mir mit erählerischer Hingabe davon berichtete, wie seine Idee vom 14-Punkte-Programm aus der Taufe gehoben wurde. - Noch sind wir dabei im Jahr 1917.
Am 30. Dezember sitzt Präsident Wilson um 11 Uhr in seinem Arbeitszimmer und bearbeitet gemeinsam mit seiner Sekretärin und dem Leiter des Präsidentenbüros im Weißen Haus die Post. Woodrow Wilson hat sich über die Weihnachtstage gut erholt, so dass die Flut der noch vor den Feiertagen liegen gebliebenen Briefe seine Stimmung gar nicht zu trüben vermag. Es klingelt das Telefon und seine Sekretärin nimmt ab. Eine Mitarbeiterin des Präsidentenbüros meldet Außenminister Lansing, der in der Leitung warte und gerne den Präsidenten gesprochen habe. Wilson ist nicht sehr überrascht und nimmt das Gespräch an, nachdem er seinen beiden Mitarbeitern bedeutet hat, das Büro bitte kurzzeitig zu verlassen. Robert Lansing ruft aus Boston an, wo er für die Tage zwischen den Jahren verweilt. Nach der Höflichkeitsfrage nach den Familienaktivitäten über Weihnachten fragt er an, ob bei der vom Präsidenten gestern kurzfristig für den 3. Januar anberaumten Kabinettssitzung etwas Besonderes anstehe. „Lieber Woodrow, du hast dir doch bestimmt etwas ausgedacht über die besinnlichen Tage, warum du uns schon vor Heilige Drei Könige nach Washington zurück holst?“
„Natürlich, Bobby. Und ebenso natürlich geht es um den Krieg. Deshalb bist du für mich auch der wichtigste Mann am 3. Januar. Vielleicht erinnerst du dich noch an unser letztes Treffen vor Weihnachten. Ich dachte laut darüber nach, ob es nicht Zeit sei für eine amerikanische Friedensinitiative, weil doch die Deutschen mit den Russen am 15. Dezember einen Waffenstillstand ausgehandelt hatten.“
„Sicher erinnere ich mich. Die Briten sagen uns bei jeder Gelegenheit: Alles nicht so schlimm. Die Russen scheiden nicht aus! Die Bolschewiki sind bald abserviert und dann werden die Menschewiki die Front wieder stabilisieren und weiter kämpfen, weil die Deutschen sonst bald in Petrograd stehen. Lieber Woodrow, mir stellen sich bei diesem Getöse immer die Nackenhaare auf! Optimismus ist gut und schön, reiner Zweckoptimismus ruft dagegen meine Aversion hervor. Was passiert denn, wenn sich Lenin noch hält und dann genau anders herum vorgeht: Frieden schließen, damit es ihm gelingt, im Rest Russlands, das ihm nach allen direkten oder auch verdeckten Annexionen der Kaiserlichen aus Berlin noch bleibt, die Macht zu behaupten?“
„Guter Gedanke, Bobby. Ich saß über Weihnachten am Schreibtisch und grübelte. Da kam mir dieser Gedanke ebenfalls. Ich fand ihn beunruhigend. Ich will verhindern, dass die Deutschen uns im Frühjahr angreifen werden, mit kampfstarken Truppen, die sie im Osten abgezogen haben.“
„Dann musst du ihnen ein Angebot machen, dass sich substanziell von dem rhetorischen Pallawer der letzten Monate seit unserem Kriegseintritt unterscheidet! Es sollte so ausgewogen sein, dass die Deutschen ernsthaft darüber nachdenken, auf der Basis zu verhandeln und unsere Verbündeten gleichzeitig keinen Vorwand geliefert bekommen, ihrerseits das Angebot abzulehnen.“
„Ein wenig einfacher gesagt als getan, Bobby.“
„Ach was, lieber Woodrow, lass nur keine Mutlosigkeit aufkommen. Das ist doch wahrlich nicht deine Art! Du hast seit 1916 schon so viele Anläufe unternommen, dass wir auf das Bewährte in abgewandelter Form zurückgreifen können.“
„Aha, was meinst du?“
„Ich würde versuchen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker neu zu fassen, nicht mehr mit dem Slogan unterfüttert: Demokratie gegen Autokratie. Sondern du könntest erwähnen, dass es viele von der politischen Kultur jedes Landes geprägte Wege gibt, sein jeweils ganz eigenes Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen und dabei gleichzeitig die innere Stabilität zu bewahren. Tu doch so, als seiest du über die Ereignisse in Russland behutsamer in der Beurteilung des zugleich Wünschenswerten und Erreichbaren geworden: Besser schrittweise mehr Selbstbestimmung als schubweise Chaos und Revolution in halb Europa. Damit meine ich in ganz Europa zwischen Deutschland und Russland.“
Der Präsident lacht in den Hörer. Er bedankt sich aber daraufhin aufrichtig für den Ratschlag seines Außenministers und beendet das Gespräch äußerst nachdenklich. Wie passen Bobbys Einschätzungen zusammen mit den Aussagen von Walter Lippmann? Gestern hatte er mit dem Journalisten lange telefoniert, da eine Reise von Lippmann nach Washington kurzfristig nicht einzurichten war. Lippmann ist für den Präsidenten und seine Chefberater Oberst House sowie Louis Brandeins ein begehrter Experte, wenn es um die Beurteilung der Briten geht. Schließlich unterhält Lippmann hervorragende Kontakte zur Londoner Presse und darüber hinaus zu Zahlreichen der Londoner Banken und Reedereien, die am Finanzplatz New York vertreten sind. Warum ist Lippmann für Wilson in diesen Tagen so wichtig? Weil Woodrow Wilson in seinen Gedanken seit dem zweiten Weihnachtstag immer eindringlicher zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er den Frieden nur dann erreichen kann, falls es ihm gelingt, mit seinen Vorschlägen die Briten und die Deutschen in ihren bisherigen Vorstellungen von den unabdingbaren Kriegszielen zu erschüttern. Beziehungsweise geht es doch darum, so ist sich der Präsident seit dem Gespräch mit Lippmann sicher, den beiden größten Mächten der europäischen Kriegskonstellation zu zeigen, dass sie einen gehörigen Teil ihrer Ziele, nämlich die Sicherstellung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft, mit Amerikas Initiative und Hilfe erreichen könnten. Der Präsident weiß sicher, Frankreich ist derart ausgelaugt, dass es sich nicht gegen England wird stellen können! Dasselbe gilt für Österreich-Ungarn in seiner Abhängigkeit vom weit stärkeren Deutschen Reich.
Woodrow Wilson geht bis an die Türe seines Arbeitszimmers, öffnet diese und ruft seiner Sekretärin in knappen Worten zu, die Post müsse jetzt wohl doch bis nach dem Mittag warten. Er benötige jetzt nach dem Telefonat mit dem Außenminister ein wenig Ruhe, um seine Gedanken zu sammeln. Bis 14 Uhr sei er für niemanden zu sprechen. Mit einem freundlichen Lächeln, das zugleich keinen Widerspruch duldet, schließt der Präsident sofort darauf die Türe. Er wendet sich seinem Schreibtisch zu, bleibt aber mitten im Oval Office stehen, atmet tief ein und aus. Von diesem Schreibtisch soll eine Initiative ausgehen, die nicht dasselbe Schicksal erleidet wie die vielen Bemühungen zuvor. Ob der Friedensappell des Papstes, die Friedensresolution des Deutschen Reichstags oder sein eigener Aufruf zu einem Frieden ohne Sieger vom Januar 1917, allen diesen Ansätzen für einen Verhandlungsfrieden mangelt es daran, dass wesentliche Interessengruppen in einem oder gleich mehreren maßgeblichen Ländern eine Diskussion rundweg ablehnten. Wilson erkennt: Nur ein ausgewogenes Paket wird beide Seiten zur ernsthaften Abwägung motivieren. Zugleich werden die Thesen so weich formuliert, ja so diplomatisch, um nicht zu sagen mehrdeutig sein müssen, um in Verhandlungen noch echte Spielräume für beide Seiten zuzulassen. - Der Präsident schreitet in langsamen, gemessenen Schritten zum Schreibtisch und setzt sich. Er blickt dann aus dem Fenster. Ganz leise sinkt schwacher Schneefall vor seinem Fenster auf den Rasen im Garten hernieder. Wilson holt seine Notizen vom 26. Dezember aus der Schreibtischschublade hervor, drapiert daneben weiße Blätter und legt seinen Füllfederhalter dazu. Wieder atmet er tief ein und aus, denkt nochmals nach.
Und was wird sein, wenn die Russen nicht weiter kämpfen? Ich glaube zwar nicht daran, denn Lippmann hat mir ebenfalls beteuert, wie gut die Quellen des britischen Geheimdienstes seien und dass diese einhellig meldeten, Lenin werde die Macht bei den nächsten Wahlen sofort wieder verlieren. Aber nehmen wir einfach mal den unwahrscheinlichen Fall, dass es den Deutschen gelänge, die Russen zum Friedensschluss zu zwingen und anschließend 100 Divisionen nach Frankreich zu verlegen. Dann wären sie vielleicht wirklich in der Lage durchzubrechen, trotz unserer amerikanischen Verstärkungen. Also muss ich eine Initiative starten, die in einer solchen hochgradigen Notlage mir selbst zu einem nicht all zu fernen Zeitpunkt eine neue Chance eröffnete, vor der deutschen Großoffensive - oder auch selbst noch danach - weitere Friedensschritte einzuleiten. Das müsste dann diplomatisch möglich sein, ohne dabei völlig unglaubwürdig zu werden durch eine Kehrtwende, eine Abkehr von meinen eigenen 12 bis maximal 14 Punkten!
Der Präsident grübelt. Gemeinsame Interessen von Großbritannien und Deutschland, und am besten natürlich auch noch Amerika, könnten den feien Welthandel betreffen und zusätzlich einen maßvollen Ausgleich der kolonialen Interessen. Louis ist doch der beste Kenner der weltwirtschaftlichen Verflechtungen in meinem Beraterstab, der soll mir jetzt helfen! Wilson teilt seiner Sekretärin durch das Telefon mit, er wünsche für den 2. Januar ein Gespräch mit Mister Louis Brandeis. Dieser solle hierher ins Weiße Haus kommen. Wilson zögert einen kurzen Moment und fügt gleich an, sie solle möglichst im Anschluss daran Oberst House einbestellen. Der Präsident lehnt sich in seinem Schreibtischsessel selbstzufrieden zurück. Er ist davon überzeugt, jetzt alles Nötige und ihm Menschenmögliche unternommen zu haben, um einen fundierten Textentwurf für seine Friedensinitiative bis zum 3. Januar vorbereiten zu können.
In dieser zuversichtlichen Stimmung greift der Präsident endlich zum Füllfederhalter und notiert in knappen Formulierungen:
„Freier Welthandel,
Freie Weltmeere,
Selbstbestimmung für Polen,
Vollständige Wiederherstellung der belgischen Souveränität (verlangt GB),
Wiedergutmachung des Frankreich angetanen Unrechts mit Elsass-Lothringen (verlangt Frankreich, ist aber weich genug, um in Verhandlungen den Deutschen als Äußerstes eine Volksabstimmung zuzugestehen),
Ungehinderte Entwicklungsmöglichkeiten für Russland - Räumung besetzter russischer Gebiete (Spielraum dazu, was nach Bildung neuer Staaten überhaupt noch Russland ist),
Ethnisch gerechte Grenzen zwischen Italien und Österreich,
bestmögliches Selbstbestimmungsrecht für die Völker der Donaumonarchie,
Unabhängigkeit für das türkische Volk, aber Trennung der arabischen Völker vom Osmanischen Reich,
Bildung eines weltweiten Bundes der Nationen zum Ausgleich ihrer Interessen,
Großes Fragezeichen: Europäische Zollunion??? (verlangt Deutschland, fürchtet Frankreich, begrenzt vielleicht unseren Einfluss und den der Briten auf dem Kontinent!)“
Woodrow Wilson legt den Füllfederhalter aus der Hand. Dann zählt er die Anzahl seiner Notizen durch und stellt fest, dass er acht bis neun grundlegende Punkte notiert hat. Nun gut, das sind zwar noch kein volles Dutzend, aber es ist ein guter Anfang. Wilson spürt zum ersten Mal seit Weihnachten, dass es möglich sein kann, eine Friedensinitiative zu starten, die seinen eigenen Kriterien, seinen Ansprüchen an sich selbst gerecht wird, nämlich flexibel zu sein und den wichtigen Nationen in Europa ein Eingehen auf Verhandlungen zu erlauben, ohne dass sie im Inneren sogleich als Verlierer dieses mörderischen Völkerringens bezeichnet werden können. Der Präsident denkt wieder einmal an die preußischen Junker, an die Militärs um Ludendorff und Hindenburg und um diesen Imperialisten Admiral Tirpitz mit seinem Flottenverein und den Alldeutschen im Rücken. Er weiß, dass diese Leute keinen Frieden nach seinen Vorstellungen wollen. Umso wichtiger wird es sein, ihnen und ihren Ebenbildern in Frankreichs Armeeführung das Argument aus der Hand zu schlagen, ihr Land werde zum Verlierer erklärt. Doch ebenso wichtig wird es sein, dass in England, Frankreich und Deutschland die friedenswilligen und verständigen Kräfte die Chance erkennen mögen, die von seinem Dutzend an Friedenspunkten ausgehen könnte.
Für heute fühlt sich Wilson ausgelaugt. Seine kreativen Anstrengungen für den Frieden haben ihn ermüdet. Er schraubt den Füllfederhalter genüsslich zu, geht zum Fenster und öffnet es. Leises Vogelzwitschern dringt in das Oval Office. Die Geräusche beruhigen und entspannen den Präsidenten. Er setzt sich in seinen Schreibtischsessel, schließt die Augen und lehnt sich zurück. Für heute soll lediglich noch ein wenig Post kommen, doch die ist so völlig belanglos im Vergleich zu den zwei Seiten handschriftlicher Notizen, die inzwischen wieder in der Schublade seines Schreibtisches verschwunden sind.
Der Jahreswechsel in der amerikanischen Hauptstadt findet etwas zurückhaltender, mit weniger ausladendem Feuerwerk statt als üblich. Es ist schließlich Amerikas erstes Jahr als Krieg führende Macht in Europa. An Silvester empfangen der Präsident und seine Frau im Weißen Haus Repräsentanten von Wohlfahrtsorganisationen. Dieses Mal sind die meisten mit Sammlungen vertreten, um die Familien von Kriegsteilnehmern zu unterstützen. Die im November auf mehrere Tausende angeschwollenen Gefallenenlisten drücken auf die Stimmung. Deshalb bemüht sich Woodrow Wilson in seiner kurzen Ansprache zum neuen Jahr, an der zwei Dutzend hochrangige Journalisten aus dem gesamten Land teilnehmen, welche Zuversicht er in das kommende Jahr lege. Mein Gott! Denkt er. Wie unglaublich wichtig wird 1918 für mich, für die ganze Welt werden! - Weiter wird er sagen: Die wachsende Kriegsmüdigkeit in Russland, Frankreich und Deutschland erhöhe die Aussichten auf einen Friedensschluss. Er selbst bereite dazu einen neuen, fundierten Vorschlag vor. Trotz zahlreicher Nachfragen nach den Inhalten wehrt der Präsident konsequent ab und lässt nur das heraus, was er sich zuvor vorgenommen hat. Zwei Stichworte gehen über seine Lippen: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und ein freier Welthandel werden für die zukünftige Weltordnung unverrückbare Grundlagen sein müssen. Dann beendet Wilson diesen letzten öffentlichen seiner Auftritte des Jahres 1917 und freut sich auf die Silvesterfeier mit seiner Frau, der Familie seiner Schwester und einem Freund von der juristischen Fakultät der Universität von Princeton, an der er vor seiner politischen Karriere als Professor für Politik tätig war, bevor die Hochschule ihn 1902 sogar zu ihrem Präsidenten ernannte.
Oberst Edward Mandell House betritt um 9.30 Uhr des 2. Januar 1918 das Weiße Haus, um sich im Oval Office mit dem Präsidenten zu treffen. Seinen Ehrentitel Oberst, den ihm in Texas die Miliz verliehen hat, trägt er mit Stolz. Das gilt umso mehr, seitdem sich die Welt im Krieg befindet und der Titel seine militärische Kompetenz zu verbürgen scheint. Tatsächlich empfindet Edward House eine große Nähe zu allem Militärischen, wohl auch deshalb, weil ihm seine Lebenserfahrung Disziplin und Gehorsam als unverzichtbare Voraussetzungen zur Bewältigung von Notlagen wie zum Beispiel bei Einsätzen der Nationalgarde und der Milizen bei Naturkatastrophen eingeprägt hat. Die Militärs selbst dagegen erscheinen dem äußerst selbstbewussten Spross aus traditionsreichem texanischen Hause meist arrogant und herrisch. Und das gilt für ihn eigentlich über alle nationalen Unterschiede hinweg. Was Präsident Wilson an House am meisten schätzt, ist sein profundes Wissen in Politik, Geschichte und allen Angelegenheiten der Außenpolitik. Somit verwundert es Edward House wenig, dass der Präsident ihn heute, am Tag vor der ersten Kabinettssitzung des Jahres, sprechen möchte. Noch am 23. Dezember hatten beide telefoniert und Wilson erwähnte erst nur beiläufig seinen Austausch mit Lansing. House fasste sogleich nach und erfuhr, dass der Präsident eine Friedensinitiative vorbereitete. Das gefiel House sofort, weil er selbst vielleicht als einziger in Washington den Waffenstillstand zwischen Russland und Deutschland vom 15. Dezember als schlechtes Omen wertete. Der Zweckoptimismus der Briten war ihm beinahe widerlich suspekt. Natürlich hoffte auch er, dass die Menschewiki bald wieder die Macht in Moskau und Petrograd übernähmen und dann weiter kämpften. Aber für ebenso wahrscheinlich hielt er, dass Lenin sprichwörtlich lieber seine Großmutter an die deutsche Oberste Heeresleitung verkaufte, als in Russland auf die Macht zu verzichten. Deshalb hatte House dem Präsidenten am Tag vor Weihnachten beigepflichtet, jetzt sei der absolut richtige Zeitpunkt für Amerika den Frieden zu suchen. Bisher hätten die US-Boys nur unerheblich in die Kämpfe eingegriffen. Noch sei Amerika keine tief in den Krieg verstrickte Partei. Da sei es psychologisch günstig, heute oder zumindest sehr schnell, ohne weitere Belastungen im ohnehin schon schwierigen Verhältnis zum kaiserlichen Deutschland, nach vorne zu gehen.
Woodrow Wilson empfängt Oberst House schon vor seinem Arbeitszimmer und bittet ihn in gelöster Stimmung herein. Er sagt ihm ohne Umschweife, schon um 11 Uhr Louis Brandeis dazu gebeten zu haben, um sich mit seinen wichtigsten Ratgebern in internationalen Angelegenheiten – und damit in Sachen des Weltfriedens – zu besprechen. Der Präsident bittet House, in der kleinen Sitzgruppe gegenüber dem Schreibtisch Platz zu nehmen. Er fährt fort. Über Weihnachten sei in ihm der von House, Lansing und anderen angestoßene Entschluss gereift, im Januar eine Friedensinitiative zu starten. Und es gelte keine Zeit zu verlieren. Deshalb solle bereits morgen ein Entwurf in die Kabinettssitzung eingebracht werden. Edward House hatte dieses Tempo nicht erwartet und prustet erst einmal aus. Auf Woodrow Wilsons Gesicht legt sich ein breites Grinsen.
„Aber anders als du es sonst meist von mir gewohnt bist, sollen Louis und du nicht die ganze Arbeit machen. Lieber Eddy, du wirst es kaum glauben, aber ich habe wirklich schon einen ersten Entwurf angefertigt. Er liegt gut behütet in meinem Schreibtisch. Bis heute hat ihn nicht einmal meine Sekretärin zum Tippen zu sehen bekommen. Also wirst du dich mit meiner Klaue zufrieden geben müssen.“
Oberst House schmunzelt gönnerhaft und winkt genüsslich ab.
„Das ist nun wahrlich eine gute Nachricht, Woody. Ich muss also nicht die ganze Arbeit alleine machen. Das ist mir doch wohl deine grässliche Handschrift wert!“
„Wir sollten es heute schaffen zu dritt die Eckpunkte festzuhalten. Ich stelle mir vor, dass wir ein Dutzend markanter Punkte für meine Friedensinitiative zusammenstellen. Was die diplomatische Ausformulierung betrifft, setze ich dann schon auf dich, lieber Eddy. Den letzten Feinschliff sollen dann Bobbies Leute im State Department morgen anbringen. Aber für das Kabinett brauchen wir schon eine auch taktisch kluge Grundlage. Schließlich möchte ich, dass jede der wichtigen Mächte etwas für sich dabei herauslesen kann, um Verhandlungen zuzustimmen.“
Der Präsident erhebt sich aus seinem Sessel und holt seine Aufzeichnungen der zurückliegenden Tage aus der Schreibtischschublade. Er bringt für sich seine Schreibunterlage mitsamt dem Füllfederhalter mit, für Oberst House einen Notizblock und einen Bleistift. Er legt die Schreibutensilien auf dem Coachtisch der Sitzgruppe ab. Dann schlendert er zur Türe und wünscht bei seiner Sekretärin für seinen Gast und sich eine Kanne Tee. Die wird kurz darauf ins Oval Office hinein getragen. Gestört werden möchte Wilson fortan nur noch beim Eintreffen von Mister Brandeis. Nachdem der Präsident ein wenig am noch brühend heißen Tee geschlürft hat, greift er zu seinen Notizen und stellt Oberst House die bisher schon zusammengetragenen Stichworte vor. Edward House erklärt seine Skepsis gegenüber dem letzten Punkt mit dem großen Fragezeichen: Sollen die Mächte der Entente auf Deutschlands Kriegsziel des Mitteleuropäischen Zollvereins eingehen? Es dürfte die Ablehnung der Franzosen hervorrufen und auch die Briten hätten einiges zu verlieren, nämlich ihren mit den Deutschen gleichberechtigten Zugang zu allen kontinentaleuropäischen Märkten. Wilson und House sind sich sogleich einig, dass sie diese Frage mit dem Wirtschaftsexperten und obersten Bundesrichter Brandeis besprechen werden, sobald dieser in knapp einer Stunde eintreffen wird. Anschließend konzentrieren sie sich auf die Regelung über Russland, das angesichts der aktuellen militärischen Lage und ebenso des ungeklärten Ausgangs der Revolution sicher eine Schlüsselstellung für die Akzeptanz der Friedensinitiative zukommen wird.
„Wir sollten alles dafür unternehmen, dass in Russland die Demokratie siegt. Denn die Alternativen bestünden in einer Marionettenregierung der Deutschen oder aber in einem Revolutionsregime, dass es einfach nicht schaffen würde, die Ordnung wieder herzustellen.“
„Dein Kreuzzug für die Demokratie in allen Ehren, lieber Woody. Und selbstverständlich hätte auch ich in Petrograd am liebsten die Sozialrevolutionäre unter Fürst Kerenski an der Macht, die dann korrekte Wahlen durchführen ließen. Doch in Wahrheit habe ich eine andere Sorge: Wenn es schlecht läuft in Russland, dann bekommen wir eine Revolutionsregierung unter Lenin und Kamenew, die zugleich außenpolitisch eine Marionettenregierung des deutschen Kaisers wird. Das wäre der Worst Case! Lass uns deshalb einen Vorschlag unterbreiten, der heute für Lenin ebenso akzeptabel ist wie für Kerenski. Ich meine einen Vorschlag, der sogar von der deutschen Regierung nicht so einfach zurückgewiesen werden kann.“
„Vom Ziel sind wir da ganz nah beieinander, Eddy, aber was du da verlangst, ist doch wohl die Quadratur des Kreises! Ich bin auf deinen Formulierungsvorschlag gespannt.“
„Ich meine, wir sollten Russland das Recht einräumen, seine innere Entwicklung selbst zu bestimmen. Das heißt dann implizit ohne Einmischung der Deutschen und ohne Einmischung der Entente. Und darüber hinaus benötigen wir eine Regelung für die äußeren Angelegenheiten, sprich auch für die russischen Grenzen.“
„Damit bin ich sofort einverstanden. Polen wird unabhängig. Die deutschen Truppen räumen das von ihnen besetzte russische Gebiet. So weit sind unsere Vorstellungen bestimmt deckungsgleich. Aber was haben die Deutschen dann davon, mein Freund Eddy? Du denkst doch gerade bestimmt daran, warum Hindenburg und Ludendorff sich darauf einlassen sollten.“
„Stimmt genau. Deine Wortwahl gefällt mir schon recht gut, Woody. Vielleicht liegt der Schlüssel in dem Begriff Russisches Gebiet. Wenn wir es kritisch betrachten, dann drängen nicht nur die Polen nach Unabhängigkeit, sondern noch viel mehr Völker, die unter der Knute der Zaren standen. Da sind die Finnen, die Balten, und die Deutschen drängen auch die Ukrainer, vielleicht sogar Georgien in die Freiheit. Das geht mir persönlich zwar viel zu weit, aber was Finnland und das Baltikum betrifft, ist eine Einigung mit den Deutschen vielleicht möglich, sofern wir diese Länder dem deutschen Einflussbereich zuordnen.“
„Ich sage da nur: Das Selbstbestimmungsrecht werde ich nicht auf dem Altar der Machtpolitik opfern, lieber Eddy.“
„Das musst du auch überhaupt nicht. Entweder wir fordern volle innere und äußere Autonomie. Dann aber kämpfen die Deutschen weiter. Oder wir konzentrieren uns auf die innere Freiheit der Völker. Dann halte ich vieles für möglich.“
„Auf eines werde ich mich niemals einlassen, Eddy: Dass der Kaiser in Berlin über Europa herrscht und zwar von Belgien bis Polen und von Finnland bis in die Ukraine. Träte das ein, hätte die Demokratie den Krieg verloren und es bliebe in Europa nur noch eine wahre Weltmacht übrig.“
Ja das stimmt, aber vielleicht auch wieder nicht ganz. So muss die innere Stimme von Edward House sich in diesem Moment regen, wenngleich seine gesprochenen Worte elaborierter ausfallen, in Rücksichtnahme auf seinen Gesprächspartner.
„Sei nicht so kategorisch, Woody. Ich finde, dass du selbst den Schlüssel dafür entdeckt hast, wie eine sanfte deutsche Hegemonie und der Weltfrieden zusammenpassen können. Vor Weihnachten hast du mir gesagt, du möchtest einen Bund der Völker oder Nationen gründen, in dem alle Staaten Mitglieder sind, in dem es keine Vorrechte für die Großmächte gibt, in dem die Völker Streitigkeiten vor ein internationales Tribunal bringen können. Wenn wir nach dem Krieg wirklich einen solchen Völkerbund bekämen und in ihm Polen und das Baltikum Mitglieder würden, könnten wir eine sanfte Form der deutschen Vormacht doch wohl akzeptieren. Oder hast du etwa vor, die Realpolitik über Bord zu werfen?“
Oberst House lakonisch vorgetragene und durchaus rhetorisch gemeinte Frage gefällt dem Präsidenten gar nicht. So sehr er seinen außenpolitischen Berater schätzt, so missfällt es ihm, zuweilen einen Anflug von Überheblichkeit heraus zu hören, wenn es um den Idealismus in Wilsons Friedenspolitik geht. Allerdings verabscheut Woodrow Wilson die althergebrachte europäische Kabinettspolitik so von Grund auf, dass er keinen Verhandlungsfrieden schließen möchte, der nicht zugleich eine Weiterentwicklung des Völkerrechts bedeutet. In dieser Absicht stimmen House und Wilson nicht nur überein, sondern deshalb haben Edward House und der Präsident bereits im letzten Herbst die Formel vom Selbstbestimmungsrecht der europäischen Völker ersonnen. Dass Eddy ihn heute versucht mit einem gehörigen Schuss Realismus zu bremsen, ruft in Woodrow Wilson gemischte Gefühle hervor. Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Ein Mal verlangt die Moral ihr Recht und er möchte den kleinen Völkern volle Autonomie geben. Ein anderes Mal klopft der Verstand an und sagt dem Präsidenten in aller Nüchternheit, dass angesichts der dramatisch angewachsenen Machtpositionen des Deutschen Reiches in Osteuropa nur ein Kompromiss diesen fürchterlichen Krieg beenden kann. Oberst House ist für ihn der Mahner, dessen Realismus er sehr schätzt. Offenbar braucht er Edward House nötiger als ihm manches Mal lieb ist, um gedanklich die Insel der glückseligen Politik zu verlassen, die Amerika im Vergleich zu Europa tatsächlich sein dürfte. Der Präsident nimmt sich vor, in der bald beginnenden gemeinsamen Unterredung mit House und Brandeis seine Emotionen zu bändigen. Dieses Ziel vor Augen ist es Woodrow Wilson wichtig mit House noch kurz Österreich-Ungarn anzusprechen, weil das nun tatsächlich kein Thema für Louis Brandeis sein dürfte. Edward House hat auch dazu eine sehr dezidierte Meinung.
„Nehmen wir doch wieder das Selbstbestimmungsrecht, lieber Woody. Die Völker der Donaumonarchie sind eigentlich zu klein, um jedes für sich einen lebensfähigen eigenen Staat zu gründen. Mir persönlich war die Idee des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand sehr sympathisch, aus seinem Land einen Staatenbund zu entwickeln. Er sprach sogar einmal von den Vereinigten Staaten von Österreich-Ungarn. Das hört sich für uns Amerikaner doch wahrlich gut an! Wir verlangen innere Selbstbestimmung für die Völker der Monarchie. Die kann sich dann auf Außenpolitik, das Heer und die Wirtschaft beschränken. Außerdem schlage ich vor, dass wir für die übrigen Balkanvölker, die Serben und die Rumänen Unabhängigkeit fordern. Sonst landen sie ohnehin unter dem deutschen Schirm, wenn es weiter östlich eine funktionierende Großmacht Russland nicht mehr geben sollte.“
„Du hast Recht, Eddy. Der Balkan fehlte noch auf meiner Liste, um das Dutzend der Friedenspunkte voll zu bekommen.“
Es klopft an der Türe und Wilsons Sekretärin führt Mister Brandeis in das Oval Office herein. Der Präsident freut sich seinen Freund und Berater nach den Feiertagen wiederzusehen. Louis Brandeis hat die letzten zwei Wochen in New York verbracht und kehrt voller Eindrücke aus Treffen und Feiern mit seiner Familie und alten Freunden in die Hauptstadt zurück. Zuvor feierte er in New York Silvester. Das war eine willkommene Gelegenheit, den britischen Generalkonsul zu treffen. Da New York die Drehscheibe für den Handel der USA in das kriegsgeplagte Vereinigte Königreich darstellte, schossen nirgends in Amerika die Gerüchte über die Lage in der alten Welt so ins Kraut wie dort. Vor dem Kriegseintritt der USA am 6. April 1917 hatten sich hier die Hiobsbotschaften gehäuft, dass der vom Deutschen Reich wieder aufgenommene uneingeschränkte U-Boot-Krieg die britische Wirtschaft nicht mehr nur schwer schädigen, sondern sie vielleicht tatsächlich in die Knie zwingen könnte. Brandeis hatte seinem Präsidenten im Februar 1917 von den Sorgen um die Briten berichtet. Bei ihnen beiden war die Überzeugung gewachsen, dass Frankreich ohne England sogleich zusammenbrechen werde. Für Woodrow Wilson gab diese Lageeinschätzung im März den letzten Ausschlag für den Kriegseintritt. Seitdem hielt er das Deutsche Reich endgültig für viel zu gefährlich, um ihm das Schicksal Europas ohne amerikanische Gegenwehr überlassen zu dürfen und zu wollen.
Nun aber, nach dem Jahreswechsel berichtet Brandeis aus New York, die britische Eisen- und Stahlindustrie greife wieder auf eine zufriedenstellende Erzversorgung zurück, viele weitere Rohstoffe stünden ebenso wieder ausreichend zur Verfügung und vor allem habe sich die Lebensmittelversorgung durch Importe weiter verbessert. Das alles reiche indes gerade einmal aus, um gemeinsam mit amerikanischen Lieferungen und unseren Truppenentsendungen den spürbaren Abfall der französischen Rüstungsproduktion zu kompensieren. Er mache sich ernste Sorgen, falls die Bolschewiki tatsächlich auf die Idee verfallen sollten, bald aus dem Krieg auszusteigen.
„Solche Überlegungen habe ich über Weihnachten auch angestellt, Louis. Ich bin zwar überzeugt davon, dass die Russen weiterkämpfen werden, doch am Ende sollten wir auf alles vorbereitet sein. Genau deshalb bin ich entschlossen eine neue Friedensinitiative zu starten.“
„Über die Russen hat mir der britische Generalkonsul in New York Lord Melroy auch erzählt. Er war bemerkenswert ehrlich. Seine Regierung, in dieser wiederum Außenminister Lord Balfour besonders vehement, vertrete die Auffassung, ihr Einfluss selbst auf Lenin sei groß genug, um einen Sonderfrieden zu verhindern. Melroy persönlich dagegen befürchtet, das sei vor allem Zweckoptimismus. Britische Kaufleute aus Russland berichteten, die Verhältnisse stürzten seit der Machtübernahme der Bolschewiki ins Chaos. Nichts sei mehr auszuschließen.“
Oberst House nutzt diese Bemerkung, um in das Gespräch einzusteigen.
„Deshalb, Louis, wollen wir einen Punkte-Plan, dem Russen und sogar Deutsche zustimmen können. Das gelingt uns aber nur, indem beide Seiten seine Auslegungsspielräume jeweils für sich erkennen und in Verhandlungen zu nutzen versuchen.“
„Da bin ich sofort bei euch. Sagt mir bitte zuerst, ob ihr schon erste Eckpunkte zusammen getragen habt. Dann will ich versuchen mir vorzustellen, ob auch London und Paris deinen Friedensplan unterstützen würden, Woody.“
Der Präsident überlässt es Edward House, alle bisher schon aufgelisteten Punkte in eine Ordnung zu bringen und ihrem neuen Gesprächspartner gründlich vorzustellen. Louis Brandeis lehnt dann die Aufnahme von Wilsons letztem Gedanken, dem europäischen Zollverein, kategorisch ab.
„Nicht dass ich den Frieden daran scheitern lassen würde, lieber Woody. Aber warum sollen wir so leichtfertig sein, das wichtigste Kriegsziel der modernen deutschen Wirtschaftselite um Leute wie Ballin oder Stresemann ihnen gleich kampflos vor die Füße zu legen wie eine reife Frucht? England wird davon seinen Ausschluss von wichtigen Märkten befürchten. Frankreich wird davon seine Unterordnung unter die deutsche Wirtschaftshegemonie erwarten. Also wollen beide diese sogenannte Mitteleuropäische Zollunion unbedingt verhindern. Und wenn wir uns darauf am Ende sogar einlassen sollten, dann bitte schön erst nach beinharten Verhandlungen, die unseren Verbündeten belegen, dass Amerika auf ihrer Seite steht! Falls wir der Zollunion also doch schweren Herzens zustimmen, dann müssen wir unser Prinzip der Open door für Britannien und die Vereinigten Staaten auf dem alten Kontinent durchsetzen. Alles andere müsste unwiderruflich die Macht des Reiches als europäische Weltmacht zementieren!“
„Überzeugt, Louis. Womöglich habe ich nur deshalb so viel Sympathie für diesen deutschen Plan, weil er für Europa so viel Gutes bewirken könnte, falls freie Märkte in allen Nationen Europas geschaffen würden. Es ist genau diese Idee von der Open door, die in China und selbst in Lateinamerika bereits ihre heilsame Wirkung entfaltet hat, bei der ich mich frage, ob sie nicht auch für Europa gelingen kann. Aber jetzt fürs Erste Schluss damit! Du musst uns jetzt bei zwei, drei anderen Fragen helfen. Denn wie wollen wir die Briten mit positiven Zielen gewinnen? Das weißt du vielleicht besser als jeder andere in den Staaten.“
„Der dickste Köder, den ihr Lloyd George und Churchill hinhalten könnt, ist die Erbmasse des Osmanischen Reiches. Zum einen konkurrieren die Briten mit den Deutschen um den Einfluss im Zweistromland. Zum anderen gelänge ihnen durch ein Stück vom Kuchen der arabischen Beute die geopolitische Stabilisierung ihres Empire auf hervorragende Weise: Durch eine Machtbasis zwischen Ägypten und Indien würden die Briten zur Vormacht des Nahen Ostens und lösten die Türken dort ab. Es gibt keine zweite Weltregion, auf die London so sein Auge geworfen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir britischen Protektoraten in Arabien zustimmen, sofern das innere Selbstbestimmungsrecht der dortigen arabischen Völkerschaften nicht mit Füßen getreten wird - und selbstverständlich auch dort die Politik der freien Märkte mit der Open door gelte. Die Türken müssten sich dann auf ihre ethnische Basis in Kleinasien zurückziehen.“
„Das nehmen wir auf, Louis“, ruft Edward House voller Begeisterung aus.
„Die Politik der freien Märkte möchte ich indes auch in Woodys Dutzend-Punkte-Plan haben. Davon würden nämlich gleich mehrere wichtige Nationen profitieren: Wir natürlich, die Briten als Handelsmacht und dann selbstverständlich auch die Deutschen als Industrienation. So könnte der freie Welthandel mit geregelten Zugängen auch in die kolonialen Räume der Europäer für alle anderen, die weniger zu beherrschen haben als Briten und Franzosen, akzeptabel werden. Übrigens bin ich der Auffassung, dass koloniale Entschädigungen für die Deutschen der probate und der einzige Weg sein dürften, auf irgend einen Quadratmeter ihres Reiches zu verzichten. Sollten sie am Ende nach Volksabstimmungen auf Teile Elsass-Lothringens oder vielleicht sogar auch Posens verzichten müssen, dann geht das im Guten nur mit Hilfe einiger gehöriger kolonialer Kompensationen. Und Clemenceau wird sich darauf womöglich gar nicht so schweren Herzens einlassen.“
Nachdem Edward House gesprochen hat, ist es Brandeis ein Bedürfnis, die schon vor vielen Wochen vom Präsidenten genannte Idee eines Bundes der Völker und Nationen zu durchleuchten. Schließlich sind Amerikas Verbündete in diesem Krieg die größten Kolonialmächte der Erde. Sie werden es nicht hinnehmen, die Verfügungsgewalt über ihre ausgreifenden Territorien internationaler Kontrolle zu unterwerfen. Etwas anderes wäre es natürlich, falls es Woody gelänge, einen Völkerbund durchzusetzen, der den Krieg ächtete und die Großmächte dazu brächte, auf Krieg zu verzichten - oder zumindest so lange, bis ein internationales Schiedsgericht zu Konflikten zwischen den Staaten einen Vermittlungsvorschlag unterbreitet hätte. Als der oberste Bundesrichter Louis Brandeis voller Eifer seine Überlegungen über völkerrechtliche Ambitionen zum Besten gibt, ist der Präsident wie gefangen. Edward House spürt gleich wieder dieses enorme Herzblut, dass Woodrow Wilson in sein Konzept vom Bund der Nationen hineinlegt. So kommt es, dass die drei Herren in eine tief schürfende Betrachtung jenes Bundes eintreten, Edward House und selbst der Präsident sich dabei die eine oder andere Randbemerkung notieren und die zuweilen hitzige Diskussion selbst vom Lunch, den die Küche des Weißen Hauses in einem benachbarten Salon serviert, nicht unterbrochen, geschweige denn abgewürgt wird.
Recht beiläufig, während die Vorspeise serviert wird, erwähnt Louis Brandeis eine bemerkenswerte Begebenheit während seines Weihnachtsaufenthaltes bei Verwandten in New York. Der britische Generalkonsul in New York, Lord Melroy, habe berichtet, vor Weihnachten von Graf von Bernstorff besucht worden zu sein. Edward House merkt auf, denn er weiß: Bis zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Deutschen Reich am 3. Februar 1917 war Bernstorff Botschafter in Washington. Dann wurde er selbstverständlich ins Reich zurückgerufen. Was ist der Grund für seine Amerikareise gewesen? Danach fragt er sogleich Brandeis.
„Nein, so richtig hat von Bernstorff die Katze nicht aus dem Sack gelassen. Allerdings versuchte er auch erst gar nicht den Anschein einer rein privaten Reise zu erwecken. Besuche bei alten Freunden, Kollegen anderer Botschaften und eben auch Geschäftspartnern aus New York nannte er als erstes. Dann aber sagte er sinngemäß Folgendes: Die militärische wie die zivile Reichsleitung habe zur Zeit ein gesteigertes Interesse daran, mehr über Amerikas Kriegsvorbereitungen für das Jahr 1918 zu erfahren. Und noch wichtiger sei es für manche Herren in Berlin zu wissen, ob der Präsident wohl wie 1916 oder 1917 noch vor dem Kriegseintritt wieder für eine Friedensoffensive gut sei.
„Ich hakte bei Melroy nach und fragte, welche Herren Bernstorff wohl gemeint habe. Der Generalkonsul schwieg zunächst. Das lag vielleicht daran, dass er meine Erwartung in der von ihm verursachten Stille genoss. Endlich bemerkte er ohne die geringste Intonation in seiner Stimme: Für die Regierung Seiner Majestät, des Königs von England und des Kaisers von Indien, ist es ebenso interessant wie für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn, oder besser dass es zumindest einige maßgebliche Herren in Berlin gibt, die nicht allein auf den Zusammenbruch der Russen spekulieren und anschließend alles auf eine große Offensive im Westen setzen. Mister Brandeis, stellen sie sich nur vor, die Deutschen verlegen im kommenden Jahr 70 Divisionen, mehr als eine Million Mann von Russland nach Frankreich und greifen uns dort an. Wer weiß, wie das ausgeht? Britannien wird durchaus kriegsmüde. Da könnte ich mir einen Verhandlungsfrieden besser vorstellen als noch 1916.
Ich reagierte erschüttert. Melroy hielt ich entgegen, wir hätten keine Aussicht auf einen fairen Frieden mit dem Reich, wenn der Kaiser und Hindenburg aus einer Position der Stärke in die Verhandlungen einstiegen. Doch der Generalkonsul wehrte mit einer laschen Handbewegung ab. Sie glauben gar nicht, welche realistischen Gedanken sich die weltoffenen Herren in Berlin über das amerikanische Militärpotenzial machen. Ich wette, da geht etwas!“
Oberst House kann seine Spannung nicht mehr verbergen. Er rutscht etwas unruhig in seinem Sessel hin und her, dabei knetet er die Hände zur Selbstberuhigung ineinander.
„Jetzt aber raus mit der Sprache, Louis. Wer ist es, der in Berlin für gut zu gebrauchen ist? Du glaubst doch wohl selbst nicht, dass Ludendorff zu den Weltbürgern dort zählt oder der Kaiser persönlich Graf Bernstorff auf die Reise nach New York geschickt hätte.“
Woodrow Wilsons Gesichtsausdruck verrät, dass er ähnliche Überlegungen anstellt, doch der Präsident zügelt seine Ungeduld und dokumentiert staatsmännische Gelassenheit, indem er nichts weiter unternimmt, als Eddy House das Feld zu überlassen und Brandeis auffordernd anzublicken. Dem Blick hält Louis Brandeis gerade einmal zwei Sekunden stand.
„Es waren nicht Hindenburg und Ludendorff, aber auch nicht Graf Hertling oder Kühlmann, die Bernstorff gespickt haben mit Ideen zu einer amerikanischen Initiative. Es war überhaupt kein Mitglied der Regierung. Aber dennoch sprach er mit zwei bedeutenden Männern, mit zwei Spitzenvertretern der Wirtschaft, die wiederum über die Rückendeckung von zwei noch bedeutenderen Männern aus der Politik verfügten.“
„Sicher? Oder eher Gerüchte, Hoffnung, Legendenbildung?“
Edward House Einwurf erscheint Brandeis so despektierlich, dass er jeden Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Quelle ausräumen möchte.
„Nun, zu aller erst: Lord Melroy ist ein höchst vertrauenswürdiger Mensch. Auf ihn lasse ich nichts kommen.“
Oberst House wirft entwaffnet die Oberarme nach vorn und gibt sich gestikulierend geschlagen.
„Melroy hat die gleiche hohe Meinung von Bernstorff wie ich von Melroy.
Bernstorff nun beruft sich auf ein Kamingespräch in der Grunewalder Villa des Präsidenten der AEG, Herrn Doktor Walther Rathenau, an dem nur noch der berühmte Hamburger Reeder Albert Ballin teilnahm. Ich wiederum kenne Ballin von einer seiner ausgiebigen USA-Reisen. 1911 begegneten wir uns in Boston, hielten seitdem Briefkontakt und schätzen uns sehr. Ballin ist als Reeder natürlich ein Verfechter der offenen Meere, des freien Handels. Sein Freund Rathenau ist einer der mächtigsten Vertreter der deutschen Exportindustrie, deren Frontbranchen schließlich Chemie und Elektro sind.“
„Na ja, das gibt mir bisher nicht mehr als die Erkenntnis, dass diese Herren im Gegensatz zu den Junkern und Stahlbaronen mit ihren Kriegszielen unseren Vorstellungen sehr viel näher liegen dürften. Doch das besagt wenig über ihren Einfluss auf die Machthaber.“
„Du hast völlig recht, lieber Woody. Für die politische Dimension der Bernstorffschen Informationen ist Folgendes entscheidend: Rathenau und Ballin sind Berater von Stresemann und mehr als das, sie sind seine Freunde. Der Volkswirt Doktor Gustav Stresemann ist seit Juli Fraktionsvorsitzender der Nationalliberalen im Reichstag. Die wiederum sind die größte Regierungspartei und die politische Heimat aller auch nur irgendwie bedeutenden Industriellen des Reiches. Sie üben auf die Regierung einen größeren Einfluss aus als die Konservativen, das Sammelbecken der Junker.“
Oberst House fällt Brandeis ins Wort mit all seinen Zweifeln an der Berechenbarkeit der Machtverhältnisse in Deutschland.
„Ich habe aber gehört, die Militärs hörten viel lieber auf die Imperialisten von der Ruhr mit Stinnes und Hugenberg – auch Nationalliberale – als auf die Modernisierer von der Weltmarktfraktion in derselben Partei. Also heißt die Devise: Vorsicht an der Bahnsteigkante! Stresemann ist nicht Reichskanzler und zusätzlich auch noch Vorsitzender einer innerlich hochgradig gespaltenen, vor der Zerreissprobe stehenden Industrieund Unternehmerpartei.“
„Hör mir bitte erst einmal bis zum Ende zu, Eddy. Bestimmt ist Stresemann nicht die Macht, die dem Reichskanzler die Politik diktiert. Aber Stresemann ist – ja das ist inzwischen sicher – der wichtigste Berater des Kronprinzen aus dem parlamentarischen Raum.“
Woodrow Wilson scheint genug von all zu optimistischen Einschätzungen über den Einfluss der Modernisierer in der Reichshauptstadt zu haben.
„Ach herrje, der Kronprinz! Der ist voraussichtlich noch schlimmer als sein Vater, was die Forderungen nach Land betrifft. Wilhelm soll Ludendorff nach dem Munde reden. Wenn das so ist, dann nützen alle Einflüsse eines Stresemanns gar nichts!“
Der Ausruf des Präsidenten bringt Brandeis kurzzeitig aus dem Konzept. Wie gerne hätte er jetzt in aller Ruhe seinen Gedankengang ausgebreitet und vollendet. Doch es hilft ja nichts. Woodrow ist hier der Chef. Also gilt es, ihn und nur ihn zu überzeugen. „Lieber Woodrow, es ist ein wenig anders. Bernstorff hat Melroy berichtet, dass die drei Herren Kronprinz Wilhelm, Generalquartiermeister Ludendorff und Stresemann unter vier Augen und auch unter sechs Augen miteinander sprächen. Das sei in 1917 des Öfteren geschehen. Von seiner Erziehung, seinen Werten ist Wilhelm erst einmal näher beim preußischen Heer als bei der Exportindustrie. Aber dieser Doktor Stresemann hat es offenbar verstanden, beim Kronprinzen den Keim des Zweifels auszusäen: Wird es dem mächtigen Deutschen Reich tatsächlich gelingen, alle seine Feinde militärisch restlos zu besiegen? Das schlösse inzwischen sogar mit ein, Briten und Amerikaner komplett aus Frankreich hinauszubefördern. Tritt dieser eher unwahrscheinliche Fall nun aber nicht ein, braucht das Reich einen Ausweg – wir würden sagen die Exit-Strategie. Das Reich braucht selber einen Friedensplan, der Verhandlungen erlaubt und in diesen dem Reich die Aussicht auf die Durchsetzung substanzieller Punkte ermöglicht. Bernstorff meint jedenfalls, beim Kronprinzen sei ein Denkprozess angestoßen worden, der vom Ende der denkbaren Ereignisse aus den ersten Monaten des Jahres 1918 her beginnt. Und am Ende steht nur für Ludendorff, dass die Armeen der Entente vor den Alpen aufgerieben werden. Für Stresemann dagegen steht dort ein großer internationaler Friedenskongress. In dem wird Deutschland einige Ziele durchsetzen können, aber eben nur dann, wenn sie in die moderne Weltordnung des 20. Jahrhunderts auch wirklich hinein passen.“
„Den Namen Stresemann werde ich mir ab jetzt merken!“
Der Präsident lächelt, faltet seine Serviette zusammen und erhebt sich vom Tisch, um den Speisesalon zu verlassen.
„Meine Freunde, im Oval Office warten noch einige große Aufgaben auf uns.“
Woodrow Wilson, Edward House und Louis Brandeis bedingen sich für gut zwei Stunden störungsfreie Ruhe und Arbeitsmuße aus. Aus Oberst House Feder fließt in dieser Zeit nahezu der vollständige, endgültige und druckreife Text der Wilsonschen 14 Punkte. Dann beraten die drei Freunde, wie die Friedensinitiative des Präsidenten der Weltöffentlichkeit passend und effektvoll übermittelt werden soll. Der Präsident verlangt einen Rahmen, der wie ein moralisches Fanal an die Krieg führenden Völker appelliert. Wenn schon der Inhalt seiner Friedensinitiative der Realpolitik und den diplomatischen Gepflogenheiten hohen Tribut zollt, so soll doch die Inszenierung für die Weltöffentlichkeit keine Wünsche, nämlich keinen seiner eigenen Wünsche offen und vor allem keinerlei Ansprüche der Verbündeten in London und Paris an demokratisch-freiheitlichem Pathos unerfüllt lassen. Louis Brandeis spricht laut denkend und bezeichnet eine Konferenz für die Washingtoner Presse als viel zu wenig. Edward House sinniert darüber, eine große Zahl geladener Gäste zu versammeln und ihnen die 14 Punkte vorzutragen. Dem Präsidenten gefällt das alles noch nicht.
„Am kommenden Dienstag nimmt der Kongress zum Jahresbeginn wieder seine Plenarsitzungen auf. Wie wäre es denn, wenn wir, die Ritter der Demokratie in diesem Krieg, vor dem amerikanischen Parlament das neue Friedensangebot offerierten? Die Idee ist schon ganz gut, aber so eine gewöhnliche Sitzung des Abgeordnetenhauses allein genügt mir eigentlich noch nicht.“
„Setz doch eins drauf, Woody. Lade doch das Abgeordnetenhaus und den Senat zu einer gemeinsamen Sitzung ein. Was könnte es Erhabeneres geben als Symbol und Repräsentation der amerikanischen Demokratie, als dass der Präsident vor beiden Kammern des Kongresses spricht!“
Der Vorschlag von Edward House wird sofort vom Präsidenten und auch von Louis Brandeis für gut befunden und angenommen. Für heute sind die drei Freunde sehr mit sich, mit dem Outcome ihres Treffens, ihrer Arbeit zufrieden. Es folgt die Verteilung der Aufgaben unter Einbezug des persönlichen Referenten des Präsidenten sowie seiner Sekretärin. Erst um 19 Uhr fühlt sich Woodrow Wilson von der Last der Vorbereitungen befreit, deren Organisation noch zwischen ihm und seiner Rede vor dem Kongress am 8. Januar gestanden hat.
Nachdem seine Mitarbeiter das Oval Office verlassen haben, bleibt der Präsident noch eine kurze Weile am Schreibtisch sitzen. Sein Blick richtet sich scheinbar starr auf die gegenüberliegende Wand, von der aus Woodrow Wilson der Staatsgründer George Washington von einem Porträt in stolzester Haltung anlächelt. Ganz unmerklich, dann klar und deutlich legt sich auch ein Lächeln auf seine Züge. Leise murmelt er nur für sich:
„Wir Amerikaner waren doch immer schon selbstbewusst genug, in guter Partnerschaft, aber doch auch im Eifer, unseren eigenen Weg zu finden, den Europäern einfach nicht alles so selbstverständlich nachzumachen!“
Jetzt greift der Präsident zu seinem schweren, schwarzen Füllfederhalter mit der weichen, breiten Miene. Als letzte Zeilen für seinen baldigen Auftritt vor dem Kongress schreibt er in fein säuberlicher Handschrift auf ein blütenweißes Blatt Papier, so dass er selbst kaum das Streichen der Füllermiene über die Blattoberfläche zu hören vermag:
„… Wir hegen keine Missgunst gegenüber deutscher Größe. Und da befindet sich nichts in diesem Programm, das sie schmälert.
Wir wünschen sie nicht zu beeinträchtigen oder in irgendeiner Weise den legitimen Einfluss und die Macht der deutschen Nation zu hemmen.
Wir streben nicht danach, weder mit Waffengewalt noch mit gegen sie gerichteten Handelsverträgen, deutsche Größe zu bekämpfen. Das gilt, falls die deutsche Nation willens sein möge, sich ihrerseits mit uns und den übrigen den Frieden liebenden Nationen der Erde zu verbinden in einem Vertragswerk, das gekennzeichnet ist von Gerechtigkeit, Recht und einem Achtung gebietenden Umgang miteinander.
Wir wünschen uns, dass die deutsche Nation einen Platz der Gleichheit unter den Völkern der Erde akzeptieren möge, der neuen Welt, in welcher wir jetzt bereits leben, anstelle eines Platzes der Herrschaft, der Überlegenheit.“
Mit diesem breiten Lächeln, voller Gelassenheit, voller Selbstzufriedenheit und Gewissheit, das unbedingt Richtige zu tun, schraubt Woodrow Wilson die Schutzkappe auf seinen Füllfederhalter und lässt sich ganz allmählich und entspannt in das tiefe Sitzpolster und in die hohe Rückenlehne seines Schreibtischsessels sinken.