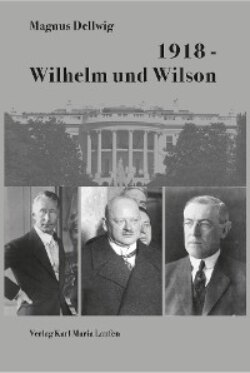Читать книгу 1918 - Wilhelm und Wilson - Magnus Dellwig - Страница 13
7 Friede mit Russland
ОглавлениеWie durch einen schweren dunklen Schleier, der im Wind schwingt, nehme ich Bewegung vor meinen Augen wahr. Es treten Geräusche hinzu. Augenscheinlich ist mein Patientenzimmer randvoll mit Ärzten und Pflegepersonal gefüllt, die sich in mehr als nur Zimmerlautstärke unterhalten. Ich selbst bin ganz ruhig, so als bräuchte ich zum Leben nicht einmal mehr die rudimentärsten Körperfunktionen, wie das Atmen oder das Schlucken oder das Schlagen der Augenlieder. Als Nächstes geht mir auf, dass diese Untätigkeit nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss. Ich zwinge mich dazu, meine Erinnerung an Wilsons Erzählung über den Januar 1918 hinter mir zu lassen und in die Gegenwart des Septembers 1929 einzutauchen. Am besten wird wohl sein, Sinn erfassend den Gesprächsfetzen der eifrig um mein Wohlergehen besorgten Beschäftigten der Charité etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Ganz allmählich schälen sich aus dem Geräuschwirrwarr die Stimmen von Professor Kraus und des jungen, freundlichen Stationsarztes heraus. Eine dritte Stimme erkenne ich. Es ist diejenige der resoluten Oberschwester, die dennoch nichts militärisches an sich hat. Kraus verlangt danach, dass man ihm Infusionen aufziehe und reiche. Der Stationsarzt misst scheinbar unaufhörlich und abwechselnd meinen Puls und Blutdruck. Die Oberschwester gibt knappe, präzise, dabei kaum laut geäußerte Anweisungen an das übrige Pflegepersonal im Raum. Aus einem Satzfetzen entnehme ich die Information, dass wir uns am späten Nachmittag des 30. Septembers befinden. Somit ist es einen Tag her, dass der Kaiser mich hier in der Charité besuchte.
Ganz vorsichtig öffne ich erst das linke, dann das rechte Auge. Mir starrt Kraus ins Gesicht. Auf mich wirkt es durchaus emotional und erleichtert als er ausruft:
„Herr Reichsaußenminister! Wie schön es ist, ihnen wieder in die wachen Augen blicken zu dürfen! Wir waren bisweilen nicht sehr hoffnungsvoll. Sie drohten uns zu entgleiten, denn, nun ja, sie hatten einen schweren Schlaganfall und wir mussten sie reanimieren. Bitte sorgen sie sich jetzt um überhaupt nichts, sondern erholen sie sich und kommen sie ein wenig wieder zu Kräften. Wir werden unentwegt ihre Körperfunktionen überwachen und sie mit Medikamenten versorgen, die das Herz-Kreislaufsystem so gut wie möglich stabilisieren werden.“
Ich lächele Professor Kraus an und möchte etwas sagen. Doch dies gelingt mir nach schmaler Öffnung der Lippen nicht. Mein Lächeln erstirbt.
„Ganz normal, ganz normal, lieber Doktor Stresemann. Das sind Wortfindungsstörungen, wie sie nach jeder Art der neurologischen Abnormalität auftreten, oftmals nur kurzzeitig. Die Sprache kommt am schnellsten wieder, wenn sie sich jetzt selbst so umfassend wie möglich schonen.“
Professor Kraus blickt den Stationsarzt an. Der wendet sich sogleich an mich.
„Wir haben ihre Gattin umgehend verständigt, Herr Reichsaußenminister, nachdem wir ihren Schlaganfall in den frühen Morgenstunden diagnostizierten. Sie wollte gleich kommen. Auf Anraten des Herrn Professors konnte ich sie allerdings davon überzeugen, dass es ihrem Gesundheitszustand mehr zum Wohle gereiche, wenn wir hier zuerst einmal unsere Arbeit leisten, sie betreuen und stabilisieren. Anschließend ist der Zeitpunkt für Besuch wieder gekommen. Schlafen sie sich jetzt erst einmal einige Stunden aus. Das entspannt. Wenn sie dann aufwachen, werden wir ihre Gattin fernmündlich unterrichten und ihr gerne die Möglichkeit einräumen, ins Klinikum zu ihnen zu gelangen.“
In meinem Kopf formt sich mühsam die Frage: Nur meine Frau verständigt? - Aussprechen kann ich die Worte nicht. Vielleicht sahen meine Gesichtszüge gerade eben verzweifelt oder ringend aus. Das genügte offenbar der Oberschwester, um annähernd zu erahnen, welcher Gedanke mir kam. In einem sehr kurzen Blickkontakt holt sie sich das Einverständnis des Chefarztes ein zu sprechen.
„Es haben weitere Personen in den letzten Stunden angefragt, ob sie Besuch empfangen könnten. Wir haben das selbstverständlich zu ihrem Wohle zurückgewiesen. Die fraglichen Personen waren ihr Sohn Wolfgang und erneut Seine Majestät, Herr Reichsaußenminister. Der Chef des Zivilkabinetts Seiner Majestät brachte die übergroße Ungeduld Seiner Majestät zum Ausdruck und trug uns auf, ihnen im Moment der Rückkehr ihres Bewusstseins die allerherzlichsten Wünsche zur Genesung auszurichten.“
Ich danke der Oberschwester mit einem kaum sichtbaren Nicken, einem deutlich kontrollierter ausgeführten Wimpernschlag und einem Hauch von Lächeln um meine Mundwinkel. Das genügt Professor Kraus für eine knappe Aufmunterung.
„So gefallen sie mir gleich wieder besser. Kopf hoch! Es geht wieder aufwärts! Verlassen sie sich darauf, dass wir alles unternehmen werden, das in unserer Macht steht, um ihnen zu helfen.“
Ich nicke ein weiteres Mal aus lauter Dank und schließe mit einem Schmunzeln die Augen. Für eine kurze Weile setzt sich der Geräuschpegel aus Stimmen in meinem Zimmer fort. Daraufhin tritt Stille ein. Ich sehe nur weiß. Meine Erinnerung gleitet durch die Zeiten.
Alles weiß sah ich ebenfalls am Nachmittag des 8. Januar 1918, als ich aus dem Fenster meines Büros im schräg gegenüber liegenden Reichstagsgebäudes blickte. Der Himmel war hellgrau. Wegen des Schneefalls wurde die Straßenbeleuchtung bereits gegen 14.30 Uhr eingeschaltet. Nach den Feiertagen war ich am 7. Januar in den Arbeitsalltag zurückgekehrt und las aufmerksam die Presse des europäischen Auslandes. Wien, Bern, Rom, Paris und London natürlich. Aus Petersburg drangen nur spärliche Nachrichten über die Hintergründe für die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen durch die Bolschewiki an unser Ohr.
Ich dachte zurück an das vorgestrige Telefonat mit seiner kaiserlichen Hoheit, dem Kronprinzen. Wilhelm höchst persönlich rief mich aus Schloss Cecilienhof in Potsdam am Tag vor seiner Rückreise an die Front an und teilte mir mit, wie geradlinig und aufmunternd der Kronrat vom 3. Januar verlaufen sei. Äußerst zufrieden zeigte er sich mit der einhelligen Handlungsmaxime von militärischer wie ziviler Reichsleitung, die Rückkehr der Russen an den Verhandlungstisch in Brest-Litowsk binnen Wochenfrist zu erzwingen. Anderenfalls stand nunmehr die harte Drohung im Raum, die am 14. Dezember eingestellten Kampfhandlungen wiederaufzunehmen. Das beherzte Auftreten Seiner Majestät habe, so der Kronprinz, mächtigen Eindruck auf den Reichskanzler und den Chef der Obersten Heeresleitung gemacht. Generalfeldmarschall von Hindenburg und Generalleutnant Ludendorff hätten ohne Murren den Befehl entgegengenommen, die Vorbereitungen für eine schnelle Besetzung russischen Gebietes zu treffen und zwar in dem Umfange, in dem wir den russischen Staat zukünftig nach Osten abgedrängt sehen wollten. Das schlösse zur Not die Besetzung Livlands und der Ukraine vollständig ein.
Ferner ließ sich Wilhelm II. von Ludendorff zum Stand der Generalstabsplanungen für eine Offensive im Westen berichten. Der Generalquartiermeister habe sich augenscheinlich regelrecht darauf gefreut zu diesem Thema vortragen zu dürfen. Er schilderte die Kampfkraft unserer Truppen in den buntesten Farben und nannte die Hoffnung, bis zu 100 Divisionen mit gut 1,5 Millionen Mann Mannschaftsstärke im Osten frei zu bekommen. Graf Hertling und Außenstaatssekretär Kühlmann meldeten Zweifel an, den riesigen osteuropäischen Raum dann noch mit den verbleibenden geringen Truppenkontingenten beherrschen zu können. Ludendorff habe sich daraufhin ein wenig unverbindlich aus der Affäre gezogen. Einerseits könne man die Österreicher um Unterstützung bitten. Andererseits sei die Truppenreduzierung doch ohnehin nur für kurze Zeit vorgesehen. Denn nach dem Sieg im Westen könnten schließlich Teile der Ostarmee im Herbst schon wieder in der Ukraine stehen, falls sich das als notwendig erweisen sollte.
Ich dankte seiner kaiserlichen Hoheit beinahe überschwänglich für seinen ausführlichen und farbenfrohen Bericht über die Sitzung des Kronrats. Dennoch blieb bei mir nach dem Telefonat ein fader Beigeschmack zurück. Die deutschen Kräfte waren arg begrenzt! Zwar stimmte die Qualität unseres hervorragenden Heeres nach wie vor. Aber das quantitative Übergewicht unserer Feinde nahm stetig zu. Das Ausscheiden Russlands aus dem Krieg würde dringend erforderlich werden, um in Frankreich eine möglicherweise bereits in 1918 von den Amerikanern getragene Offensive abzuwehren. Sicher würde es besser sein, dem Feind zuvorzukommen. Aber an jenem 8. Januar kam mir erstmals die Überlegung, dass eine Westoffensive die heute durchaus noch beeindruckenden deutschen Kräfte notwendigerweise schmälern musste. Würde das Reich früher oder später abwägen müssen, ob es klüger sein würde, alles in den Kampf zu werfen und dabei unsere Reserven aus dem Osten womöglich gefährlich zu verheizen? Oder aber ob es besser sein dürfte, dem Feind irgendwie eindrucksvoll die Zähne zu zeigen, aber unsere noch sehr starken Truppen eventuell eher dafür aufzusparen, dem immer mächtiger aufmarschierenden Feind den Vormarsch in Nordfrankreich wirkungsvoll verwehren zu können? Diese Abwägung fesselte mich. So schreckte ich auf, als der Pressereferent unserer Fraktion, der junge und sehr gedankenschnelle Karl Naumann, energisch gegen meine Bürotüre klopfte und um Einlass bat, um mir etwas mitzuteilen. Die Fernschreiber aus Washington meldeten Folgendes: Präsident Wilson habe heute Vormittag eine Rede vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses gehalten und darin eine neuartige Initiative zur Beendigung des Krieges ergriffen. Das Ziel des Präsidenten sei die Erreichung einer Friedenskonferenz auf Grundlage seines Manifestes. In 14-Punkten habe Präsident Wilson allgemeine und auch detaillierte Forderungen erhoben. Pressereferent Naumann sei jetzt darum bemüht, jene 14 Punkte zu recherchieren und dann den vollständigen Text der Proklamation zu erhalten.
Etwas benommen drückte ich unserem jungen, sehr guten und engagierten Pressereferenten meinen Dank für die umgehende Information aus. Die widersprüchlichsten Gefühle übermannten mich. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und stützte vor innerer Anspannung, die sich bis zur Erschöpfung steigerte, den Kopf in meinen beiden Händen auf. Hatte ich es doch gewusst: Die Amerikaner würden etwas Neues unternehmen! Das war an sich gut, weil es neue Anknüpfungspunkte für Gespräche schuf, wenngleich kaum zu erwarten war, dass man allen von Wilsons Kriegszielen selbst bei großzügigster Interpretation der Inhalte würde aus deutscher Sicht zustimmen können. Und ich ging einen Schritt weiter: Meine um die Westoffensive kreisenden Gedanken verstärkten in mir die Gewissheit, dass die deutsche Reichsleitung alles Erdenkliche tun sollte, um Wilsons Angebot zu analysieren. Das würde uns wohl zu der Erkenntnis gelangen lassen es sei gut, zwar vielleicht nicht heute oder morgen, aber sehr wohl nach einem Angst erfüllenden Säbelrasseln unserer 100 Divisionen Verstärkung aus dem Osten einen kreativen und vielleicht gar maßvollen eigenen Vorschlag für die Aufnahme von Verhandlungen zu unterbreiten.
Die Inszenierung Wilsons, seine Initiative in eine große Rede vor Repräsentantenhaus und Senat zu kleiden, imponierte mir und machte deutlich, dass dieser Präsident es wohl niemals würde lassen können oder auch nur wollen, sein Handeln als einen welthistorischen Kreuzzug für die Verbreitung der Demokratie herauszustellen. Dieser Propaganda würden wir Monarchisten in Deutschland vielleicht nie ganz das Wasser reichen können. Umso wichtiger war für mich am Abend des 8. Januar 1918, als ich vom Reichstag kommend bei meiner lieben Käte zu einer wärmenden und stärkenden Hühnerbrühe eingetroffen war, dass in Deutschland das allgemeine und gleiche Wahlrecht bald und uneingeschränkt zum Zuge käme. Als eine parlamentarische Monarchie würden wir mit Amerika sehr viel leichter auf Augenhöhe verhandeln können als eine Monarchie, die in den Staaten stets denunziert würde als Regime der Junker, Militärs und Zechenbarone. Für den kommenden Tag war die erste Sitzung meiner Fraktion im neuen Jahr anberaumt. Es gab wichtige Entwicklungen zu erörtern: Den Kronrat, Wilsons 14 Punkte, vielleicht auch Neuigkeiten von den Verhandlungen in Brest-Litowsk. Schließlich war Lenins vertrauter Leo Trotzki dort als Verhandlungsführer der Bolschewiki am 7. Januar eingetroffen, um Joffe abzulösen. Mich überfiel die Müdigkeit, als ich in meinem Arbeitszimmer zu Hause Aufzeichnungen für meine morgige Sitzungsleitung machte. Anschließend schlief ich in der Gewissheit tief und fest ein, dass 1918 das bislang wohl wichtigste Jahr des noch jungen 20. Jahrhunderts zu werden versprach. Chancen und schier unlösbare Aufgaben lagen dabei sehr nahe beieinander. Der darauf folgende Tag sollte ein wichtiger Tag für meine Verarbeitung der Nachricht von Wilsons 14 Punkten werden. Ich konzentriere mich darauf, was sich im einzelnen damals ereignete, nachdem ich am Morgen des 9. Januar 1918 in den Reichstag gefahren war.
Oberst von Gilsa stürmt in den Sitzungssaal der Nationalliberalen Fraktion und direkt auf mich zu. Er ist einer der typischen Parteigänger der Schwerindustrie aus dem Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet. In seinem Fall ist das sogar gänzlich offenkundig und aller Welt bekannt, da er in einer Zeit ohne Reichstagsmandat unmittelbar vom Oberhausener Konzern Gutehoffnungshütte eine Vergütung bezog. So wundert es niemanden in meiner Fraktion, wenn von Gilsa und andere bei Kriegszieldiskussionen stets den schärfsten Ton anschlagen, die umfassendsten territorialen Forderungen erheben und es vor allem auf das französische Erzbecken von Longwy / Briey abgesehen haben. Jedenfalls berichtet mir von Gilsa über ein Telefonat, dass er gestern spät mit seinem Kameraden Oberst Bauer von der OHL in Spa geführt habe.
„Dieser Trotzki ist eine Unverschämtheit und ein Teufelskerl in einer Person! Bei der Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen führt er unsere Delegation offensichtlich an der Nase herum. Ellenlange Reden über die zugegeben beklagenswerte Lage der arbeitenden Massen in Russland lässt er enden in der Erwartung baldiger Arbeiterunruhen auch bei uns im Reiche. Und auf die Frage nach den Friedensbedingungen, die seine Regierung zu akzeptieren bereit sei, geht er mit keinem Sterbenswörtchen ein. Genauso schlimm ist indes, dass die Arbeiter im Industriegebiet an der Ruhr tatsächlich in vielen Werken mit der heutigen Frühschicht in den Ausstand getreten sind. Ich versicherte mich darüber gleich fernmündlich. Die Zentralverwaltung der Gutehoffnungshütte in Oberhausen wusste schon von Arbeitsniederlegungen bei Thyssen in Hamborn und bei Hoesch in Hörde. Auch bei Krupp soll es los gehen. Nur bei der GHH selbst blieb alles vorläufig noch ruhig.“
„Herr Oberst, wir werden uns gleich in der Sitzung genügend Zeit nehmen, uns über die Bedeutung der Ereignisse, die weltweit seit Jahresbeginn eingetreten sind, auszutauschen. Bitte tragen sie ihre Erkenntnisse dann ebenfalls vor. Ich selbst werde zu Beginn einen Überblick geben zum Kronrat in Potsdam am 3. Januar und natürlich zur Rede des amerikanischen Präsidenten von gestern.“
Geradezu verächtlich blickte der Oberst mich an. Seine Mundwinkel klappten ebenso nach unten wie seine rechte Hand.
„Dieser Wilson hält sich wohl für allmächtig, dass er sich herausnimmt, der ganzen Welt Vorschriften über den Frieden machen zu wollen. Ich plädiere sehr dafür, diesen Träumer nicht all zu ernst zu nehmen. Wenn unsere Truppen im Frühling die französischen Stellungen an der Marne überrennen werden, sind Wilsons 14 Punkte nicht mehr als eine knappe Fußnote in der Geschichte des letzten Kriegsjahres 1918.“
Von Gilsas abfällige Einschätzung zur Friedensbotschaft des US-Präsidenten erwies sich als vielsagendes Omen für die anschließende Sitzung. Der rechte Flügel meiner Fraktion begrüßte den Kronrat und vor allem sämtliche Beschlüsse hin zu einem Siegfrieden mit Russland und einer anschließenden Offensive im Westen überschwänglich. Aus dieser Stimmung heraus fiel die Ablehnung der 14 Punkte Wilsons kategorisch aus. Seine Vorschläge zu Elsass-Lothringen und Polen genügten der Mehrheit leider bereits, um die Unverhandelbarkeit festzustellen. Ich hatte mir vor der Sitzung fest vorgenommen, neben meiner Kritik auch Anerkennung für einzelne Inhalte und schon aus grundsätzlichen wie taktischen Gründen selbst für die diplomatische Offenheit mancher Formulierung auszudrücken. Als ich damit begann, unterbrachen mich gleich mehrfach besonders hitzige Abgeordnetenkollegen. Oberst von Gilsa gar rief in die Runde hinein, die vaterländische Gesinnung aller Reichstagsfraktionen werde sich jetzt daran beweisen, wie kompromisslos ihre Ablehnung der Wilsonschen Inhalte ausfiele. Im Ergebnis schwächte ich meine Ausführungen ab und beließ es bei vorsichtigen Hinweisen auf den Nutzen solch weicher Ziele, wie sie der US-Präsident nunmehr vertrete. Zum Abschluss der Beratung erklärte ich meinen Kollegen, dem Herrn Reichskanzler sogleich die Haltung der Fraktion mitzuteilen und eine eigene Pressemitteilung herauszugeben. Meine Ausführungen wurden dann zu einem guten Stück davon überholt, dass unser Pressesprecher den Raum betrat und mir einen Zettel reichte mit der kurzen Notiz: Das Reichskabinett lehnt die 14 Punkte von Wilson ab!!! Ich beendete die Fraktionssitzung nach einem denkbar knappen Bericht über die Festlegungen des Kronrats vom 3. Januar in dem Bewusstsein jetzt Wichtigeres zu tun zu haben.
Sogleich darauf bat ich meine Sekretärin, bei der Fraktion des Zentrums nachzufragen, ob Herr Erzberger heute im Hause sei. Da die Ultramontanen erst am folgenden Tag ihre Sitzung abhielten, erhielt ich Gelegenheit, mit dem Vorsitzenden des Zentrums nur 25 Minuten später in seinem Büro einen Kaffee zu trinken. Die Zwischenzeit genügte, um den Chef der Reichskanzlei fernmündlich über den Beschluss meiner Fraktion zu unterrichten. Reichskanzler Graf Hertling werde schon übermorgen vor dem Reichstag eine Regierungserklärung abgeben, lautete die Botschaft. Darin erführen zwei Positionen eine große Betonung: Die Ablehnung der 14 Punkte und weiter der erklärte Wille der Reichsleitung, schnell und notfalls mit Druck den Frieden im Osten zu erzwingen. Dann schlenderte ich durch die Flure zum Zentrum. Matthias Erzberger sah mich weniger triumphierend als vielmehr besorgt an, als er sagte:
„Sie werden es heute nicht geschafft haben, lieber Stresemann, die Annexionisten in ihren eigenen Reihen zu zügeln und eine nüchterne Prüfung der Initiative des amerikanischen Präsidenten zuzulassen. So sehr ich das natürlich bedauere, ebenso sehr fühle ich mich darin bestätigt, dass man mit den Herrschaften der Schwerindustrie keine von Verantwortung für die Zukunft getragenen Kompromisse zur Erreichung des Weltfriedens finden wird. Entweder sie klagen mir jetzt ausführlich ihr Leid, oder wir grübeln ein wenig darüber, welche Aussichten der Friede im neuen Jahr womöglich noch erhalten wird.“
Diese Aufforderung nahm ich gleich dankend an.
„Wilson geht in einigen für das Reich sehr substanziellen Fragen erheblich über ihre Friedensresolution vom letzten Juli hinaus, Kollege Erzberger, weil er den Mut aufbringt, konkreter zu werden.“
Der nickt und starrt versonnen an die Wand.
„Ein Frieden ohne Sieger, wie ihn die Amerikaner proklamiert haben, als sie noch nicht im Krieg gegen uns standen, ist heute so leicht nicht mehr zu bekommen. Trotzdem finde ich mich in einigen der Forderungen Wilsons wieder. Das mag ein Anfang sein um darüber nachzudenken, welche Chancen die Diplomatie in den nächsten Monaten noch erhält. Schließlich dürfen weder wir noch die Entente darüber hinwegsehen, dass vor Verhandlungen nicht auch zugleich unüberbrückbare Widersprüche bestehen bleiben.“
Es klopft an der Türe. Matthias Erzberger ruft lässig herein, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Ich sehe zur Türe, durch die jetzt Conrad Haußmann seinen Kopf ins Zimmer hinein steckt. Er blinzelt uns an und lächelt dabei geradezu amüsiert.
„Als ich eben hörte, die Kollegen Stresemann und Erzberger in trauter Zweisamkeit zusammen hockend anzutreffen, musste ich es einfach wagen. Ist für mich auch noch eine Tasse Kaffee übrig?“
Erzberger bittet den Fraktionsvorsitzenden der Fortschrittspartei herzlich herein.
„Anders als der Kollege Doktor Stresemann sind wir beide, Conrad, uns doch wohl einig, dass man dem Friedensplan des amerikanischen Präsidenten durchaus und mit gutem Willen etwas abgewinnen mag?“
„Gewiss, Matthias. Etwas, das ist der richtige Zungenschlag. Wilsons Plan jetzt nicht gleich in Bausch und Bogen zu verwerfen, das wäre schon etwas. Aber ich höre eben, Hertling habe die 14 Punkte vollständig abgelehnt. Ich denke, die Stunde der Demokraten ist in dieser Angelegenheit noch nicht gekommen. Und was ist mit Russland und den Streiks im Ruhrgebiet? Zwingt uns nicht all das, diese neue Konstellation bedeutender Ereignisse dazu, als die treibenden Kräfte des Reichstags selbst wieder tätig zu werden?“
Erzberger streckt die Finger seiner linken Hand leicht abwehrend und mit einer nach oben gerichteten Spreizung aus.
„Ich habe mir letzten Juli schon gehörig die Finger verbrannt, meine Freunde. Was glaubt ihr eigentlich, dass die Lage jetzt einfacher wird? Der Reichskanzler und die OHL scheinen sich einig zu sein, dass es jetzt nicht um Frieden, sondern um Angriff geht. Kollege Stresemann weiß sicher mehr darüber, wie der Kronrat entschieden hat. Das ist jetzt eine Weichenstellung!“
„Der Schlüssel liegt in Russland, wehrte Kollegen. Ich weiß vertraulich von einem der Teilnehmer, dass unser Ostheer bei Bedarf den Druck auf die Russen erhöhen wird, um den Frieden zu erzwingen und sich dann gegen Westen zu wenden.“
„Nicht mit mir, lieber Doktor Stresemann! Das Zentrum hat endgültig genug davon, an Stelle einer ehrlichen Friedensofferte unserer eigenen Regierung stets neue Ausflüchte zu hören, wie nun der Sieg erfochten werden könne. Ich traue Ludendorff da keinen Zentimeter weit mehr über den Weg. Die OHL verbreitet so konsequent Optimismus, dass die Herren Generäle gar nicht bemerken, wo ihr eigener Selbstbetrug beginnt!“
In mir steigt Hitze auf. Nur das nicht! Dass die Mehrheit des Reichstags bereits vor der Westoffensive die Lage im Reich destabilisiert, wäre eine Katastrophe. Das Reich braucht jetzt zuerst den Sieg im Osten und einen machtvollen Auftritt im Westen, bevor ein Verhandlungsfriede in Sicht kommt, der irgendwo zwischen Erzberger, Wilson und Hertling angesiedelt ist. Für unsere Aussichten auf die Erreichung dieses Friedens wäre es unzweifelhaft besser, wenn nicht auch noch Stinnes seinen Einfluss geltend machen könnte.
„Lieber Kollege Erzberger, ich teile persönlich ihre Hoffnung darauf, dass Wilsons Worte auch konstruktive diplomatische Ansätze für Verhandlungen enthalten. Doch derzeit sind wir ein schwacher Verhandlungspartner. Unser Reich braucht genau jetzt die Einigung mit den Russen, damit Amerika, England und Frankreich begreifen, dass der Frieden allein zu ihren Bedingungen nicht zu haben ist.“
„Damit wäre ich noch einverstanden, wenn ich nicht genau wüsste, dass Hindenburg und Ludendorff einzig und allein für den Angriff im Westen planen. Die Junker und die Militärs wollen keinen Friedenskongress! Falls sie mir nur versichern könnten, dass unsere Regierung Frieden schließt statt unsere Truppen im Sommer im Westen sich ausbluten zu lassen. Ja dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, hinter den Kulissen für jenen Tag X eine neue, große Friedensinitiative des Reichstags vorzubereiten.“
„Da bin ich mit dem Fortschritt sofort dabei, lieber Matthias. Ob aber unser Freund Stresemann das für seine Fraktion auch versprechen kann, was du da von ihm verlangst? Ich glaube kaum.“
Ich fühle mich trotz der sehr offenen Atmosphäre, der guten Gesprächsstimmung unwohl. Natürlich hat Erzberger Recht. Ich wünsche mir, dass die Reichsleitung im Westen flexibel und moderat auftreten wird, statt alles auf den Angriff zu setzen. Ich will mit Kronprinz Wilhelm darüber sehr bald sprechen. Denn ich spüre, dass es ohne seine Mitwirkung, seinen Einfluss auf den Kaiser und auf Ludendorff keine Chance für meine Perspektive auf ein Kriegsende ohne totalen Sieg geben wird.
Am 18. Januar verließ Leo Trotzki die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk, nachdem er mit dem deutschen Verhandlungsführer General Max Hoffmann eine Verhandlungspause vereinbart hatte. Am darauf folgenden Tag löste die Regierung der Bolschewiki in Petrograd die russische Konstituierende Versammlung auf. In dieser erst am 25. November gewählten, Verfassung gebenden Versammlung hatten die Bolschewiki nur 20 Prozent der Sitze errungen. In den sich zwangsläufig anschließenden Turbulenzen brachte Trotzki Lenin dazu, die Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk seitens der russischen Delegation ohne Einigung zu verlassen. Nur zu dem Zweck, dies dem Gesprächspartner mitzuteilen, kehrte er am 30. Januar nach Brest zurück. Die Januarstreiks in Deutschland und Österreich ermunterten die russischen Revolutionäre, noch weitgehender auf Verzögerung statt auf einen Abschluss zu setzen. Dazu nutzte Trotzki das Instrument, Gespräche abzulehnen, bei denen zugleich die ukrainische Delegation zugegen war. Doch seine Taktik scheiterte, als die Volksrepublik Ukraine am 9. Februar einen Separatfrieden mit den Mittelmächten schloss. Damit war die Hinhaltetaktik nicht mehr fortzusetzen. Also wählte Trotzki die propagandistische Offensive. Einseitig erklärte er den Kriegszustand mit Deutschland und Österreich-Ungarn am 10. Februar für beendet. Die Oberste Heeresleitung ermächtigte General Hoffmann daraufhin, sofort mit der Wiederaufnahme von Kampfhandlungen zu drohen, falls Russland Verhandlungen weiterhin ablehne. Davon unbeeindruckt tat Trotzki nichts. In dieser Lage telefonierte ich am 12. Februar mit Oberst Bauer im großen Hauptquartier der OHL in Spa.
„Die herzlichsten Grüße von Herrn Generalquartiermeister Ludendorff möchte ich bestellen, Herr Doktor Stresemann. Es ist uns von der OHL ein inniges Bedürfnis, mit ihnen als dem unbestrittenen Rückgrat vaterländischer Politik im Reichstag in diesen Tagen großer Ereignisse in direktem Kontakt zu stehen. Auch Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg dankt ihnen und ihrer Fraktion nachdrücklich für die tadellose Haltung der Nationalliberalen in den zurückliegenden, schwierigen Wochen der großen Streiks. Dass wir den Arbeitsfrieden in der Industrie wieder hergestellt haben, ist die zwingende Voraussetzung für alles Kommende. Und ich versichere ihnen, Herr Doktor Stresemann, endlich geht es los!“
„Sie sind sehr aufgeräumt, Oberst Bauer. Und sie machen mich natürlich neugierig. Ich denke kaum, dass es im Westen nun los geht. Gibt es neue Direktiven für General Hoffmann im Osten?“
„So ist es. Trotzki ist aus Brest abgereist und tut so, als könnte er einseitig einen Frieden ohne Annexionen verkünden. Heute hat die Oberste Heeresleitung General Hoffmann zu einem geheimen Treffen in Spa geladen. Morgen schon wird er hier sein. Dann werden wir verabreden, wie genau die deutsche Ankündigung ausfällt, den Kampf wieder aufzunehmen. Lieber Herr Doktor Stresemann, ich garantiere ihnen: Spätestens in einer Woche haben wir den Waffenstillstand aufgekündigt. Dann setzen wir den Vormarsch in die Ukraine fort und besetzen das gesamte Baltikum bis zur russisch-estländischen Grenze kurz vor Petersburg! Und dann müssen die Russen aufgeben. Da gibt es keinen Zweifel!“
„Wahrscheinlich haben sie Recht, Oberst Bauer. Wenn wir wieder vorrücken und Trotzki keine Truppen mobilisieren kann, um uns aufzuhalten, wird Lenin Frieden schließen. Und dann, dann endlich werden die Divisionen frei, die Herr Generalfeldmarschall von Hindenburg so dringend in Frankreich benötigt. Aber wie sieht der Friedensvertrag aus, den General Hoffmann dem reumütig nach Brest zurückkehrenden Trotzki vorlegen wird?“
In der Leitung tritt eine Pause ein. Ich höre für Sekunden nur ein von unregelmäßigem Knacken unterbrochenes Grundrauschen. Dann raschelt im Hintergrund Papier.
„Der Frieden mit der Ukraine vom 9. Februar ist eine Weichenstellung, Herr Doktor Stresemann. Wir erklären Russland zu dem Staat, der in Europa im Wesentlichen auf die Grenzen eines russischen Nationalstaats zurückgeworfen wird. Selbstverständlich für sie und für mich ist es, Polen, Litauen und Kurland aus dem vormaligen Zarenreich herauszulösen. Doch jetzt, in der Stunde des Triumphes, gehen wir natürlich weiter: Wir werden Livland und Estland ebenfalls herauslösen. Damit bekommt das Baltikum die Chance, mit einer deutschen Führungsschicht kleine Nationalstaaten zu bilden, die in Union mit der preußischen Krone regiert werden. Finnland wird ebenso von Russland getrennt wie die Ukraine und schließlich Georgien, um für Deutschland die Rohstoffe und die strategische Bedeutung des Kaukasus zu sichern. Sind sie nun beeindruckt von der Dimension unseres Erfolges?“
Auch wenn mich der weite Bogen nicht sehr überraschte, in dem Oberst Bauer die deutschen Kriegsziele im Osten umriss, wirkte die Gesamtschau auf mich überaus eindrucksvoll. Das sagte ich dann auch.
Was ich sehr bewusst verschwieg, bestand aus einem plötzlichen Einfall, der mich innerlich sogleich aufwühlte: Die Bildung einer hegemonialen deutschen Einflusssphäre von Finnland bis Georgien für sich allein betrachtet kam einem so unglaublichen Sieg gleich, dass unser Reich für den Fortgang der Ereignisse im Westen gut beraten war, den Erfolg zu sichern und keinesfalls durch überhand nehmende Ambitionen gegenüber einem immer mächtiger werdenden Feind zu gefährden. Hätte ich Bauer dies gesagt, so wäre meine Äußerung garantiert Generalleutnant Ludendorff zu Ohren gekommen. Und dieser hätte mich fortan für die vor uns liegenden Wochen und Monate der Westoffensive als einen unsicheren Kantonisten eingeordnet. Ludendorff mitsamt seinen Vertrauten Stinnes und Hugenberg wären womöglich nicht umhin gekommen, mich in ihrem durchaus einfach gestrickten Freund-Feind-Schema fortan als Gegner zu identifizieren, weil ich eben nicht zu jenen zählte, die ausschließlich den vollständigen militärischen Sieg im Westen als notwendige Bedingung für einen Friedensschluss ansahen.
Stattdessen beglückwünschte ich die Herren Hindenburg, Ludendorff und Hoffmann zum baldigen Friedensschluss in Brest, ließ der Doppelspitze der OHL meine allerherzlichsten Grüße ausrichten und sagte die weitere parlamentarische Unterstützung für die Politik der zivilen wie der militärischen Reichsleitung zu. Oberst Bauer und ich verabschiedeten uns freundlich. Wir sahen ein baldiges Wiedersehen in der Reichshauptstadt voraus.
Kaum hatte ich den Hörer in meinem Arbeitszimmer zu Hause aufgelegt, wählte ich wie in Trance die private Rufnummer meines Freundes Walther im Grunewald. Da es inzwischen nach 18 Uhr geworden war, vertraute ich darauf, ihn zu Hause und nicht bei der AEG anzutreffen. Walther Rathenaus Buttler nahm ab und stellte mich umgehend durch. Walther berichtete sogleich, was er gerade eben tue. Er saß im Salon vor dem brennenden Kamin und las in Immanuel Kants überwiegend in Vergessenheit geratener Schrift Zum ewigen Frieden. Walther zeigte sich in aufgeräumter Stimmung, erläuterte mir enthusiastisch, durch den Friedensplan des US-Präsidenten dazu motiviert worden zu sein, Kants Schrift erneut zu studieren. Schließlich sei ja nicht Wilson in 1917, sondern bereits Kant im Jahr 1795 der Erfinder jenes Bundes der Völker, den Wilson im Rahmen eines Friedensschlusses zu errichten gedenke.
„Es ist wunderbar, wie sich die Bahnen unserer Gedanken immer wieder aufs Neue kreuzen, lieber Walther. Ich habe zwar nicht an Kant, aber um so mehr an Wilsons Plan und seine Folgen gedacht, als ich eben deine Rufnummer wählte. Hast du Lust, so schnell wie möglich mit Albert Ballin und mir ein Treffen in Berlin zu veranstalten und mit uns über die Weltlage zu debattieren?
Ganz im Dunklen tappen lassen möchte ich dich aber nicht. Es geht mir um drei Dinge, alles kommende Dinge. Ich wählte diese Formulierung aus dem Titel von Walthers letztem Buchprojekt, um den Bestseller-Autor des letzten Jahres dort abzuholen, wohin seine Gedanken vermutlich schweifen mochten.“
Rathenau lachte. Sein 1917 veröffentlichtes Buch Von kommenden Dingen wurde bis Weihnachten mehr als fünfzigtausend Mal verkauft. Die Berliner Presse feierte den Autor als feinfühligen Philosophen, der über gehörige Bodenhaftung verfüge.
„Das Lob aus deinem Munde freut mich besonders, Gustav. Ich vermute, dass meine Themen doch noch etwas weiter von der realen Welt des Jahres 1918 entfernt sein mögen als deine Dinge.“
„Ich bringe es schnell auf den Punkt, Walther.
Ding Nummer eins ist der Friede mit Russland. Ich telefonierte vor nur einer halben Stunde mit Oberst Bauer, Ludendorffs Vertrautem in Spa. Dort wird es jetzt ernst. Unsere Truppen werden im Osten wieder vorrücken. Dann bricht Lenins Widerstand am Verhandlungstisch zusammen und Deutschland wird herrschen über Europa von Finnland bis zur Ukraine.
Ding Nummer zwei sind Wilsons 14 Punkte. Da hast du selbstverständlich richtig vermutet, wie sehr mich diese Friedensinitiative beschäftigt. Wenngleich das Reich diesen Plan nicht annehmen kann, enthält er einzelne Punkte, auf die wir zurückkommen werden, wenn Deutschland den Zeitpunkt für gekommen hält, um Frieden zu schließen.
Und Ding Nummer drei, was ist das? Das ist meine feste Absicht, mein Vertrauensverhältnis zu Kronprinz Wilhelm zum geeigneten Zeitpunkt in die Wagschale zu werfen, damit unser Reich den Frieden nicht doch ohne besseres Wissen verspielt!“
Walther Rathenau hat mir offenbar aufmerksam zugehört. Ohne zu zögern antwortet er mit einer unüberhörbaren Süffisanz.
„So, so, lieber Gustav. Du hast also in den letzten Tagen deine nun wirklich allerbesten Beziehungen mal wieder spielen lassen und dich bei der OHL und, wer weiß, vielleicht sogar noch beim Kronprinzen direkt nach der Großwetterlage erkundigt. Und jetzt hat sich allmählich ein schlauer Plan in deinem Kopf formiert. Der erhält indes erst seine letzten Weihen, wenn du diesen Plan deinen treuen Freunden Albert und Walther zum Fraß vorgeworfen hast. Und ich will nicht ausschließen, dass du es mit deinen demokratischen Freunden Erzberger und Haußmann ähnlich hältst. Nur Scheidemann wird von dir wohl nicht die ganze Wahrheit zu hören bekommen.
Doch um mich nicht misszuverstehen. Ich finde es absolut toll, dass es dich danach verlangt, mit Albert und mir zu sprechen. Unsere Namen klingen zwar in der Wirtschaft gut, doch in so harten Zeiten wie den unsrigen hat der Vorsitzende der strategisch wichtigsten Reichstagsfraktion uns Pfeffersäcken etwas Unglaubliches voraus: Auf dein Urteil, auf deine Unterstützung sind sie alle angewiesen! Die Sozen wie die Ultramontanen, die Militärs wie der Reichskanzler und selbst dein Vertrauter Kronprinz Wilhelm benötigt für Argumente, die bei seinem alten Herren durchschlagen, den guten Klang des Namens Stresemann. Lieber Gustav, es macht Spaß, dein Freund zu sein.“
Ich bin beschämt. Walther tut gerade so, als wäre ich die Macht, an der in Deutschland keiner vorbeikäme. Und dabei empfinde ich es ganz anders: Ich bin zwar die Spinne im Netz der Interessen, weil sie alle mit mir reden, mich gewinnen wollen. Aber ich habe deshalb überhaupt noch keine Vetomacht, um einen Alleingang der Konservativen, der Militaristen, der Alldeutschen und der Expansionisten in den Reihen der Schwerindustrie aufzuhalten, falls all jene Gruppen es vermöchten, sich mit dem Kaiser, dem Kanzler und dem Generalstab zu verbünden!
„In Wahrheit, lieber Walther, liegen Macht und Ohnmacht so gefährlich nahe beieinander, dass bei deiner Lobhudelei auf meine Wichtigkeit vielleicht doch eher der Wunsch Vater des Gedankens ist, als dies die Realität im Kaiserlichen Deutschland des beginnenden Kriegsjahres 1918 abbildet.“
„Nehmen wir zu Gunsten deines scharfen Verstandes, Gustav, leider einmal an, dass du Recht hast, um so viel mehr wird es für Albert und mich eine Herausforderung sein, dich nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten. Ein weitsichtiger Friede, der Deutschland Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, ist schließlich das höchste Gut!“
Tatsächlich sitzen wir drei Freunde nur zwei Tage später um 16.30 Uhr im Wintergarten von Walther Rathenaus Haus in Grunewald, blicken in einen malerisch verschneiten Garten, lauschen dem leisen Knistern des Kaminfeuers und genießen bei einer Tasse Tee ein herrliches Stück Apfelstrudel. Wir sind überaus gut gelaunt. Die Erwartung des Friedensschlusses mit Russland verbreitet Optimismus. Erstmals seit September 1914 tut sich plötzlich wieder die handfeste Perspektive auf, dass Deutschland den Krieg gewinnen kann. Wir schwadronieren über die bekanntermaßen etwas behäbige, aber nichts desto weniger zielstrebige Verhandlungsführung des Generals Max Hoffmann, tatkräftig und clever unterstützt vom Staatssekretär des Äußeren Richard von Kühlmann. Wir sind uns einig, dass der einseitige Friedensschluss der Mittelmächte mit der Ukraine Trotzki und Lenin endgültig zur Aufgabe zwingt, sobald unsere Truppen auch nur wieder die ersten Kilometer vorgerückt sein werden. Plötzlich wissen wir aber auch ganz genau, dass die politische, militärische und selbst die wirtschaftliche Hegemonie des Reiches über Mittel- und jetzt auch Osteuropa kaum ausreichen dürfte, um die Weltmachtstellung der größten Industrienation Europas auf Dauer abzusichern. Viel zu bedeutsam sind die Märkte jenseits unserer Frontlinien, insbesondere Frankreichs, Großbritanniens und der USA, um unseren modernen Exportindustrien ohne dortige Präsenz die Weltmarktführerschaft zu gestatten. Das mag zwar den Herren Stinnes und Hugenberg reichlich egal sein, weil für ihre Industrien der europäische Absatzmarkt ausreichend erscheinen kann. Für Elektro und Chemie, für die Handelsflotte und die Banken aber gilt das nicht! Albert, Walther und ich stellen sofort darauf fest, dass diese unsere Sichtweise eine krasse Minderheitenmeinung in Deutschland sein wird. Wir öffnen uns für die brutale Wahrheit, dass die alten Eliten und dass die breite Öffentlichkeit ebenfalls gar nicht einsehen mögen, dass Deutschland viel nötiger freie Weltmärkte als große, öde Kolonien im menschenleeren tropischen Regenwald oder den Savannen Mittelafrikas benötigt. Diese Erkenntnis mutet leider viel zu abstrakt, zu volkswirtschaftlich gedacht, zu klar auf die Zukunftsbranchen als auf die dominierenden Industrien der Jetztzeit ausgerichtet an. Mit einem Mal begreifen wir, dass wir drei verdammt mächtige Verbündete benötigen werden, um die alten Eliten im Heer, in der Regierung, im diplomatischen Dienst, in den alten Industrien an der Ruhr und in Schlesien im entscheidenden Moment zu übertrumpfen. Jener Zeitpunkt wird dann gekommen sein, wenn Seine Majestät der Kaiser und sein Reichskanzler zu entscheiden haben werden, ob sie weiter unsere gesamte nationale militärische Macht in den Kampf im Westen werfen wollen oder ob sie einen überraschenden, kreativen, fairen, auf Zukunft gerichteten eigenen Friedensplan offerieren werden, vor dem die Welt dann verblüfft ausrufen wird: Wau! Das hätten wir dem alten, militaristischen Preußen-Deutschland nicht zugetraut, dass es einen Weltfrieden erstrebt, der allen Völkern ihre Chancen bietet.
Es ist bereits nach 18 Uhr, als Walther uns auf die 14 Punkte Wilsons stößt. Er bittet um unsere Aufmerksamkeit für seine Schilderung des Besuchs, den er bei Graf von Bernstorff am 28. Dezember in Potsdam abstattete. Der vormalige deutsche Botschafter in Washington D.C. hatte im Dezember die Ostküste der USA bereist. Von Boston über New York führte ihn sein Weg zu alten Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern. Deutsche und englische Kaufleute befanden sich ebenso darunter wie amerikanische Staatsbürger, vornehmlich aus der wirtschaftlichen Elite Neuenglands. Schon vor seiner Reise hatte Graf von Bernstorff das Gespräch mit Rathenau und Ballin gewünscht und gesucht, um aktuelle Eindrücke von den politischen Verhältnissen im Reich mitzunehmen. Walther Rathenau erwähnte dies mir gegenüber vor Weihnachten nur beiläufig, so dass ich Bernstorffs Reise keine weitere Beachtung geschenkt hatte. Doch heute, nach der Verkündung der 14 Punkte durch Präsident Wilson, war mein Interesse naturgemäß groß.
„Der Graf schien aufgeblüht zu sein, weil er an seine alte Wirkungsstätte kurzzeitig zurückkehren durfte. Frohen Mutes erzählte er mir davon, wie schlecht es um Englands Kriegsindustrie stehe. Aber leider schilderte er ebenso überzeugend, dass die Rüstungslieferungen und die Truppenentsendungen der Vereinigten Staaten seit dem Herbst 1917 die Schwäche der Briten und Franzosen mehr als auszugleichen vermochten.
Bernstorffs Gesprächspartner erkundigten sich sehr neugierig nach der Stärke von Deutschlands Rüstung. Die Kaufleute und Bankiers wollten dann vor allem wissen, wie eine vom Reich gestaltete Wirtschafts- und Zollunion für den Kontinent denn nun aussehen werde. Würden Briten und Amerikaner dadurch vom europäischen Markt verdrängt? Diesbezüglich versuchte er selbstverständlich Befürchtungen zu zerstreuen. Bernstorff hatte vor seiner Reise nicht allein mit uns, sondern auch mit Helfferich von der Deutschen Bank und dann natürlich mit seinem Chef, Staatssekretär Kühlmann gesprochen. Daraus zog er den Schluss, die Zollunion böte dem Westen die Chance für eine Meistbegünstigung, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt würden: Erstens müsste Frankreich in die Zollunion eintreten und zweitens müssten die USA und das Empire im Gegenzug auch dem Reich die unbeschränkte Meistbegünstigung auf ihren Märkten gewähren.“
„Eine phantastische Vorstellung! Die vier größten Nationalökonomien der Erde bauen ihre bisherigen Zoll- und Handelsschranken fast vollständig ab. Das wäre der Durchbruch für einen freien Weltmarkt, wie wir Reeder und ihr Elektro-Industriellen, und dann natürlich auch die Chemie-Giganten unter dem Dach der IG-Farben, ihn sich doch schon lange wünschen.“
Albert Ballins Zwischenruf trifft meine Stimmung voll und ganz. Ich antworte sichtlich elektrisiert.
„Es wäre genau die richtige Antwort der Reichsregierung auf den amerikanischen Friedensplan. Wilson verlangt die Freiheit der Meere, Wilhelm verlangt die Freiheit der Märkte. Wir könnten das als eine deutsch-amerikanische Gemeinsamkeit in der Politik der Offenen Tür herausstellen. Mit Hilfe von Amerikas Open door-Politik sind die objektiven Interessen der beiden größten Volkswirtschaften der Erde wahrscheinlich leichter in Übereinstimmung zu bringen als unser beider Vorstellungen wiederum denen der beiden größten Kolonialmächte England und Frankreich entsprechen. Doch was soll es? Ein wenig Würze in einen zukünftigen Friedenskongress zu bringen, fände ich wahrlich nicht schlecht.“
Albert, Walther und ich schwelgen noch kurze Zeit in unseren hoffnungsfrohen Erwartungen einer freien Weltwirtschaft, die sogar die Bedeutung der Kolonialreiche ebenso wie die der deutschen Hemisphäre in Europa gehörig zu relativieren verhelfe. Dann jedoch kehrt Walther zum Ursprung der Betrachtung zurück.
„Graf von Bernstorff traf übrigens in New York auch den britischen Generalkonsul Lord Melroy. Das war ein freundschaftlicher Termin, wie er berichtete; an sich nichts Ungewöhnliches. Doch Melroy vertiefte sich zum Schluss der Unterredung in ein Gedankenspiel darüber, was Deutschlands Ziele für 1918 seien. Er vertrat voller Zweckoptimismus die Vorstellung, Fürst Kerenski werde Lenin mit Hilfe der Sozialrevolutionäre, die als Verbündete der liberalen Eliten schon bereit stünden, durch revolutionäre Handlungen in den beiden Hauptstädten Russlands bald stürzen. Und dann kämpfe Russland weiter an der Seite der Entente. Von Bernstorff betonte, an diesem Punkt bei der Entgegnung sehr fest in seiner Auffassung gewesen zu sein. Lenin könne sich vielleicht halten. Aber selbst falls das nicht so sei und Fürst Kerenski erneut an die Regierung käme, werde es Russland unter keinen Umständen gelingen, erneut eine geschlossene Frontlinie von Estland bis zum Schwarzen Meer zu errichten. Also sei gewiss, dass Deutschland in 1918 den Krieg im Osten gewinne und dann bis zu einhundert Divisionen nach Frankreich werfe. Für diesen Fall empfehle er den Herren Lloyd George und Wilson schon einmal, einen neuen 14-Punkte-Plan zu entwerfen. Anderenfalls werde es wohl Reichskanzler Graf von Hertling sein, dem dann nach glänzenden Erfolgen auf den Schlachtfeldern an der Somme, an der Marne und bei Paris die Initiative bei der Friedensfindung zufalle.
Und jetzt kommt das Spannende: Lord Melroy zeigte sich offenkundig nachdenklich. Er beharrte zwar auf dem festen Vertrauen in die Macht der amerikanischen Waffen, aber billigte zu, dass der Entente eine schwere Stunde an der Westfront bevorstünde, falls das Reich eine Großoffensive mit frischen Verbänden aus dem Osten starten könne. Der Generalkonsul erklärte Graf von Bernstorff sodann, er werde in den darauf folgenden Tagen Mister Louis Brandeis zu Gast haben und diesem von den Perspektiven der deutschen Kriegführung berichten. Es sei schließlich wichtig, dass bis in die höchsten Regierungskreise Realismus Einzug halte, wie der Krieg vielleicht beendet werden könne. Wisst ihr, wer Brandeis ist?“
Ich hatte den Namen schon einmal gehört, konnte mich indes nicht erinnern, in welchen Zusammenhang ich ihn stellen sollte. Albert Ballin, der auch nach unserer gemeinsamen Amerikareise von 1909 noch zwei weitere Male die Staaten besucht hatte, setzte ein überlegenes Lächeln auf und antwortete gönnerhaft:
„Der wichtigste wirtschafts- und handelspolitische Berater von Wilson, das ist Louis Brandeis. Ein Spross ausgerechnet aus einer deutschen Einwandererfamilie, heute oberster Bundesrichter in Washington, ein wenig öffentlichkeitsscheu, ein großer Verfechter nicht nur der Open door, sondern auch des freien Welthandels unter den großen Industriemächten.“
Ich sehe Albert verstohlen an.
„Was traut Brandeis der deutschen Kriegswirtschaft im vierten vollen Kriegsjahr noch zu? Hält er uns ähnlich wie Lord Melroy noch dazu für fähig, die Westfront ins Wanken zu bringen, selbst mit bis zu zwei Millionen Mann amerikanischer Verstärkungen? Davon dürfte abhängig sein, ob er Woodrow Wilson empfehlen wird, auf seinen 14 Punkten recht strikt zu beharren. Oder aber ob er dem Präsidenten dazu raten dürfte, deutsche Kriegsziele, die mehr sind als Annexionsforderungen, als gleichberechtigte Basistexte für die Aufnahme von Verhandlungen zu akzeptieren.“
„Das wäre hervorragend,“ merkt Walther Rathenau an.
„Und es würde dennoch nicht genügen. Denn zu unserem Glück würde uns dann immer noch fehlen, dass Wilson Briten und Franzosen dazu veranlassen müsste, in einen Friedensprozess auf der Grundlage seiner und unserer Vorstellungen einzutreten, nicht aber der abstrusen Ziele von Clemenceau und dessen Freunden.“
Ich gebe Walther innerlich natürlich Recht. Zugleich möchte ich an diesem Punkt keine Skepsis verbreiten.
„Für eine fernere Zukunft schon in einigen Monaten wird deine Anmerkung von welthistorischer Bedeutung sein, lieber Walther. Für heute aber bin ich Optimist und wäre deshalb allein schon damit zufrieden, dass Brandeis Wilson in dem von uns gewünschten Sinne berät.“
Diese Zaghaftigkeit möchte Albert Ballin offenbar keinesfalls für sich akzeptieren und auch nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen.
„Nun gut, Gustav. Beraten ist das eine, zur Vorsicht mahnen wäre das andere. Ich kenne die Amerikaner vielleicht besser als ihr beiden. Sie sind sehr von sich eingenommen. Sie betrachten ihre demokratische Sendung als selbstverständlich und berechtigt. Sie haben gelernt, dass kein Land der Welt es wirtschaftlich mit ihrem aufnehmen kann – mit einer kleinen Ausnahme vielleicht. Amerika hat nämlich durchaus Sorge, dass Deutschland in Chemie und Elektro die Nummer eins ist und bleibt. Was den Stahl und die Autoindustrie betrifft, machen sich die Amerikaner sicherlich keine Sorgen.“ Ballin gibt sich restlos überzeugt von der guten landeskundlichen Kenntnis, die ihm seine USA-Reisen beschert haben. Seine Vision fällt demgegenüber eher bescheiden aus.
„Wegen dieses beeindruckenden Selbstbewusstseins der amerikanischen Industriellen und ihrer politischen Vertreter würde es mir vollauf genügen, falls beim Präsidenten zukünftig ein kleiner Zweifel eingepflanzt werden könnte ob der eigenen unverbrüchlichen Siegesgewissheit. Das würde uns Deutschen dann zum richtigen Zeitpunkt in die Hände spielen, sobald die weltpolitische Großwetterlage es zuließe Verhandlungen anzustreben.“
Walther Rathenau, Albert Ballin und ich verbrachten den Rest des Abends nun bei einem weichen, Barrik gereiften roten Burgunder damit, die 14 Punkte Wilsons im Einzelnen durchzusprechen, nein eher fein säuberlich zu sezieren, und anschließend aufgrund meines Berichtes über das Treffen mit Kronprinz Wilhelm ein durchaus widersprüchliches Persönlichkeitsprofil des Präsidenten anzufertigen. Meine beiden Freunde neigten zuerst wenig dazu, zwischen den Zeilen des Wilsonsschen Textes zu lesen. So verwarfen sie in Bausch und Bogen die Forderungen zu Elsass-Lothringen und Polen. Darin dürfte sich ihre Einschätzung mit derjenigen von 98 Prozent aller Deutschen gedeckt haben – mindestens. Ich warb vorsichtig dafür, an die Aufnahme dieser Aspekte in London, Paris und Warschau zu denken. Wilson und sein außenpolitischer Chefberater Oberst House sähen sich schließlich gezwungen, eine Gratwanderung zu bestehen. Ihre Formulierungen müssten dazu geeignet sein, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu ziehen. Und sie müssten erst in der Zukunft sich als so flexibel erweisen, je nach militärischer Lage mehr dem einen oder dem anderen entsprechen zu können. Walther Rathenau kommentierte dies nur lakonisch mit dem Hinweis: „Diplomatisch hast du mir immer noch einiges voraus, lieber Gustav.“
Was Kronprinz Wilhelm angeht, so war es zunächst meine Aufgabe, ausführlich über unsere Unterredung zu berichten und meine Meinung dazu abzugeben, wie verlässlich der Kronprinz in Zukunft denn wohl sein werde, sobald es zur Nagelprobe käme und er seine mir gegenüber gemachten Zusagen einhalten solle. Albert Ballin äußerte sogleich die Befürchtung, Wilhelm werde sich wie schon manches Mal als Parteigänger von Ludendorff und Stinnes erweisen. Ich solle nicht allzu enttäuscht sein, falls er sich in der Zukunft – nachdem ich meine Pflicht und Schuldigkeit erfüllt haben würde – an seine Zusagen nicht mehr Wort für Wort gebunden fühlte.
„Eintreten kann selbstverständlich beinahe alles. Und naiv zu sein hat sich im politischen Geschäft schon viel zu oft gerächt. Trotzdem lasst mir meinen Funken an Glauben daran, dass in meinem persönlichen Verhältnis zu seiner kaiserlichen Hoheit mit dem Gespräch zum Jahresbeginn eine Veränderung eingetreten ist. Unser Vertrauen zueinander ist gewachsen. Es hat eine Tiefe, eine Qualität, eine Ehrlichkeit erreicht, dass wir uns trauen einander fest in die Augen zu sehen und dann auch über ungemütliche Wahrheiten zu sprechen. Wenn ich ihm nicht abkaufen würde, dass er mit seinem hohen Namen für die Wahlrechtsreform einstünde, fehlte mir ein wichtiger innerer Kompass für die großen Ereignisse, die noch vor uns liegen.“
Meine etwas theatralische Erklärung rief kurzzeitig betretenes Schweigen hervor. Doch dann öffnete sich das Abendgespräch plötzlich zu privaten Themen. Mich interessierte sehr, wie es Alberts Sohn Thorsten an der Westfront ergehe. Der stolze Vater stellte seine Gedanken über die Lebensgefahr zurück und schilderte begeistert, was unser Reich für eine phantastische Jugend habe. Für sie lohne es sich zu kämpfen und dann Frieden zu schließen. Ich erinnerte mich der hübschen schwarzhaarigen jungen Dame, die Thorsten beim Ball am Tag von Sedan im Berliner Schloss zum Tanz aufgefordert hatte und wünschte ihm, sie wiederzusehen, insbesondere aber nach dem Kriege noch ein langes, erfülltes Leben führen zu dürfen.
Am 16. Februar trat das von Oberst Bauer mir bereits zuvor enthusiastisch angekündigte Ereignis in Brest-Litowsk ein, von dem eine Beschleunigung der Ereignisse ausgehen musste: Das Deutsche Reich kündigte den Waffenstillstand vom Dezember für den 17. Februar 1918 auf. Tatsächlich begann an jenem Tag sogleich der erneute deutsche Vormarsch. Im Baltikum wurde innerhalb weniger Tage die Grenze zwischen den Provinzen Estland und Livland einerseits, Russland andererseits erreicht. Dann ließ General Hoffmann den Vormarsch stoppen. Das signalisierte allen politischen Kräften Russlands, aber insbesondere Lenin: Das Deutsche Reich beabsichtigt nicht die Einnahme von Petrograd, als derjenigen der beiden Hauptstädte in Frontnähe. Der Revolutionsführer der Bolschewiki durfte und sollte das sehr wohl in dem Sinne auffassen, dass unser mächtiges Reich eben nicht den Sturz der Regierung oder ein unmittelbares Eingreifen in die inneren Verhältnisse Russlands plane. Ganz nebenbei kamen wir damit sogar gleichzeitig den Anforderungen aus Wilsons 14 Punkten Russlands innere Verhältnisse betreffend nach.
Im Süden der Front dagegen drangen die deutschen Truppen tief in die völlig von russischen Truppen entblößte Ukraine vor. Der Vormarsch benötigte nur wenige Tage. Bereits am 20. Februar erreichten die deutschen Angriffsspitzen die am 9. Februar im Separatfrieden mit der Volksrepublik Ukraine von Deutschland garantierte Ostgrenze zu Russland. Diese verlief durch den Osten des steinkohlereichen Donezkbeckens und schloss auf westlicher Seite durchaus Gebiete mit ein, die hohe ethnisch russische Bevölkerungsteile enthielten. Das war einerseits im Interesse der deutschen Schwerindustrie, die Wünsche nach Investitionen in die Donbaz genannte Region anmeldete. Andererseits fiel es der Reichsregierung leicht, eine antibolschewistische ukrainische Regierung gegen die neuen Machthaber in Moskau und Petrograd zu unterstützen. Schon am 18. Februar berieten sich die Revolutionsführer Lenin und Trotzki in Petrograd. Sie müssen wehmütig konstatiert haben, dass Leo Trotzki einer folgenschweren Fehleinschätzung unterlegen war, als er im Januar und Anfang Februar nicht mit dem erneuten Vorrücken der deutschen Truppen gerechnet hatte. Sie müssen ebenso erschüttert konstatiert haben, dass ihre bisherige Taktik der Verzögerung endgültig gescheitert war und von nun an sich zur akuten Gefährdung des Revolutionserfolges auswuchs: Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen würde zur weiteren massiven Destabilisierung der inneren Verhältnisse in Russland entscheidend beitragen. Von hier war es nur noch ein kleiner Schritt bis zu der Entscheidung Lenins, sofort auf die deutschen Waffenstillstandsbedingungen einzugehen, an den Verhandlungstisch in Brest-Litowsk zurückzukehren und den Vertrag dann ohne weiteren Aufschub abzuschließen. Dem setzte sich in der Führung der Bolschewiki zwar Bucharin entgegen, doch Lenin räumte jeden Widerstand mit der Androhung seines eigenen Rücktritts von allen Ämtern aus. Lenin wurde in seiner Auffassung von der Richtigkeit seines Handelns auch dadurch bestärkt, dass die Deutschen augenscheinlich weiterhin keine Anstalten unternahmen, in die inneren Angelegenheiten Rest-Russlands einzugreifen und die bolschewistische Regierung abzulösen. Am 19. Februar erbat Russland bei den Mittelmächten Frieden. Diese setzten allerdings zunächst ihren Vormarsch fort, antworteten erst am 23. Februar und konfrontierten den wehrlosen Gegner mit folgender eindrucksvollen Forderung:
Räumung Finnlands, Estlands, Livlands und der Ukraine; Demobilisierung der russischen Armee; Verzicht auf jeden Einfluss in den genannten Gebieten sowie in den bereits seit 1914 von den Mittelmächten besetzen Territorien Polen, Litauen und Kurland, schließlich auch Georgien. – Die Bedingungen wurden von General Hoffmann kategorisch vorgetragen: Zwei Tage erhielt die russische Regierung Frist für eine Antwort. Nur drei Tage sollten in Brest anschließend für Verhandlungen zur Verfügung stehen. Die deutschen Forderungen wurden akzeptiert. Am 3. März 1918 war es schließlich so weit. Die Delegationen Russlands und der Mittelmächte, bestehend aus dem deutschen Verhandlungsführer und seinen Kollegen aus Österreich-Ungarn, Bulgarien und dem Osmanischen Reich, unterzeichneten den Friedensvertrag. Dieser hielt nunmehr die staatliche Selbstständigkeit Finnlands und der Ukraine fest, die militärische Oberhoheit Deutschlands über Polen, das Baltikum und Weißrussland bis zum Dnjepr. Die staatlichen Verhältnisse dieser Gebiete sollten – recht salomonisch formuliert – in Übereinstimmung sowohl mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker als auch mit den Interessen der Mittelmächte eingerichtet werden. Ich persönlich empfand diese Formulierung nicht allein als zynisch, so wie meine Reichstagskollegen Haußmann, Erzberger und Scheidemann das bezeichneten, sondern durchaus eher als geschickt gewählt, um Handlungsspielräume in späteren Verhandlungen mit dem Westen zu erhalten. Insbesondere würde das Deutsche Reich in die Lage versetzt, Teile der 14 Punkte Wilsons, so das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Vorschläge Russland betreffend, im Sinne einer eigenen Auslegung aufzugreifen und zur Maxime der eigenen, neuen Friedensordnung in Osteuropa zu erheben.
Unter der Bezeichnung „Friede von Brest-Litowsk“ ging derselbe in die Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. Er beendete die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs in Osteuropa und schuf die Voraussetzung dafür, auch den Krieg im Westen auf die eine oder andere Art und Weise zu beenden.
Nachdem die russische Regierung unter Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, am 19. Februar bei den Mittelmächten um Frieden nachgesucht und dies noch am selben Tag der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte, trafen am Morgen des 20. Februar auf der anderen Seite des Globus im Oval Office des Weißen Hauses in Washington die Präsidentenberater Edward House und Louis Brandeis mit Woodrow Wilson zusammen. Zufällig weilte auch der New Yorker Journalist und Verleger Walter Lippmann in der Hauptstadt. Wilson lud auch ihn für 11 Uhr zum zweiten Frühstück und zur Erörterung der neuen Lage in Europa ein. Das Sekretariat des Präsidenten hatte die Herren am Vortag kontaktiert und den Wunsch übermittelt, nach Möglichkeit jeden konfligierenden Termin hinten anzustellen. Derjenige, dem die Notwendigkeit dazu in Folge einer plötzlich dramatisch veränderten weltpolitischen Lage ohne jeden Zweifel einleuchtete, war der junge und etwas ungestüme Walter Lippmann.
„Mister President, haben sie herzlichen Dank für ihre freundliche und spontane Einladung zu diesem Gedankenaustausch im kleinsten und vertraulichsten Kreise. Ich war bereits entsetzt, als ich vor drei Tagen von der Schwungkraft des deutschen Vorrückens bis kurz vor Petrograd und in die gesamte Ukraine hörte. Lenin und Trotzki hatten keine andere Wahl als zu kapitulieren. Ein weiterer deutscher Vormarsch hätte sie sofort die Macht im gesamten Land gekostet, wenn der Feind vor den Toren Petrograds erschienen wäre. Für uns ist die Konsequenz daraus brutal: Die mächtigste Militärmaschinerie, über die ein einziges Land auf dieser Erde verfügt, wird jetzt vollständig im Norden Frankreichs zusammen gezogen, um uns, um die Entente bald anzugreifen.“
Der Präsident wiegt bedächtig nickend den Kopf.
„Die schwerste Bewährungsprobe steht der Entente in diesem Krieg tatsächlich noch bevor. Es wird mindestens so haarig wie im September 1914 werden. Brauchen wir vielleicht gar ein zweites Wunder an der Marne? Oder sind im Gegensatz zu damals die Armeen der Entente 1918 in der stärkeren Position, weil unsere amerikanischen Truppen längst in Millionenstärke auf dem europäischen Kriegsschauplatz erschienen sind? Von der Beantwortung dieser Fragen wird abhängen müssen, welche Optionen Amerika, England und Frankreich in den kommenden Wochen und Monaten ziehen werden.“
Edward House wirft ein:
„Aber auch, über welche Alternativen die zivile und die militärische Reichsleitung in Berlin nachdenken werden.“
„Die Briten und die Franzosen werden die Devise ausgeben: Nur weiter so! Mit der Hilfe der US-Boys wird die Front schon halten! Und dann bluten sich die Deutschen hoffentlich aus!“
Louis Brandeis rümpft die Nase und streicht sich mit dem Zeigefinger der rechten Hand darüber. Er blickt erst Wilson und dann House an. Beide erwarten von ihm, dass er fortfährt.
„Mit anderen Worten: Unsere Verbündeten legen ihre Priorität auf die militärische Option. Das tun sie jetzt schon seit fast dreieinhalb Jahren. Wirklich gebracht hat es bis heute nichts. Und das ist ja nicht wirklich einfallsreicher als die Großstrategie von Hindenburg, Ludendorff und Hötzendorff auf der gegnerischen Seite. Und ich meine: Wir Amerikaner sind nicht in diesen Krieg eingetreten, um einfach so weiter zu machen. Auch glaube ich, dass es die Frauen und Mütter unserer Jungs an der Front nicht ganz so stoisch ertragen können wie die Frauen in Europa, dass ihre Liebsten millionenfach verheizt werden. Meine Empfehlung lautet daher: Woodrow hat sich im Januar entschlossen, seine 14 Punkte vorzulegen. Also werden wir im Februar oder März nicht darauf verzichten, weiter die diplomatische Karte zu wägen, zu prüfen und auch tatsächlich zu spielen, sobald sich die Chance bietet, einen Frieden zu schließen, den wir tragen wollen. Das heißt jetzt vielleicht anders als am 8. Januar nicht mehr unbedingt, nur zu unseren Bedingungen abzuschließen. Denn diese Militaristen mit der Pickelhaube sind leider Gottes durch Lenin schon heute, nur sechs Wochen später, erheblich mächtiger geworden. Wir sollten mit Bedacht handeln, also vor allem nichts ausschließen und sehr wachsam dafür sein, ob vernünftige Friedenssignale aus Berlin ausgesandt werden.“
Oberst House hat Brandeis den Vortritt gelassen, obwohl doch er Wilsons erster Berater in außenpolitischen Fragen ist. Er hat richtig gehandelt, denn Louis Statement kommt House sehr zu Pass. Auch Oberst House ist wichtig, die diplomatische Option in jeder neuen Lage zu behalten. Etwas anders als Brandeis ist er allerdings nicht so pessimistisch anzunehmen, dass die Deutschen auf dem Schlachtfeld jetzt die Überhand gewinnen müssten.
„Ludendorff hat in der deutschen Presse getönt, er werde 80 Divisionen mit 1,5 Millionen Mann aus Russland abziehen. So viele US-Boys stehen inzwischen in Frankreich ebenfalls unter Waffen. Freunde, lasst uns nicht kleinmütig werden.“
Walter Lippmann zieht an seiner Pfeife und schlägt die Beine übereinander.
„Das stimmt, Edward, aber die Deutschen sind kampferprobt, haben in Russland an allen Frontabschnitten gesiegt und fügen sich bald voller Zuversicht in die Westfront ein.“
„Dafür sind unsere Truppen und vielleicht sogar auch die Briten besser mit Waffen und Munition ausgestattet und unsere Versorgung funktioniert besser. Damit steht es wahrscheinlich unentschieden, bevor die Offensive der Deutschen beginnt.“
Das Gesicht des Präsidenten spricht Bände. So sehr er den Ausführungen seiner engsten Berater in den einzelnen Aussagen beipflichten muss, ebenso sträubt er sich mit aller Kraft dagegen, vom Gestalter der 14 Punkte sehr flott zum Getriebenen der deutschen Obersten Heeresleitung zu werden.
„Unentschieden ist nicht unbedingt meine Wunschvorstellung davon, im neuen Jahr mit unseren Truppen erstmals so richtig in die Kampfhandlungen einzugreifen. Die Vereinigten Staaten sind nach Europa gefahren um zu gewinnen. Deshalb werde ich eines auf keinen Fall einleiten, nämlich mit meinem Punkteplan 14 kleine Negerlein zu spielen: Im Februar waren es nur noch 13, im März werden es dann nur noch 12 sein, und so weiter!“
„Aber Woody! Das verlangt doch hier überhaupt keiner von dir.“
Louis Brandeis springt seinem Freund Edward House zur Seite, als er spürt, dass es eng werden könnte, sollte der Präsident nach seinem Bauchgefühl handeln.
„Ich denke mit viel Vergnügen daran, wie wir drei, Eddy, du und ich hier in diesem Raum saßen kurz nach Neujahr und uns tief schürfend, freundschaftlich, vertrauensvoll über die Weltlage unterhielten und über das diplomatische Umfeld für eine erfolgreiche Friedensinitiative. Wir haben dabei natürlich gehofft, dass die Briten Recht behalten würden mit ihrer Vermutung, dass der Krieg in Russland weitergehe. Aber, seien wir ehrlich, wir haben allesamt nicht so ganz daran geglaubt. Mehr als ein Mal fiel das Wörtchen Zweckoptimismus.“
„Und genau deshalb sind die 14 Punkte so schlau eingefädelt, dass sie den USA für beide Varianten des Kriegsverlaufs alle Trümpfe in die Hand geben! Ich kann das ja sagen, ohne je in den Verdacht zu geraten, persönliche Eitelkeiten zu befriedigen. Denn zu meinem eigenen Bedauern war ich ja bei ihrer Runde nicht dabei, sondern lediglich telefonisch beteiligt.“
Walter Lippmanns Zwischenbemerkung zwingt Woodrow Wilson ein leicht gequältes Lächeln in die Gesichtszüge. Recht geben muss er Lippmann und Louis schon. Doch der Ärger und die Enttäuschung sitzen tief in ihm, dass er, Präsident Wilson mit seinem Friedensprogramm nicht wie Phönix aus der Asche steigt, dass er die Deutschen eben nicht dazu zwingen kann, eine Großoffensive der Entente in Nordfrankreich nur noch dadurch abwenden zu können, dass sie in Verhandlungen eintreten. Stattdessen bekommen der Kaiser, Hindenburg und Ludendorff, diese Militaristen mit Zwirbelbärten und Pickelhauben 70, 80 Divisionen im Osten frei und bedrohen damit unsere Stellungen an der Marne, an der Somme oder in Flandern. - Scheiße! Diesen Gedanken behält Wilson schön für sich. Er empfände es als eine ungeheure Blöße, wenn er seiner Enttäuschung gegenüber seinen Freunden und Vertrauten Eddy und Louis derart freien Lauf ließe. Stattdessen reflektiert der Präsident seine für Sekunden im Ernst erstarrte Miene und lässt diese ganz sanft in entspannte Freundlichkeit übergehen.
„Vielleicht fiel mein erstes Urteil eben zu harsch aus, meine Freunde. Eddy erinnert natürlich zu recht daran, dass wir für alle Eventualitäten des Kriegsjahres 1918 gewappnet sein wollten. Die außenpolitische Professionalität, ein wenig sogar die intellektuelle Distanz gegenüber unseren Hauptverbündeten in London und Paris gebot es, sich Spielräume zu verschaffen, die zuvor weder die Kriegsziele der Entente noch die Kriegsziele der kaiserlichen Regierung eröffneten. Ich möchte mir lediglich die persönliche Bemerkung erlauben, wie viel mehr Vergnügen es mir bereiten würde, das Geschäft der Diplomatie aus einer Position der militärischen Stärke heraus zu betreiben.“
Oberst House fällt ein Stein vom Herzen, als er seinen Präsidenten so reden hört. Er möchte die Gelegenheit gleich beim Schopfe ergreifen und einen ersten Anlauf unternehmen, Woodrows 14 Punkte unter den neuen Bedingungen einmal flexibel durchzuspielen.
„Woody, es gibt in Berlin ja nun auch ein paar schlaue Leute ohne Zwirbelbärte. Ich erinnere mich noch an Louis´ Bericht über seine Informationen vom britischen Generalkonsul Lord Melroy in New York. Was ich mir wünschen würde ist, dass der Reeder Albert Ballin aus Hamburg, der Großindustrielle Walther Rathenau aus Berlin, am besten auch noch der Chemie-Gigant Carl Duisberg aus Leverkusen, so einem Arbeiterdorf bei Köln, und der Vorsitzende der Nationalliberalen im Reichstag sich zu einer ähnlich vertraulichen Runde wie wir hier in Washington in der deutschen Reichshauptstadt treffen. Sie freuen sich über den deutschen Sieg über Russland und sinnen auf ein Ende des Krieges auch im Westen. Sie wissen aber zugleich, dass die Lauthälse der deutschen Elite: Hugenberg von Krupp, Ludendorff von der Heeresleitung, der Kronprinz und Admiral Tirpitz, alle nur die Maximalforderungen im Kopf haben, deretwegen sie im Juli 1917 Bethmann-Hollweg in den Ruhestand geschickt hatten. Also gehen sie ihre Wünsche und Forderungen für eine Deutschland genehme Nachkriegsordnung durch:
Da ist dann der Mitteleuropäische Zollverein, der jetzt natürlich von Belgien bis in die Ukraine reicht. Da ist die Oberhoheit über die Polen und die Balten, indem der Kaiser vielleicht sogar König von Polen wird. Und dann verlangen sie von Frankreich bestimmt ein paar Kolonien. - So weit, so schlecht und nichts wirklich Neues.
Dann aber kommen die politisch erfahrenen Köpfe Stresemann und Rathenau auf die Idee und auf den Punkt, für die Durchsetzbarkeit der deutschen Ziele nicht mehr nur an eine siegreiche Westoffensive zu denken, sondern an - na was glaubt ihr? - an Woodys 14 Punkte!“
„Eine phantastische Idee, Eddy. Sollte es solch ein Gespräch mit den von dir genannten oder auch anderen, ähnlich hoffnungsvoll stimmenden Teilnehmern in Berlin wirklich dieser Tage geben, ja dann müssten wir genau das Gleiche tun: Wir hecheln Woodys 14 Punkte ganz akribisch, ganz emotionslos und von allen Seiten betrachtet durch.“
Louis Brandeis hat Oberst House Gedankenspiel mit großer Begeisterung aufgegriffen. Doch viel wichtiger ist, dass es auch den Präsidenten nicht kalt lässt. Wilson beugt sich in seinem Sessel vor und hebt den rechten Zeigefinger.
„Wir sollten vielleicht das mal versuchen: Unter den herrschenden Machtverhältnissen hier und heute, ich meine mit einem deutschen Diktatfrieden gegenüber Lenin, gestalten wir jeden einzelnen meiner 14 Punkte ganz kurz danach aus, was wir darunter verstehen und damit erreichen wollen. Und dann wechseln wir den Standpunkt. Wir fragen uns, was die Deutschen in einem Friedensvertrag durchsetzen wollen. Dabei meine ich aber eben nicht die Militaristen und Imperialisten des Kaisers, sondern einflussreiche Leute im Umfeld der Regierung. Ich meine diejenigen, die vielleicht wie wir darauf warten, dass in den nächsten Monaten der Moment kommen mag, in dem nicht mehr nur die Waffen über die Zukunft Europas entscheiden sollen.“
„Dass es hier bei ihnen so spannend werden würde, habe ich nicht im Traum gedacht, Mister President.“
Lippmann macht einen Scherz darüber, welche Sensation es bedeutete, falls der eben von Wilson und House entwickelte strategische Ansatz morgen in seiner Zeitung stünde. Louis Brandeis lacht laut auf und gibt mit einem strahlenden Lächeln zurück:
„Ja dann, lieber Walter, würdest du dich nächste Woche sicher auf einem unserer Schiffe wieder finden, die unsere US-Boys nach Frankreich hinüber fahren.“ Darüber muss auch der Präsident lachen.
„Gute Idee Louis, das merke ich mir für alle Dilettanten, aber mehr noch für die nun wirklich anstrengenden und lästigen Arroganzpinsel von den Republikanern hier in Washington, die unsere Friedenspolitik in den kommenden Monaten zu Fall bringen wollen.“
Im weiteren Verlaufe des Abends ist es wie schon am 3. Januar Edward House, der die Rolle des kreativen Schriftführers übernimmt. In Windeseile landen Notizen auf seinem Block. Er beginnt eine Seite mit der Überschrift „Wir“, auf der nächsten Seite steht einfach nur „Berlin“. Oberst House beginnt seine Aufzeichnungen auf der zweiten Seite. Dort steht nach einer weitere zwei Stunden währenden, ebenso angenehmen wie intensiv und engagiert geführten, dabei immer schonungslos offen ausgetragenen Diskussion:
1. Öffentliche Verträge: DR wird bereit sein, seine Herrschaft über Osteuropa offen zu legen, wenn wir uns beim Selbstbestimmungsrecht einigen. Lösung?!: Personalunion des Kaisers mit Polen und Baltikum; Bündnis aller neuen Staaten mit DR; ebenso Mitgliedschaft in Zollunion
2. Freiheit der Schifffahrt: DR will Flotte behalten; erreichbar bei Lösung zu 3.
3. Freier Handel: DR wird niemals auf Zollunion in Europa verzichten; Lösung für USA nur durch Kompensation zumutbar: Öffnung der Kolonialreiche gegen Öffnung Mitteleuropas.
4. Beschränkung der Rüstungen: Keine Zustimmung! Vielleicht Quoten möglich: Heer DR nicht größer als GB + F; Flotte DR mindestens 50 % GB - aber nur, wenn wir uns auch binden!
5. Kolonialer Ausgleich: Belgisch-Kongo, Marokko, Mesopotamien, Teilung portugiesischer Kolonien; abhängig von 7 + 8 - Belgien und Elsass-Lothringen.
6. Räumung Russlands: Für DR erledigt mit Brest-Litowsk; Frage, ob DR innere Selbstbestimmung gegen äußere Anlehnung und Bündnis bietet?
7. Belgien: Verzicht auf Annexion; äußere Anlehnung an DR Ziel; vielleicht militärische Neutralität bei Teilhabe an Zollunion?
8. Elsass-Lothringen: Rückgabe indiskutabel; Volksabstimmung in ethnisch strittigen Dörfern das Äußerste - vielleicht höchstens gegen wirtschaftlichen Einfluss auf Longwy / Briey.
9. Italien: Volksabstimmungen oder Expertenkommissionen denkbar - gegen Kompensation für ÖU auf dem Balkan.
10. ÖU: Innere Autonomie möglich; als Gesicht Wahren für Kaiser und Woodrow.
11. Balkan: ethnisch korrigierte Grenzen nur gegen Bündnis mit ÖU und DR.
12. Türkei: Innere Selbstbestimmung für arabische Völker; Gebietsverzicht in Arabien, südlich Kleinasiens nur bei Deal zwischen DR - GB möglich.
13. Polen: Grenze von 1914 für DR unantastbar; Osterweiterung Polens nach Ruthenien, Galizien bei Einfügen in deutschen Machtbereich.
14. Verband der Nationen: Kein Verzicht auf das Recht auf Krieg für die Mitglieder; Sonderrechte für Weltmächte.
Der Präsident hatte Oberst House am Abend dazu aufgefordert, das Blatt - aus dem inzwischen zwei geworden waren - mit sämtlichen Stichworten langsam und bedächtig vorzulesen. Gemeinsam mit Louis Brandeis und Walter Lippmann lauschte er still, beinahe andächtig der sonoren Stimme seines außenpolitischen Chefberaters. Etwas skeptisch kniff er, als Edward House geendet hatte, seine Lippen aufeinander und wiegte leicht den Kopf.
„Ein paar ganz schön harte Nüsse hast du uns da in das Hausaufgabenheft geschrieben, lieber Eddy. Doch ich bin froh darüber, dass wir für die Politik der USA einige sehr passende Antworten auf Deutschlands Weltmachtpolitik finden konnten. Das brauchst du uns aber nicht auch nochmals vorzulesen. Darauf werden wir bestimmt schon sehr bald wieder zurückgreifen.“
Der Präsident wirkt sehr nachdenklich. Doch sein Gesicht strahlt Ruhe und Zuversicht aus, als sei es seine Aufgabe stellvertretend für sein gesamtes Land ein Zeichen zu setzen und dort die innere Moral zu festigen.
„Freunde, ich sage euch: Es wird ein sehr spannendes Jahr 1918 werden. So ein Jahr hat die Welt noch nicht erlebt!“