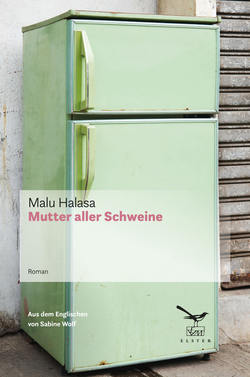Читать книгу Mutter aller Schweine - Malu Halasa - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеZwei Männer stehen neben einem Lastwagen und feilschen lautstark. »Jetzt entscheiden Sie sich mal«, poltert der größere und wesentlich ältere der beiden, ein Mann mit Halbglatze und Höckernase. Seine Schultern hängen herab wie Flügel, und er schlägt aufgeregt mit den Armen. Dünn, drahtig, streitlustig – eher Aasfresser denn Singvogel – hüpft er in kaum unterdrückter Erregung auf und ab. Der Blutdruck erhöht, die Klauen ausgefahren, macht er sich zum entscheidenden Hieb bereit. Er schwingt sich auf – und lässt sich wieder zu Boden trudeln, weil er genau merkt, dass er beobachtet wird. Der Hase muss nicht wissen, wann der Falke zuschlägt, denkt Abu Satar und scheucht seinen Fang hinein ins Schnäppchen-Emporium. Sein Nest muss fortwährend mit frischer Beute versorgt werden. Nicht umsonst trägt er den Spitznamen Ar-Risch Aschanah, der Fledderer.
Nachdem das Geschäft abgewickelt, der Fahrer abgefertigt und die kostbare Ladung Kisten (im Grunde Plunder, Elektroteile und getragene T-Shirts der US-Armee) in einen Lagerraum geschafft ist, ärgert sich Abu Satar, dass er sich immer so aufregt. Andere Männer in seinem Alter entspannen bei Backgammon oder Kreuzworträtseln. Er unternimmt häufig Streifzüge durch die Schluchten seines Imperiums, wie jetzt gerade, nur mit Staubwedel und Mikrofasertuch bewaffnet, eine kurze Erholung von den stumpferen Freuden des Lebens. Diese Expeditionen erinnern ihn auch schlicht daran, dass seine kostbarsten Besitztümer, viele davon vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, einen Wert jenseits von Geld haben.
Die Lagen über Lagen von Küchenutensilien, die importierten Lebensmittel (hauptsächlich aus Asien), Sport-, Freizeit- und Konfektionskleidung – für Herren, Damen, Kinder, Babys und Neugeborene –, absurd hohe Stöckelschuhe und fußbett-marternde Turnschuhe, Deko für sämtliche Feiertage, egal ob islamisch (schiitisch, sunnitisch, drusisch, alawitisch und ismailitisch), christlich (syrisch-christlich und syrisch-katholisch, griechisch-orthodox, armenisch, maronitisch und phalangistisch) oder heidnisch (jesidisch, zoroastrisch, druidisch) sowie alle großen Namen dazwischen (von Buddha bis Bhagwan); synkopische Türklingeln, chinesische Scherenschnitte, Hotel-Hosenbügelmaschinen, analoge Telefone, elektrische Schuhputzautomaten und Designer-Nagellacke: zusammen mit tausend anderen erstaunlichen Produkten und Gerätschaften weitaus mehr als ein Sammelsurium unzusammenhängender Artefakte. Würde ein Passant durchs Fenster blicken, man sähe es ihm nach, wenn er das Schnäppchen-Emporium für eine postmoderne Verirrung der Art brut hielte. Gegenüber Erstkunden betont Abu Satar gerne, dass nur er allein einen Artikel aus dem Berg von Waren ziehen könne, denn es bestehe akute Lawinengefahr.
Früher betrachtete Abu Satar das Emporium als ein Denkmal seines Daseins auf der Erde; eines Tages, wenn die Zeit für ihn gekommen wäre, würde es aufgelöst, auf eine Deponie geschafft und vergessen werden. Doch dank Umm al-Chanasir, der Mutter aller Schweine, hat er die feineren Aspekte seines Geschäftes zu schätzen gelernt. Heute betrachtet er das Schnäppchen-Emporium als ein unvollendetes Projekt, bei dem es gar nicht unbedingt um ihn selbst geht, sondern das organisch gewachsen ist und einem universellen Zweck dient. Während er Regale abstaubt, debattiert der Fledderer aufgebracht mit seinen imaginären Kritikern. Falls ihn jemand fragen sollte, er würde darauf pochen, dass es ihm um Fortschritt im weiteren Sinne geht. Niemand sonst in der Stadt hat sich so sehr in den Dienst des Gemeinwohls gestellt, selbst wenn das bedeutet, ein abergläubisches Völkchen in die Gegenwart zu schubsen. Ob er nun richtig oder falsch, politisch korrekt oder zutiefst beleidigend handelt, er ist und bleibt ein APW – ein Agent des Progressiven Wandels –, Buchstaben, die auf dem Neonschild an der Emporiumsfassade hinter seinem Namen stehen sollten wie ein Abschluss der Universität des Lebens.
Das heißt, wenn er sich nicht gerade von Nostalgie verführen, überfallen oder gleich ganz niederstrecken lässt. Nicht zufällig landet er bei seiner Inventurrunde durch die verschlungenen Gänge an einem sehr privaten Ort. Er nimmt den winzigen Schlüssel, den er immer und ausnahmslos in der Hosentasche trägt, und öffnet eine gesicherte Glasvitrine voller Schmuck, sein mit gutem Grund so genanntes »Diebesnest«. Seit dem Krieg in Syrien rennen ihm schöne Flüchtlingsfrauen die Türen ein, weil sie unbedingt ihr Gold verkaufen wollen. Doch der Ankauf dieser Stücke beschert Abu Satar nicht mehr die Gefühlsschauer von einst. Seine aktuelle Geschäftsunternehmung mit seinem Neffen zehrt so ziemlich all sein Wollen und Begehren auf. Da wird ihm klar, nicht ohne einen Hauch bittersüßen Bedauerns, dass er gar kein Verlangen mehr verspürt, sich mit pflanzlichem Viagra aufzuputschen.
Trotz seines offenkundigen Desinteresses zeigen sich die Frauen in ihrer Verzweiflung doppelt hartnäckig, ihm ihren Schmuck zu verkaufen, und so hat er ein paar recht beachtliche Stücke zu Spottpreisen erstanden. Sein Blick gleitet über das stattliche Vermögen im Diebesnest, diese Flut von Armbändern, Broschen, Halsketten, Hutnadeln, Kamel-Manschettenknöpfen, einzelnen antiken Perlen und einer schönen Auswahl an filigranem Silber und Gold. Er mustert den Haufen Glitzerkram, und doch entzieht sich ihm, was er so verzweifelt sucht. Grob reißt er die Lupe hoch, die er an einer Kette um den Hals trägt, und schielt gereizt hindurch. Sein rastloser Zeigefinger stochert in dem geheimen Schatz herum und schnipst ungeduldig eine einzelne Visitenkarte beiseite, falls sich darunter weitere Schmuckstücke verstecken sollten.
Als er endlich die kaputten, angelaufenen Ohrringe mit Schnörkelmuster ausgräbt, fühlt er sich fiebrig. Er drapiert ein klobiges Goldhalsband mit rosaroten Rubinen als Schutz und Tarnung über die beiden einfachen Metallplättchen, die überirdisch leuchten, wie jenes schlanke palästinensische Flüchtlingsmädchen in Abu Satars vager Erinnerung. Sie hatte ihm den billigen Schmuck verkaufen dürfen, und für den Gefallen hatte er ihr einen hohen Preis abverlangt. Es war sein erstes Schnäppchen dieser Art, umso befriedigender aufgrund seiner Unschuld wie auch ihrer, allerdings ist ihm das gar nie in den Sinn gekommen. Abu Satar lässt die Lupe sinken, dann schließt und verriegelt er vorsichtig die Glasvitrine. Er blickt auf und lässt das Schnäppchen-Emporium auf sich wirken. Trotz seiner lebenslangen, harten und hingebungsvollen Arbeit kann er selbst kaum glauben, wie all dies seinen Anfang nahm: als ein Brett unter einer Markise, ein an vier Stangen geknotetes Stück Stoff. Der Stand hatte damals nur einen einzigen Zweck: die getrocknete, mit etwas Sesamstaub besprenkelte Thymian-und-Sumach-Mischung zu verkaufen, die der Familie Aufgabe und Namen verlieh: Satar. Dank ein paar bröseliger Blätter, Körner und einer geheimen magischen Zutat – Hanfsamen, denen Abu Satar seine eigene Neigung zu Träumereien zuschreibt – entwickelte sich der Zeltstand schließlich zu einem gedrungenen Gebäude an einem immer betriebsameren Trampelpfad.
Unter seinem Vater war der Dorfladen nie eine großartige Goldgrube gewesen. Hin und wieder bogen sich die Holzregale unter jemenitischen Kaffeesäcken oder Baumwollgarn, das Wanderhändler über die Seidenstraße gebracht hatten. Doch meistens waren die einzigen ausgestellten Waren ein paar unbestimmbare, verkrumpelte Päckchen, die ungeöffnet auf einem der oberen Regalbretter blieben, sowie ein großes Fass Bratöl. Es war einfach eine Frage von begrenztem Angebot und noch begrenzterer Nachfrage. Für alles Unwesentliche blieb nur sehr wenig Geld übrig; was die Bauern nicht selbst auf dem Acker produzieren konnten, darauf verzichteten sie in der Regel.
In der Generation seines Vaters waren drei Eigenschaften sehr viel wichtiger als die Frage, wie viele Schafe und Ziegen ein Mann besaß. Zuallererst kam die Ehrbarkeit. So betrachtet war der Händler schon durch seinen Beruf gehandicapt, der in der strengen sozialen Hierarchie einen der unteren Ränge belegte. Ganz oben thronten die Nomaden, die stolz und edel wie von alters her das Land durchstreiften. Als Nächstes kamen all jene, die Felder bestellten und Tiere hielten. Sie bildeten die Untergrenze des Akzeptablen. Unter den Bauern standen die madanijin, Stadtmenschen, die sich von modernen Erfindungen hatten verführen lassen und ihre Bindung an die Erde verloren. Dann, nur ein Stückchen über Wahrsagern, Prostituierten und Dieben, kam die Schicht der Kaufleute, die volkstümlich als nasabin verdächtigt wurden, Gauner und Spitzbuben.
Trotz der allgemeinen Neigung, jemanden wie ihn gleich gänzlich abzulehnen, verwandelte Abu Satar der Ältere einen Ort spärlichsten Handels in eine Stätte der Begegnung. Zum Nebenerwerb schrieb er Briefe, und auch Kaffeekanne und Argileh hielt er stets griffbereit. Wenn gerade keiner der Männer zum Wasserpfeiferauchen zugegen war, bat Abu Satar die Dorfjugend in den Laden. So wuchs eine ganze Generation heran, deren Kindheit geprägt war durch den süßen Geschmack gebrannter Pistazien zum Klang von Tahiya Kariokas blechernem Orchester aus einem alten Grammofon. Dies endete schlagartig, als der Vater 1947 starb und der Laden an seinen halbwüchsigen Sohn überging.
Satar ibn Satar war nach seinem Vater benannt worden und hatte wiederum seinen Erstgeborenen nach sich selbst benannt. Die sozialen Gepflogenheiten verlangten somit, dass dieser Abu Satar heißen müsse – Vater des Satar. Der Ausdruck verdeutlichte den Stellenwert männlicher Erben und sollte Würde und Verantwortungssinn vermitteln, doch Fadhmas Bruder behandelte den Namen wie einen Scherz. Er sagte gerne, er sei sein eigener Vater, ein Selfmademan im wörtlichen Sinne. Für vieles fand er Zeit, jedoch nicht für die sozialen Nettigkeiten seines Vaters. Gleich zu Anfang, als er das Geschäft übernahm, widmete er sich mit ganzem Herzen dem Streben nach Profit. Unter den gegebenen Umständen war das leichter gewollt als getan, doch er ließ sich nicht entmutigen. Er beendete das informelle Kreditsystem seines Vaters und machte sich tatkräftig daran, offene Rechnungen begleichen zu lassen, von denen manche jahrzehntelang unbezahlt geblieben waren. Nichts von alledem machte ihn bei den Nachbarn sonderlich beliebt.
Es war keine Frage des blinden Glaubens. Abu Satar war ein Mann weitreichender Interessen. Er studierte die Zeitungen, die als Packmaterial in den Laden kamen. Auch wenn die Zeitungen sechs Monate alt waren, strich er sorgsam jede Seite glatt und vertiefte sich stundenlang darin. Seine so gewonnenen Kenntnisse des Zeitgeschehens bestätigten ihm, dass seine Aufgabe nicht unmöglich war. Erfolg in der Welt hing von der Haltung ab. Er musste nur aus allem, was sich ihm anbot, den eigenen Vorteil ziehen.
Er brauchte nicht lange zu warten. Alles begann vor einer Ewigkeit während einer jungfräulichen Begegnung mit palästinensischer Unschuld. Als dann die Flüchtlinge in das abgelegene Bergdorf strömten und Aufnahmelager eingerichtet wurden, legte die internationale Hilfskarawane den Geschäften vor Ort nahe, sich an der Versorgung zu beteiligen, und so wurde dem Laden mehr als hier und da ein Sack Maismehl gespendet. 1958, zehn Jahre später, als der irakische König Faisal der Zweite hingerichtet wurde, kam wieder alles durcheinander. Libanon steckte mitten in seinem ersten Bürgerkrieg, und gemeinsam mit der syrischen Baath-Partei gründete der charismatische Gamal Abdel Nasser die Vereinigte Arabische Republik. Abu Satar war genau die Sorte von heißblütigem jungem Mann, den der panarabische Nationalismus eigentlich hätte ansprechen müssen, doch sein Herz war bereits von der freien Marktwirtschaft erobert. Seit er in Hollywood-Schwarz-Weiß-Filmen Kühlschränke mit automatischer Innenbeleuchtung gesehen hatte, war er für immer verloren. Als die Briten dem halbwüchsigen König Hussein nach dem Attentat auf dessen Großvater König Abdallah ihre Unterstützung zusicherten, zeigte Abu Satar sein Wohlgefallen, indem er im ganzen Laden Union Jacks mit dem Slogan Keep Calm and Have some tea aufhängte. Es dauerte nicht lange, bis er zum Nutznießer einer weiteren unerwarteten Zuwendung wurde: einer beträchtlichen Investition in Jordaniens Infrastruktur durch die im Sues-Debakel in Verruf geratenen westlichen Länder. Ihre Kapitalisierung aller arabischen Staaten – außer Ägypten – führte zum Bau neuer Straßen, die das Dorf mit dem Rest des Landes verbanden und einen verstärkten Handel bis hinunter zum Golf von Akaba und dem Roten Meer ermöglichten. So wurden die ersten Maschen von Abu Satars grenzübergreifendem Netzwerk geknüpft und die Grundsteine eines Traumes gelegt, der erst noch geboren werden sollte: das Schnäppchen-Emporium.
Alle zehn Jahre brachte ein weiterer politischer Umbruch Abu Satars Kasse zum Klingeln. Der »Rückschlag« des desaströsen Krieges von 1967, die Naksa, wurde von vielen als bittere Niederlage empfunden. Doch für den allzeit wachsamen Händler bedeutete er einen unerwarteten Aufschwung. Zweifelsohne hatte sich sein Land austricksen lassen, als es sich an diesem kolossalen Unglück beteiligte. Die Kampfjets, die ein leichtgläubiger König über dem Westjordanland sah, waren keine ägyptischen, wie vom hitzigen Nasser versprochen. Innerhalb von 144 Stunden hatte Jordanien das Westjordanland und Ostjerusalem verloren. Doch ob durch Sieg oder Niederlage, in einer solchen Größenordnung brachte jeder Regierungswechsel Schmuggelware wie am Fließband. Selbst wenn die Waren vom anderen Flussufer durchweicht und voller Schnecken ankamen – alles wurde verwertet und im Laden ausgestellt. Um die schiere Menge zu bewältigen, erweiterte Abu Satar das Geschäft um einen labyrinthartigen Anbau. Doch Jordaniens politische Niederlage forderte ihren eigenen Preis.
1970 explodierte der Militarismus im Land wie ein Dampfkochtopf. Im Verlauf des Schwarzen Septembers – ein weiterer Euphemismus für einen Putschversuch und Bürgerkrieg – wurden zwanzigtausend palästinensische Fedajin aus dem Land verjagt, während ihre Familien blieben. Überall vermutete man Spione, und nebenan in Syrien häuften sich Berge von Waffen an, von denen es ein paar ausgesuchte Exemplare bis ins Emporium schafften. Der nächste Konflikt kam drei Jahre später und wurde nach religiösen Feiertagen benannt, je nach Zugehörigkeit Ramadan – auch Tischrin – oder Jom Kippur. Als die Golfländer in die Frontstaaten gegen Israel investierten – Jordanien zählte nicht dazu –, waren Abu Satars einziger Gewinn syrische Baumwollunterwäsche in Übergrößen und schlecht sitzende T-Shirts.
Abu Satar wendet sich wieder seinen Putzpflichten zu, wedelt eifrig zwischen Kleiderstangen Staub und steht irgendwann vor einem kurzen Regenmantel von Yves Saint Laurent und einer Kartonpyramide echter Charles-Jourdan-Schuhe. Wenn Krieg das Emporium zu dem gemacht hat, was es heute ist, dann hat keiner so viel dazu beigetragen wie der Libanesische.
»Was für ein Gezänk …«, murmelt der Händler schmunzelnd. Er weiß nicht mehr, wann genau ihm seine Theorie zu Nationalität und Konflikt gekommen ist, aber es muss während der fünfzehn Jahre des Libanesischen Bürgerkriegs gewesen sein. Es stimmte damals und es stimmt noch heute: Was wirklich in einem Volk steckt, erkennt man weniger daran, aus welchen Gründen es kämpft, als daran, was es alles verkauft, um weiterzukämpfen. Der IS mag viel Öl besitzen und fanatisch brutal sein, doch die Überbleibsel seines Kalifats sind nichts verglichen mit einer Weltklassehauptstadt wie Beirut, deren ausrangierte Kleidungsstücke allein ausgereicht haben, um kleinere arabische Ökonomien quasi jahrzehntelang anzutreiben.
Während Abu Satar die Plastikhülle um einen Kleiderständer zurechtzupft, überkommt ihn eine Welle der Zuneigung zu seinem besten Freund Hani. Sie kennen sich seit der Zeit der palästinensischen Flüchtlingslager. Als Hani damals mit den Kämpfern Jordanien verließ, war er noch ein Jugendlicher; ein Jahrzehnt später stand er dann plötzlich in Abu Satars Laden, von Kopf bis Fuß mit Klunkern behängt. Als Vermittler von Gütern und Dienstleistungen für einen General der Fatah verfügte Hani über einen Mercedes, einen Fahrer und eine rumänische Geliebte.
Vor allem aber stieß Hani im Tausch gegen harte Währung Schwarzmarktartikel frisch von der Rue Hamra ab. Häufig legte er eine Fuhre nachgemachter Louis-quatorze-Möbel als kleines Schmankerl obendrauf. Abu Satars Gewinn aus seinem so erweiterten Inventar ermöglichte ihm eindrückliche Umbauten der Geschäftsräume. Seine Familie zog um, von hinter der Gardine im Laden raus in die Splendid Isolation am Rande der wachsenden Stadt. Doch der größte Bonus war ein riesiger Stromgenerator, eine weitere Sonderzahlung seines besten Kumpels. Der Generator animierte Abu Satar zur Image-Umstellung und Elektrifizierung des frisch getauften Schnäppchen-Emporiums, dessen blinkende Leuchttafel noch bis ins All sichtbar ist.
Nach dem Ende des Libanesischen Bürgerkriegs fühlte sich Abu Satar lethargisch und deprimiert. Er fand, das Emporium habe schon bessere Zeiten gesehen. Da erwies ihm Saddam Hussein wie aus heiterem Himmel einen riesigen Gefallen, indem er in Kuwait einmarschierte. An der internationalen Koalition zur Bestrafung des irakischen Diktators beteiligte sich Abu Satars eigenes Land dankenswerterweise nicht.
»Ein kluger König ist zuallererst Unternehmer«, verkündet Abu Satar, obwohl niemand da ist, der ihm zuhören würde, und wedelt begeistert mit dem Mikrofasertuch. Während der über zehn Jahre währenden UN-Sanktionen überquerten Öl laster, befüllt mit dem schwarzen Gold Iraks, Jordaniens östliche Grenze und fuhren an Abu Satars kleiner Stadt vorbei, geradewegs die Straße der Könige hinunter, zum Golf von Akaba und in die weitere, Sanktionen sprengende Welt. Innerhalb eines Zwanzig-Meilen-Radius um den Schleichhandel wurden alle rund und dick.
Zwar ist Frieden nur selten so lukrativ wie Krieg, doch es wäre töricht, die kaum beachteten israelischen Lieferungen nach dem Friedensvertrag von 1994 zu übergehen. Wann immer in der Region Aufregung herrscht und jemand etwas schwer Erhältliches braucht, gilt Abu Satar mittlerweile als der Mann vom Fach. 2003, nachdem man Saddam Hussein in einem Loch gefunden hatte, steckte Abu Satar in einem Dilemma. Er fühlte sich nicht gerne reumütig – immerhin waren der Mann und sein Sohn Udai brutale Mörder. Doch seiner Meinung – und wichtiger noch seinen Bilanzen – nach war die angreifende US-Armee genauso schlimm und außerdem, um Salz in die Wunde zu streuen, ganz furchtbar autark. »Fertig-Dies, Fertig-Das!«, murmelt er missbilligend. Im Zuge ihres langen Wirkens im Irak flogen die Amerikaner ein, bauten auf, töteten, mordeten, vergewaltigten, und dann bauten sie wieder ab, packten zusammen und flogen weg, niemandem außer ihren Vertragsunternehmen zur Rechenschaft verpflichtet. Es blieben nur Müll und Chemiehalden zurück. Das erneute amerikanische Engagement im Irak gegen den IS verheißt dem Schnäppchen-Emporium eine dürftige, aber leicht verdiente Ausbeute.
Er kann sich nicht beschweren. Manchmal ergibt sich ein Glückstreffer, wie letzten Monat, als ein sauber rasierter Fremder mit militärisch präzisem Haarschnitt durch die Stadt pirschte. Er sah sich offensichtlich nicht einfach nur um. Über den gepflasterten Teil der Hauptstraße hinweg beobachtete Abu Satar, wie der Mann übermäßig viel Zeit bei Hussein in der Schlachterei verbrachte. Dann marschierte der Kerl einfach so ins Schnäppchen-Emporium, ließ die liebevoll bestückten Regale völlig unbeachtet und sich selbst in den einzigen bequemen Sessel plumpsen. Frechheit!, dachte Abu Satar. An derart dreistes Benehmen war er nicht gewöhnt.
Der Fremde strahlte jedoch eine Korrektheit aus, auf die Abu Satar sofort ansprach. Unverzüglich wurde er vom Importeur seltener Güter zu einem armenischen Schneider. Erste Treffen sind oft so – es gilt, jemanden zu vermessen, ihn richtig einzuschätzen. Der geheimnisvolle Fremde gab seine Bedürfnisse bald preis. Er war auf der Suche nach Informationen und hatte gehört, Abu Satar sei gut aufgestellt, um da zu helfen. Er müsse doch wohl bemerkt haben, dass Dschihadisten die Stadt als Schleichweg nutzten?
Der Händler bestätigte, leugnete oder bestritt es nicht. Sollten die Jordanier die Zahlmeister sein, wäre die Prämie belanglos. Um Abu Satar zu überzeugen, gab der geheimnisvolle Fremde ihm deutlich zu verstehen, dass es »nach oben keine Grenzen« gäbe, wenn erst die Amerikaner mitmachten – und Abu Satar hatte feinere Distinktionen zwischen potenziellen Geschäftspartnern schon immer geschätzt.
Ermutigt erkundigte er sich: »Und die Israelis?«
»Ihre Himmel behüten uns.« Der Fremde legte die Hände nebeneinander und rieb einen Zeigefinger am anderen. »Wir haben von einem geheimen Waffenlager gehört«, fuhr er fort. »Wir wissen nicht, ob es zum Verkauf steht oder …«
Mit kriecherischer Höflichkeit korrigierte Abu Satar ihn: »Mein Herr, meinem Verständnis nach handelt es sich um eine eher antike Sammlung, die, soweit ich gehört habe, von geringem Wert sein soll. Und mir wurde gesagt, dass sie kaum je ans Tageslicht kommt.«
Sein Besucher schnaubte nur abfällig.
Ehrerbietig nahm der Fledderer die Visitenkarte des Mannes entgegen und legte sie zur sicheren Verwahrung ins Diebesnest. Trotz des offenen Ausgangs der Unterredung fasste Abu Satar Mut, dass seine bescheidenen patriotischen Bemühungen Anerkennung fanden, und prompt fühlte er sich so entschlossen wie zehn M1-Abrams-Kampfpanzer, mit denen die Amerikaner den Irak platt fuhren. Wann immer sich eine unternehmerische Chance auftat, ob ihr Dirigent nun ein Muchabarat-Agent, verdeckter Ermittler, Informant oder Scharlatan war, Abu Satar schwor sich, der Situation noch das letzte Tröpfchen Gutes abzupressen.
Und all die Zeit über verstand nur Hani, der liebe Hani, wie visionär Abu Satars Pläne waren. Auch wenn sein Freund von den höchsten Gipfeln der Bürgerkriegspreistreiberei abgestürzt war und alles für osteuropäische Prostituierte verschleudert hatte, behielt er ein gutes Auge für günstige Gelegenheiten. Bei einem spätabendlichen Telefonat erzählte Abu Satar ihm von einem innigen, bislang nicht umgesetzten Wunsch: einer international bekannten Speise auf dem heiklen heimischen Markt zum Durchbruch zu verhelfen.
»So was wie das erste China-Restaurant in Bethlehem eröffnen?«, fragte Hani, um sich das Konzept zu erschließen.
»Kalt.« Dieses Spiel spielte Abu Satar manchmal mit ihm.
Hani versuchte es noch einmal: »So was wie in Beirut glutenfreie Pita backen?«
Der Fledderer war nicht so recht überzeugt; seiner Meinung nach gab es für eine solche Verbraucherrevolution nicht genügend arabische Allergiker. »Viel größer.«
»Ah!«, rief sein Freund. »So was wie McDonald’s nach Afghanistan bringen.«
Genau das schätzte Abu Satar an Hani – diese Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Hani allein verschaffte ihm Gelegenheiten, wie sie im Leben nur einmal kamen; und diese hier präsentierte er Abu Satar sogar inklusive Gesundheitszeugnis. Auch sie war gewissermaßen ein Flüchtling, war dem Elend entkommen und hatte illegal Grenzen überquert: von den Sabbalin, den Müllsammlern Groß-Kairos, durch den Sinai und die Tunnel des Gazastreifens, unter der Nase der Hamas hindurch und dann über die Mauer – Hani sagte, man habe einen Hebezug aus einem Altersheim benutzt –, vorbei an illegalen jüdischen Siedlungen im Westjordanland und schließlich nicht über die Allenby-Brücke, sondern unter ihr hindurch, auf einem Floß über den Jordan.
Sobald Abu Satar an seinen persönlichen Beitrag zur internationalen Küche denkt, wird sein Staubwedeln ehrfurchtsvoll. Er trifft nur selten Menschen, zu denen er wirklich Zuneigung und Vertrauen fasst. Seine Freundschaft mit Hani hatte einfach spontan gezündet, während bei Hussein Jahre, sogar Jahrzehnte nötig waren, um das Feuer der gemeinsamen Geschäftemacherei zu entfachen.
An dem Morgen, als sein Neffe in die Stadt zurückgekehrt war, wischte der Fledderer gerade Staub. Mit dem Klemmbrett in der Hand inventarisierte Abu Satar nebenher ein wenig, und so achtete er kaum auf den Mann in Uniform, der bei den gefälschten Designeruhren herumlungerte. Wegen der immer misslicheren Lage an der Grenze unten im Tal war die Stadt zum regelmäßigen Zwischenhalt für Soldaten auf dem Weg zu den unterschiedlichen Stützpunkten geworden. Im Großen und Ganzen hatten die Soldaten alle kein Geld und waren somit nicht weiter von Interesse. Als der schnurrbärtige junge Mann höflich grüßte, antwortete Abu Satar also nur kurz und achtlos. Er war sich sicher, jegliches Gespräch würde nur zu den unvermeidlichen Fragen nach dem Aufenthaltsort des einzigen verfügbaren Mädchens der Stadt führen.
Der Soldat vertrieb sich weiter die Zeit bei den Uhren. Als Abu Satar schließlich doch aufsah, blickte er verblüfft in das breit lächelnde Gesicht seines Lieblingsneffen. Er küsste ihn auf beide Wangen, packte ihn an den Schultern und hielt ihn eine Armlänge von sich, um zu begutachten, wie der Bursche sich seit ihrer letzten Begegnung verändert hatte. Der schmächtige, dröge Junge, der zum Militärdienst geflohen war, war – in den Augen seines Onkels – als Mann zurückgekehrt.
»Und, wie war’s?« Ein so gutaussehender Kerl hatte doch sicherlich viele Abenteuer erlebt. Weil er an die kleine Stadt gebunden war, versetzte sich der Ladeninhaber gerne in die Geschichten unberechenbarer reisender Händler und Fernfahrer hinein. Aufgeregt stellte er Frage um Frage, doch Husseins ausweichende Antworten ließen vermuten, dass seine Erfahrungen nicht gänzlich befriedigend gewesen waren. Am Ende saßen Jung und Alt schweigend bei Arak und Argileh.
»Amo«, setzte Hussein schüchtern an, wie früher, denn er hatte Abu Satars Gesellschaft schon immer faszinierend gefunden, »hast du die Zeitschrift aufbewahrt?«
Er meinte die alte Ausgabe von Good Housekeeping, die sein Bruder Abd einst aus Amerika geschickt hatte. Früher hatten Hussein und Abu Satar sich stundenlang darin vertieft, an ihrem Englisch gearbeitet und sich über den Zweck so vieler bunter und ungewöhnlicher Haushaltsgegenstände gewundert.
Sogleich zog Abu Satar das Heft aus seinem angestammten Versteck in der Schublade unter der Kasse hervor. Am Tag von Husseins Abreise hatte er es dort hineingelegt, als Symbol ihrer gemeinsamen Interessen. Hussein nahm die Zeitschrift und blätterte zu einer Doppelseite vor, die einen Supermarkt zeigte. Er war gerade aus Fort Knox von einem Ausbildungsprogramm der US-Armee für Auslandsoffiziere zurückgekehrt und konnte sämtliche abgebildete Lebensmittel, von Erdnussbutter bis Wiener Würstchen, benennen und einordnen, da er sie selbst erst in einem riesigen Supermarkt gekauft hatte, gewaltig wie der Dschabel Musa, der Berg, den die christlichen Touristenhorden den Nebo nannten.
Der alte Mann wurde feierlich ernst. »Chappi …? Was ist das denn?«
Hussein zögerte. Die Wahrheit würde ihn töricht aussehen lassen, doch wem konnte er sich anvertrauen, wenn nicht seinem Lieblingsonkel? Die Geschichte war zwar peinlich, aber wenn er Offizier werden wollte, musste er lernen, die eigene Dummheit ohne Weiteres einzugestehen. Er hatte sich von den schlichten Etiketten der Eigenmarke des Supermarktes irreführen lassen, mehrere Dosen gekauft und ein paar leckere Eintopfgerichte gegessen, bis er sein Versehen bemerkte.
Für Abu Satar ist es Ehrensache, sich nie über aufrichtige Versehen lustig zu machen. »Dein Vater hat mir mal eine Geschichte über einen Beduinenstamm erzählt.« Gedankenverloren zupfte er an seinem zurückgehenden Haaransatz. »Zu bestimmten Zeiten des Jahres, wenn der Morgenstern aufging, schlachteten die Beduinen ein Kamel und aßen das rohe, noch schlagende Herz vor Sonnenaufgang. So sorgten die Stammesangehörigen dafür, dass der Geist des Tieres auf sie überging. Sie wollten die Ausdauer und Lebenskraft des Kamels in ihr eigenes Leben aufnehmen.«
Prüfend blickte er zu seinem Neffen hinüber.
»Also, was hast du mitgenommen?«
»Wissen, das mich deprimiert hat, wann immer ich eine amerikanische Straße entlangging.«
Hussein hatte auch seine Brüder mit ihren Familien in Ohio besucht und war erstaunt gewesen.
»Meine Nichten kümmern sich um ihre Haustiere wie wir uns um Menschen. Sie reden lieb mit ihnen, umarmen und kämmen sie –« Seine Stimme versagte kurz vor Verwunderung. »Ich sag dir, bei denen leben die Hunde besser als wir.«
Abu Satar stieß den dichten, süßen Rauch aus und murmelte: »Manchmal ist es besser, die Welt nicht zu kennen.«
An jenem Tag hatte Abu Satar sich geschworen, diesem sensiblen jungen Verwandten, der so vielversprechend und voller Elan war, zu helfen. Nachdem Hussein die Armee verlassen hatte, war es Abu Satar, der ihn durch die Feinheiten des Verkaufs der väterlichen Ländereien führte. Selbst als Hussein darauf bestand, ein letztes Stück vom Erbe Al Dschids zu behalten, gab sein Onkel seinen Wünschen nach, auch wenn er einen sauberen Schlussstrich bevorzugt hätte – seine Provision wäre höher gewesen. Die Landwirtschaft hätte Hussein ohnehin nie eine Zukunft geboten. Als er schließlich in der Schlachterei gegenüber landete, zerbrach sich Abu Satar den Kopf, mit welchen schlauen Plänen er ihn von dort befreien könnte. Er wusste, der junge Mann war für Besseres bestimmt – auch wenn Hussein selbst eine Weile brauchte, bis er die ungewöhnliche Art von Abu Satars Hilfe ganz annehmen konnte.
Als Hussein sich in seinem neuen Job eingelebt hatte, schickte Abu Satar, wann immer etwas Interessantes im Schnäppchen-Emporium ankam, seinen jüngsten Sohn Sammy bei ihm vorbei. Er hatte den pfiffigen, schlaksigen Vierzehnjährigen angewiesen, nie zur Schlachterei hinüber zu rennen, sondern immer nur lässig zu schlendern. Auf unnötige Aufmerksamkeit konnten sie verzichten. Doch wie ungeheuerlich Abu Satars jüngster Fang sein musste, ließ sich an den eindringlichen Rufen des Jungen erkennen, die die gesamte Hauptstraße hinunterhallten: »Ibn ammee«, »mein Onkel!«
Bald nachdem Abu Satar Hanis einem Naturwunder gleiches Geschenk erhalten hatte, scheuchte er Hussein in das Gewirr von Räumen hinter dem Schnäppchen-Emporium, wo Fußboden und Tische voller Kisten mit Johnnie Walker Red standen, dem jüngsten Schmuggelgut der florierenden Schattenwirtschaft.
Zum Auftakt wies Abu Satar Sammy an, ihm und Hussein Drinks zu mixen und für weitere Anweisungen bereitzustehen. Dann verschwand er hinter einer Tür. Er wirkte wie ein Magier, der gleich das Spektakulärste von allem hervorzaubern wird. Weder das Quäken, das durch die Tür drang und nach Baby klang, noch das unbewegte Gesicht seines Sohnes gaben irgendetwas preis. Der kleine Sammy war gut erzogen, dachte Abu Satar mit Wohlgefallen. Er konnte versiert Frozen Margaritas mixen und unanständige Witze erzählen. Vor allem aber hatte er gelernt, Geheimnisse zu wahren. Und so war sich Abu Satar sicher, dass der Junge, falls nötig, auch noch stundenlang stramm neben Hussein stehen bleiben würde.
Ein paar laute Schläge und gedämpftes Gefluche von Abu Satar drangen durch die Tür, dann öffnete sie sich einen Spalt breit. Im dämmrigen Licht waren nur die Spitzen von Abu Satars gelben marokkanischen Lederpantoffeln zu sehen. Mit dem Rest seines Körpers steckte er im Stroh und versuchte, dort etwas zu fassen zu bekommen. Ein beißender Geruch platzte aus dem Zimmer, und Hussein prallte hustend zurück.
»Tür zu!«, brüllte Abu Satar, doch es war schon zu spät. Als sich eine Kreatur mit schwarz-braun-rotem Fell an den Whiskykisten vorbeidrängte, für ihre Größe bemerkenswert agil, und quiekend durch die Gardinenabtrennung floh, verschüttete Hussein seinen Drink und stieß mit dem noch immer strammstehenden Sammy zusammen. Das Tier verschwand derweil hinter einem Kleiderständer mit DKNY-Imitaten, den strohbedeckten Abu Satar dicht auf den Fersen. Abu Satar wusste, sollte ein Kunde auch nur einen einzigen Blick auf diesen Spezialartikel erhaschen, wäre er ihn für alle Zeit los. Mit einer Sportlichkeit, die sein Alter Lügen strafte, sprang er in die Kleidermasse und wühlte, tauchte jedoch mit leeren Händen wieder auf und legte den Finger an die Lippen, bevor sein Neffe etwas sagen konnte.
Jetzt bezog Sammy, wachsam und konzentriert, Stellung neben seinem Vater und lauschte dem kleinsten Geräusch, das hätte verraten können, wo ihre Beute sich befand. Als es in einer Ecke klimperte, fuhr sein Vater auf, doch der Junge hob nur eine Hand und flüsterte: »Balinesische Windspiele.« Am hinteren Ende des Ladens raschelte es, doch bevor sich die beiden Männer hätten bewegen können, mahnte der Junge wieder leise zur Vorsicht: »Aufzieh-Spielroboter.«
Mit sicherer Hand holte Sammy einen alten CD- und Kassettenspieler hervor – ohne den er selten unterwegs war –, stellte die Marschkapelle des Emirs von Kuwait an und spulte zum Anfang des Potpourris aus Der Fiedler auf dem Dach. Er hatte diese furiosen Stücke zuvor schon vor verschlossener Tür gespielt und sie als Lieblingsnummern des Tieres vermerkt, weil es sich dabei manchmal gegen die Tür warf. Von Fairuz bis zu Liebesliedern hatte Sammy alles ausprobiert, doch eine garantierte Reaktion hatten nur martialische Blechbläser ausgelöst. Nach ein paar Takten trat das Tier hinter einer Reihe Stoffballen hervor und wiegte seine beachtliche Körpermasse zur Musik.
Abu Satar packte das Vieh am Bein, knurrte »Ach-tung!«, und der junge Sammy stand sofort wieder wie ein Brett. Die Marschkapelle, gerade in den letzten Zügen ihrer Interpretation von »Wenn ich einmal reich wär«, wurde abrupt ausgestellt. Abu Satar zerrte das Tier wieder hinter den Vorhang. Zu Atem gekommen, bat er Hussein zu sich. Als Sammy frische Drinks gemixt und sie sich gesetzt hatten, tätschelte Abu Satar der glatthaarigen Sau, die nun friedlich zu seinen Füßen lag, die markante Schnauze und sprach zu Hussein: »Dies, mein Freund, ist die Zukunft.«