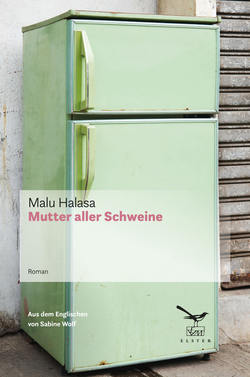Читать книгу Mutter aller Schweine - Malu Halasa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеUm nicht gegen die Zimmertür zu knallen, greift der kleine Fuad nach der Klinke und zieht sie mit aller Kraft herunter. Die langsame, gleitende Bewegung ist zutiefst befriedigend; es ist der erste Triumph des kleinen Kindes an einem sonst durchschnittlichen Morgen. Zögerlich betritt er das stille Zimmer. Muna, in einem der zwei Einzelbetten, scheint tief zu schlafen.
Winzige ruckelnde Schritte tragen ihn zu einem geöffneten Koffer vor dem Tischchen zwischen den beiden Betten. Egal wie gering das Hindernis sein mag, für jemanden, der noch an rudimentären motorischen Fähigkeiten feilt, ist das Darübersteigen wie eine Bergwanderung. Neben dem Koffer geht Fuad in die Hocke, dann stürzt er sich ohne weitere Warnung kopfüber hinein. Um den Rest seines Körpers in den Koffer zu ziehen, zerrt er an einem Minirock mit Schottenmuster. Belustigt stützt sich Muna auf die Ellbogen und sieht ihm zu.
Neugierige Hände durchforsten Knöpfe und Reißverschlüsse. Als er nichts Passendes zum in den Mund Stecken findet, wägt Fuad seine Optionen ab. Er ignoriert den Impuls, an einer Strähne von Samiras langem dunklem Haar zu ziehen, die von einem nahen Kopfkissen hängt, und greift stattdessen ein praktisches Tischbein, um sich aufzurichten. Noch immer ist er nicht groß genug. Was auf der Tischplatte verführerisch glitzert, bringt ein launischer Wischer seiner kleinen Hand in Reichweite. Er lässt sich wieder fallen und macht sich gerade parat, sämtliche Kontaktlinsen-Blister und Familien-Schnappschüsse zu verkosten, als er unerklärlicherweise von seinem Herzenswunsch weggerissen wird. Der Übergriff kommt so rüde und unerwartet, dass er sich nach hinten in Munas Arme fallen lässt und schreit. Je mehr sie ihn beruhigt, umso lauter wird er. Als er sieht, dass Tante Samira wach ist, will er unbedingt zu ihr und brüllt und tritt. Ein gleichgültiges Kopfschütteln von ihr entfacht einen weiteren Ausbruch.
Das Aroma von Kaffee und Kardamom signalisiert seine nahende Rettung.
Mutter Fadhma hat Fuad nur für einen Moment allein gelassen. So schnell ihr angeschlagener gesundheitlicher Zustand es zulässt, kommt sie in Samiras Zimmer und stellt ein dampfendes Tablett arabischen Kaffees auf das Tischchen. »Schande über diese Mädchen, dich schlecht zu behandeln«, tadelt sie und nimmt den kleinen Jungen in die Arme. Fuad, sicher bei seiner Dschadda, schluckt tief und lange.
»Mamma ist sein Liebling«, sagt Samira und gähnt. »Wir anderen haben die Nase voll von Babys.«
Fadhma setzt sich auf Munas Bett, zieht ein Taschentuch aus der Schürze und wischt Tränen vom fleckigen Kindergesicht.
»Ich wollte nicht …« Muna ist es unangenehm, aber ihre Großmutter hebt eine Hand.
»Niemand kann für einen Wutanfall verantwortlich gemacht werden.« Während Fadhma den kleinen Fuad hin- und herwiegt, denkt sie an Munas Vater Abd. Ihre besondere Zuneigung zu ihm fing an, gleich als sie ihn zum ersten Mal sah, Sekunden nach einer schwierigen und frühen Geburt. Fadhma war damals ein Teenager – wohl zehn Jahre jünger als Muna heute. Sie nahm das winzige dunkle Baby aus den Armen ihrer fünfzehnjährigen Schwester Nadschla und verliebte sich. Es war Fadhma, die ihm seinen Spitznamen gab. Aus jedem anderen Mund hätte Abd – »Diener« – abwertend geklungen, doch in jenen wenigen Augenblicken konnte Fadhma in seine Zukunft sehen: Er würde sich in den Dienst der Familie stellen. Ihre eigene konnte sie nicht vorhersehen: Nach dem Tod ihrer Schwester und der Heirat mit Al Dschid würde sie selbst dreizehn Kinder aufziehen.
Als die untauglichen Spielsachen gerettet sind, der Koffer wieder verschlossen ist und Fuad mit neu gefundenem Enthusiasmus herumkrabbelt, nimmt Mutter Fadhma Munas Fotos aus Amerika und betrachtet sie noch einmal. Sie hat gestern Abend einen kurzen Blick darauf geworfen, aber im harten Morgenlicht erzählen sie eine andere Geschichte. Die Söhne ihrer Schwester dominieren die Bilder genauso wie die Familie. Von Mutter Fadhmas geliebten Töchtern – Magda, Lulwa und Hind – sind keine vernünftigen Aufnahmen dabei, obwohl auch sie in Cleveland leben. Von diesen Frauen, die in den Häusern ihrer Halbbrüder und Ehemänner kochen und putzen, hat die Kamera manchmal eine Schulter erwischt, einen Rücken oder eine Seitenansicht, die mehr Haar als Gesicht zeigt. Ihre vierte Tochter, Katrina, und deren zwei Söhne, Abdul und Scharif, tauchen überhaupt nicht auf: Sie sind zusammen mit Nadschlas Ältestem, Yusef, nach Chile gezogen.
Die Jungen ihrer Schwester sind in den USA alt geworden. Mutter Fadhma muss zweimal hinsehen, um Faruk in seinem Geschäftsanzug mit Krawatte zu erkennen. Kassim hat gar keine Haare mehr, ist aber immer noch der Komiker, der vor einer seiner Autowerkstätten mit den anderen witzelt. Butros, ein medizinisch-technischer Assistent, macht als Vater von vier Mädchen einen still zufriedenen Eindruck. Abds Teint wirkt durch das graue Haar noch dunkler. Mutter Fadhma fragt sich, ob daran seine Wissenschaftlerkarriere oder seine stürmische Ehe schuld ist.
Die Männer stehen neben Autos oder in steifen Familiengruppen, oder sie spielen mit ihren Söhnen und Töchtern Ball. Alle wirken selbstgefällig und überfüttert, selbst die Kinder. »Wie gemästete Kälber«, flüstert Mutter Fadhma zu sich selbst. In ihrer Eile, sich zu assimilieren, wirken ihre Stiefenkel in den Cleveland-Cavaliers-Trikots, als hätten sie jegliche Bindung an Jordanien verloren.
Normalerweise würde die alte Mutter keine Dankbarkeit erwarten. Schon lange ist sie an unbelohnte Arbeit gewöhnt. Sie war diejenige, die sich alles vom Munde abgespart hat; sogar ihr bisschen Goldschmuck hatte sie verkauft, um für die Flüge zu bezahlen. Sie müssen ihr nicht ständig danken, aber sie hätte nichts dagegen, dass man sich ihrer hin und wieder erinnert. Mutter Fadhma merkt, dass Muna sie ansieht. Das Mädchen hat etwas zu einem der Fotos gesagt, doch die alte Frau war viel zu sehr in ihre eigenen Gedanken vertieft und hat nicht zugehört. Ihr wird klar, dass Abds Tochter nichts für das Desinteresse ihres Vaters und ihrer Onkel kann, genauso wenig, wie ihr die Babytränen vorzuwerfen sind. Es ist wirklich an der Zeit, denkt Fadhma, sich von der Last dieses Grolls zu befreien. Seit Munas Ankunft war die Familie durchweg zu beschäftigt mit ihren eigenen Sorgen, als dass sie wirklich gastfreundlich gewesen wäre. Mutter Fadhma beugt sich zu Muna hinüber, wischt den Schlaf aus den ausländischen Augen ihrer Enkeltochter – ihre erste Geste der Vertrautheit gegenüber dem Mädchen – und legt den Bilderstapel zurück auf den Tisch.
Sie gießt zwei Mokkatässchen arabischen Kaffees ein und sagt Muna und Samira, dass sie schon einmal ohne sie anfangen sollen, dann steht sie unter Schmerzen vom Bett auf und geht langsam aus dem Zimmer.
Sie kehrt mit einem angeschlagenen Karton zurück und sagt stolz: »Jeder einzelne Brief, den die Familie über die Jahre geschickt hat.« In der Kiste sind Papiere und Briefe mit brauner Schnur zu ordentlichen Päckchen gebunden. Ganz unten liegt ein verblasster taubenblauer Luftpostumschlag, dünn wie eine Zwiebelhaut. Darin stecken übrig gebliebene Passfotos, immer dann aufgenommen, wenn eines von Al Dschids Kindern – die ihrer Schwester und ihre eigenen – das Land verließ. Fadhma möchte, dass ihre Enkeltochter ihre Tanten und Onkel sieht, als sie jung waren und am Anfang des eigenen Erwachsenenlebens standen, voller Hoffnung.
Auf zwei vergilbten Schnappschüssen erkennt Muna Magda und Lulwa zuerst nicht. »Guckt doch mal!«, ruft sie dann, etwas ratlos. Die beiden übergewichtigen Frauen mittleren Alters in Ohio haben wenig Ähnlichkeit mit diesen schlanken Mädchen mit Rougewangen. Das nächste Foto ist leichter zu erkennen: »Das ist Hind«, ruft Muna. Sie kennt Mutter Fadhmas zweitjüngste Tochter gut. Mit sechzehn wurde Hind zu Munas Familie nach Cleveland geschickt. Sie war nur zwei Jahre älter als Muna. Es dauerte eine Weile, doch schließlich wurden die beiden Mädchen enge Freundinnen. Fadhma weiß das aus Hinds Briefen nach Hause. Sie fragt sich, ob Muna Hinds Einschätzung zustimmen würde, dass Abd und seine ausländische Frau zu jener Zeit am bittersten stritten.
Während Muna durch die alten Fotos blättert, löst Fadhma die Schnur um Abds Briefe. »Dass es hier ganz selten mal schneit, hat deinen Vater nicht auf die strengen amerikanischen Winter vorbereitet«, erzählt sie ihr. In Greenville, Illinois, hatte Abds deutsche Vermieterin, Frau Schneider, ihm Kleidungsstücke ihres verstorbenen Mannes gegeben, der über 1 Meter 95 groß gewesen war. Fadhma liest: »›Ich kann bei meiner Nachtschicht in der städtischen Cafeteria so viele Erdnussbutter-Marmelade-Sandwiches essen, wie ich will, größer werde ich davon nie.‹ Später fand er dann eine Anstellung in einer extrem schmutzigen Küche«, sagt sie und zieht beim nächsten Brief eine Grimasse. »›Ich habe zehn Tage alte Schweinekoteletts weggeschmissen – acht Säcke stinkender Abfall!‹ Aber dein Vater hat damals geschrieben, dass der Job auch seine Vorteile hatte. Die Besitzerin konnte anscheinend besser nähen als kochen und kürzte die Kleidung deines Vaters, damit sie ihm besser passte.« Als Abd dann eine Stelle als Krankenpfleger in einem Spital bekam, bezahlte er seine Vermieterin für ihre Näharbeit und schickte so viel Geld er konnte nach Hause an die Familie.
Er hatte auch von einem recht schockierenden Ereignis geschrieben. Eines Abends war er nach der Arbeit in eine Bar gegangen. Vor Aufregung spricht Mutter Fadhma lauter. Noch jetzt weiten sich ihre Augen vor dem Schrecken von damals. Sie kann sich noch immer nicht ganz vorstellen, was für Höhlen des Frevels amerikanische Bars sein müssen – laufen die Frauen dort nackt herum? Werden deshalb all die jungen arabischen Männer verführt und vergessen schließlich ihre Familien und bleiben im Ausland? Um ihres Gastes willen verdrängt sie ihre Ängste und sagt aufgeräumt: »Als dein Vater sich ein Bier bestellt hatte, erschien ihm dein Großvater: ›So wirklich wie die Flasche in meiner Hand‹, und Al Dschid sagte immer wieder nur: ›Ich habe dich also den ganzen langen Weg nach Amerika geschickt, damit du Alkohol trinkst?‹«
Mutter Fadhma fühlt sich, als hielte sie eine wertvolle Zeit in ihrer aller Leben in den Händen, und lächelt Muna dankbar an, weil die sie darüber sprechen lässt. »Du glaubst gar nicht, was für eine Aufregung diese Briefe anfangs auslösten, wenn sie ankamen.«
Samira, die die ganze Zeit über still zugeschaut und zugehört hat, wirft ein: »Wann immer ein Flugzeug vorbeiflog, haben wir Kinder nach oben gezeigt und ›Abd! Abd!‹ gerufen.«
»Und sie sind dann einer nach dem anderen«, fragt Muna, »alle von zu Hause weg?«
»Genau«, bestätigt Fadhma. Warum so tun, als ob? Anfangs empfand sie die Kinder ihres Ehemanns, sowohl zu Hause als auch im Ausland, als ebenbürtige Hälften desselben Ganzen. Doch irgendwann stimmte das nicht mehr. Abgesehen von den Briefen und dem Geld, das sie nach Hause schickten, verschwanden sie. Als ihre eigenen Kinder alt genug zum Reisen waren, verstand Fadhma, dass sie sie für immer verlor.
Sie seufzt. »Sie haben dort ein besseres Leben.« Sie sagt nicht, dass sie sich damals noch immer an den unbegründeten Glauben klammerte, dass Abd, der Sohn, dem es bestimmt war, sich um sie zu kümmern, sie und Al Dschid nicht endgültig verlassen würde. Sie empfand das weiterhin so, selbst als die finanziellen Zuwendungen ihres Stiefsohnes seltener wurden und sich der Ton seiner Briefe deutlich änderte.
Anstatt über kleinste Details seines Alltagslebens zu berichten, um seine Eltern so an seinem Leben teilhaben zu lassen, wurde er immer verschlossener. Er sei stark mit dem Lernen für seinen Collegeabschluss in Chemie beschäftigt und habe wenig, worüber er schreiben könne. Die Neuigkeiten aus seinem Privatleben klangen verdächtig. Er hatte sich mit einer Studentin angefreundet, auch Immigrantin, eine junge Frau von den Philippinen. Dann, ohne weitere Warnung, heirateten die beiden.
Für die Familie war es ein harter Schlag. Bei den Sabasens heiratete niemand einen Fremden. Abd hatte nicht nur außerhalb seines Stammes geheiratet, sondern auch außerhalb seiner Kultur. Und wer konnte schon sagen, was für Folgen so ein waghalsiges Verhalten haben würde? Fadhma befürchtete das Schlimmste, doch Al Dschid nahm die Nachricht besonders schlecht auf. Er hatte das Leben seines Sohnes bereits geplant. Er hatte ein passendes Mädchen als Abds Ehefrau ausgesucht und sogar schon die ersten Aufwartungen gemacht. Das junge Paar wäre wohl irgendwann in der Golfregion gelandet, wo sein Sohn als Chemiker gearbeitet hätte, um die anderen Geschwister zu unterstützen. Als das nun nicht mehr möglich war, akzeptierte Al Dschid schließlich das Unabänderliche und sendete seinen Segen … auch wenn ihn niemand darum gebeten hatte.
Die unverfrorene Unabhängigkeit ihres Zweitältesten demütigte die Eltern, und es sollte noch schlimmer kommen. Ein weiterer Brief in Fadhmas Schachtel, der viele Male auseinander- und wieder zusammengefaltet und zuunterst hineingelegt worden war – niemals erwähnt, aber niemals vergessen –, war auf Englisch. Er war nach Abds Vermählung angekommen. Doch weil es im Dorf niemanden gab, der Englisch sprach, blieb er ungelesen, bis Al Dschid eines Tages wegen Geschäften in die Hauptstadt musste. Am Abend kehrte er ziemlich bedrückt nach Hause zurück. Mutter Fadhma dachte, es läge am schlechten Gerstenpreis, doch als sie nachfragte, zog er den Brief mit einer Übersetzung ins Arabische aus der Tasche. Mit ausdrucksloser Stimme las er vor: »›Ihr schreibt immer nur, dass Ihr mehr Geld wollt. Wie könnt Ihr Schweine es wagen, uns immer weiter zu nerven! Ich bin schwanger, und Euer Sohn will, dass ich Euch das bisschen Geld gebe, das meine Familie mir schickt. Fahrt zur Hölle.‹«
Nicht einmal diese Nachricht schaffte es, Mutter Fadhmas Vertrauen in Abd endgültig zu erschüttern. Erst ein paar Jahre später, als ein Schnappschuss mit der Post kam, wurden ihre Hoffnungen ganz zerschlagen. Auf dem Foto war ein kleines Mädchen in Baströckchen und hawaiianischem Top zu sehen, eine orangefarbene Blumenkette um den Hals. Sie hatte die Hände zu einer Seite und einen nackten Fuß nach vorne ausgestreckt. Muna, dreieinhalb Jahre alt, beim Hula-Tanzen. Der beiliegende Brief war einfach und direkt. Fadhma sagt ihn auf, als wäre er gestern angekommen: »›Meine liebe Familie, ich schreibe Euch aus meinem Labor, der einzige Ort, an dem ich zur Ruhe komme. Ich habe eine gute Stelle bei einer großen Plastikfirma. Meiner Frau und meiner Tochter geht es gut. Wie Ihr sehen könnt, sieht das Mädchen nicht arabisch aus. Das ist das Problem bei einer Mischehe. Weder sie noch ihre Mutter würden in Jordanien akzeptiert werden, und wir würden dort ein unglückliches Leben führen. Ich denke also, dass es für uns am besten ist hierzubleiben. Gott schütze Euch.‹«
Schweigend reicht Fadhma Muna das Bild, das sie als kleines Mädchen zeigt. »Daran erinnere ich mich gar nicht«, sagt ihre Enkeltochter und grinst verlegen. Nachdem sie das Bild lange und eingehend betrachtet hat, gibt sie es an Samira weiter und fragt Fadhma: »Dschadda, warum hast du deinen Kindern eigentlich muslimische Namen gegeben?«
Wieder sieht die alte Großmutter das Mädchen in neuem Licht. Blöd ist sie zumindest nicht. Fadhma lächelt stolz. »Das war die Idee deines Großvaters.«
In der Hoffnung, dass Munas Interesse an Familiengeschichte größer ist als Samiras oder Lailas, setzt sie langsam an. »Vor Hunderten von Jahren führten Christen, die Sabas verehrten, den Schutzheiligen unserer Familie, Krieg gegen die heidnischen Götter der Wüste. Nach diesen Gefechten ließen sie sich in einer Kreuzritterfestung im Süden des Landes nieder und wären auch dort geblieben, wenn es nicht zu einer Auseinandersetzung um eine Frau gekommen wäre –«
»Es geht immer um eine Frau«, unterbricht Samira und lacht. »Jemand guckt jemanden an. Der Vater von jemandem regt sich auf. Die Brüder von So-und-so mischen sich ein, und dann geschieht eigentlich immer ein Mord.«
Fadhma geht bewusst nicht auf den Kommentar ihrer Tochter ein und fährt fort: »Es hätte einen Konfessionskrieg gegeben, doch die Kirchenobersten in Jerusalem richteten eine Petition an den türkischen Gouverneur der Region, und so durften die Christen hier in die Berge kommen« – Fadhma wirbelt einen Finger durch die Luft – »und sich in den Ruinen einer verlassenen byzantinischen Stadt niederlassen, die sieben Mal von Erdbeben zerstört worden war. Als die Stämme ankamen, suchten sie Schutz in einer Höhle bei einer Quelle, von der sie glaubten, sie sei Gottes Geschenk an sie. Sie gehörte aber schon jemand anderem. Ungewollt tauschten unsere Vorfahren also einen Kampf gegen einen anderen, und in einer Schlacht fiel dein Urgroßvater. Für die Familie war das ein schwerer Schlag. Doch im jungen Alter von zehn Jahren schwor Al Dschid feierlich, den Tod seines Vaters nicht zu rächen, was bemerkenswert war, wenn man den Ehrenkodex der Stämme bedenkt. Als er dann heiratete und selbst Kinder bekam, gab er ihnen keine christlichen Namen, sondern welche, die entweder muslimisch waren oder als neutral galten. So konnten sie unbehelligt unter Fremden leben.«
Sie schenkt sich eine weiteres Tässchen Kaffee ein. »Dein Großvater glaubte, dass der Islam und das orthodoxe Christentum wie ein großer und ein kleiner Baum zusammengewachsen waren. Die Blätter waren unterschiedlich, aber der Schatten war derselbe. Er hat sich auch selbst das Lesen und Schreiben beigebracht.« Sie sah ihn nun vor sich, wie er im alten Haus stundenlang in der vorderen Fensternische saß und bei Tageslicht seine Bücher las. »Er liebte die Geschichte Arabiens. Unsere Töchter wurden nach großen islamischen Frauen benannt, manche von ihnen Kriegerinnen. Möchtest du sein Lieblingsgedicht hören? Das war ihre Gutenachtgeschichte.«
Mutter Fadhma setzt sich auf und rezitiert ein wenig nervös:
»Wir sind die Töchter des Morgensterns,
Wir gehen auf weichen Kissen,
Perlen zieren unsre Hälse.
Moschus duftet in unsrem Haar.
Kämpft ihr, umarmen wir euch,
Weicht ihr zurück, verlassen wir euch
und nehmen Abschied von der Liebe.
Das Lied haben Hind und die anderen Rebellinnen aus Mekka auf dem Schlachtfeld gesungen«, sagt sie. »Sie haben ihre Trommeln geschlagen und ihre Männer angefeuert, Muslime zu töten, die aus Medina gekommen waren, um Mekkas einträglichen Handel mit Karawanen und Pilgern an sich zu reißen.«
Zu guter Letzt fühlt sich Mutter Fadhma nun doch wohl. Seit Husseins Problemen ist ihr ein Lieblingshobby versagt geblieben, nämlich beim Morgenkaffee mit den älteren Damen der Stadt Geschichten auszutauschen. Weder Muna noch Samira zeigen etwas vom Esprit oder Temperament ihrer alten Freundinnen, aber als Publikum sind die beiden jungen Frauen zu gebrauchen. Fadhma würde ihnen noch vieles mehr erzählen, was sie über Hinds Mut und Grausamkeit auf dem Schlachtfeld weiß oder deren Streit mit dem Propheten Mohammed; die Bekehrung der Heiden, die zuerst die christlichen Heiligen bekämpft hatten, und der brutale Anbruch einer neuen Zeit, die nur noch dem Einen Gott gehörte. Es wäre eine Geschichtsstunde, auf die ihr Ehemann stolz gewesen wäre, auch wenn ihm oftmals nicht bewusst war, wie häufig er seine eigenen Geschichten wiederholte. Schon spürt Fadhma, wie in Samiras Zimmerecke die Langeweile aufsteigt, also bewahrt sie sich ihre Geschichten für ein anderes Mal auf und fragt: »Und was habt ihr heute vor?«
Samira antwortet: »Vielleicht fahren wir nach Amman und sind dann rechtzeitig zur Hochzeit heute Abend wieder da. Oder wir könnten am Nachmittag ins Internetcafé gehen. Wir haben uns noch nicht entschieden.« Muna nickt eifrig.
»Bewegt euch nicht zu weit fort«, warnt Fadhma. »Heute Nachmittag erwarten wir Gäste.«
»Gäste?«, fragt Samira erstaunt.
»Es kommen ein paar Leute vorbei, um Muna kennenzulernen«, sagt ihre Mutter stolz.
»Na ja, vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, eine SIM-Karte für mein Handy zu bekommen«, schlägt Muna vor, »auch wenn es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich habe gehört, dass die Stadt schlechten Empfang hat« – sie klingt fast, als wollte sie sich entschuldigen – »wegen des Dschabel Musa, aber der Berg ist gar nicht das Problem, sondern ich. Ich bin richtig internetsüchtig.«
Samira blickt verständnisvoll drein, auch wenn Fadhma nicht weiß, warum sie das sein sollte. Die Jugend spricht eine andere Sprache, und Fadhma kann das Gefühl in ihren alten, müden Knochen nicht ignorieren, dass ihre Tochter ihr etwas verheimlicht. Wo ist sie in den letzten Monaten immer hin? Mit wem verbringt sie ihre Zeit? Mit einem Mann? Nur weil Muna zu Besuch ist, soll Samira bloß nicht denken, dass sie das ausnutzen kann. Fadhma weiß nur zu gut, dass jetzt nicht der richtige Moment ist. Eher würde sie sich den Mund mit Stroh zunähen, als eine Szene zu machen und so eine Spur von Spekulationen zu schaffen, die ihren Weg zurück bis nach Cleveland, Ohio, finden würde. Plötzlich kommt ihr das Zimmer heiß und klaustrophobisch vor. Wortlos legt Fadhma die Briefe zurück in den Karton.