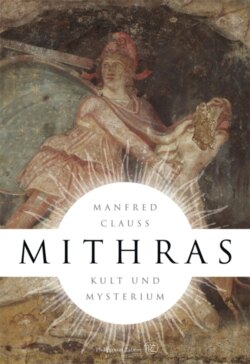Читать книгу Mithras - Manfred Clauss - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Blütezeit
ОглавлениеSeit der Mitte des 2. Jahrhunderts war der Kult nahezu in sein gesamtes späteres Verbreitungsgebiet vorgedrungen; immer mehr Mithräen entstanden. Damit beginnt die Dokumentation durch inschriftliche Zeugnisse dichter zu werden. Der Kult war längst über die ersten Trägerschichten hinausgegangen und begann, in weiteren Kreisen Anhänger zu finden. Aus Sklaven wurden Freigelassene, aus Soldaten nach der Entlassung recht wohlhabende Zivilisten, beide Gruppen führten diesen Aufstieg zweifellos unter anderem auf ihren Gott zurück (S. 134).
Seit der Regierungszeit des Marc Aurel (161–180), verstärkt seit derjenigen des Commodus (180–192) begegnen uns Inschriften in den Mithräen, die dem Wohl, pro salute, der Kaiser gewidmet sind. Das Aussprechen einer Heilsformel für den Herrscher, was häufig mit der Erfüllung von Gelübden verbunden war, gehörte zu den beliebtesten Formen des Kaiserkultes.50 Solche Inschriften zielen auf die Person des Kaisers als Garanten für Sicherheit und Frieden, wobei Mithras in diesem Zusammenhang als Gewährsmann angerufen wurde. Somit entwickelte sich eine enge Verbindung von privaten kultischen Verpflichtungen und dem Herrscherkult.
Auf die Dauer konnten solche Weihungen von Votivinschriften in den Mysterien-Heiligtümern mit Nennung des Herrschers, die damit zu einem quasi öffentlichen Akt wurden, nicht gegen das Wissen der staatlichen Stellen vollzogen werden. Dies ging zumal dann nicht, wenn es sich bei den Dedikanten um Soldaten, um Angehörige des staatlichen Zolls, sowie um kaiserliche Sklaven und Freigelassene handelte. Die Tatsache beispielsweise, dass eine Inschrift aus Istria (Bulgarien), welche die Liste der Stifter des dortigen Mithräums enthält, nach dem Priesteramt des Provinzstatthalters datiert ist, der zugleich Patron der Stadt war, verleiht dem Dokument einen beinahe offiziellen Charakter (CIMRM-02, 02296). Die diesbezügliche Transparenz der Weihungen in den Mithräen zeigt sich ferner an einem Beispiel in Moosham (Österreich). Hier tilgte man den Namen eines Stifters wohl zu dem Zeitpunkt, als man im Zuge der reichsweiten innenpolitischen Auseinandersetzungen 196 gegen die dortigen Staatsfeinde vorging.51 Dies war obendrein Zeichen der Loyalität der Kultgemeinschaft gegenüber dem Herrscher.
Mit dem Kaiser Commodus wurde das Epitheton Invictus, der Unbesiegbare, Teil der halboffiziellen Titulatur, ein Beiname, den Mithras seit Anbeginn getragen hatte. Diese Parallelität veranlasste einen Offizier, einen centurio in Nordafrika, auf eigene Kosten eine Inschrift für Mithras, den Invictus zu errichten; er tat dies zugleich „zum Wohl und für die Unverletzlichkeit des Kaisers Lucius Aelius Aurelius Commodus, des frommen, unbesiegbaren, glücklichen römischen Hercules!“52 Ähnliche Überlegungen mögen für den Stifter einer Inschrift aus Rom eine Rolle gespielt haben, der als Priester des Mithras-Kultes einen Altar dem Heil der unbesiegten Kaiser weihte (CIMRM-01, 00502). Die durch den Text der beiden Inschriften nahegelegte Parallelisierung des unbesiegten Kaisers mit dem unbesiegten Sonnengott kann ex eventu durchaus als Vorstufe der vollen Gleichsetzung in der Formel Sol Invictus Imperator, der Sonnengott, der Unbesiegte, der Kaiser, gedeutet werden; denn wir finden Weihungen an diesen D(eus) S(ol) I(nvictus) Imp(erator) auch in Mithräen, beispielsweise in Dormagen (Nordrhein-Westfalen), wo der Hornbläser C(aius) Amandinius Victor ein Kultrelief aufstellte (Abb. 48).53
Für Commodus hat zweifellos die Identifizierung mit dem unbesiegbaren Hercules den Ausschlag dafür gegeben, sich den Beinamen Invictus zuzulegen. Das Attribut war aber keineswegs auf einen Gott allein festgelegt, und wie der Soldat aus Nordafrika nutzten sicherlich viele Mithras-Anhänger die Deutungsmöglichkeit, die in der unbestimmten Formel Invictus der kaiserlichen Titulatur steckte, und bezogen sie auf ihren Gott. Deshalb gesellten sich zu dem Kreis derjenigen, für deren Wohl man dem Mithras eine Statue oder eine Inschrift widmete (S. 45), seit der zweiten Hälfte des 2. bis in den Beginn des 4. Jahrhunderts immer häufiger die Kaiser.
Gelegentlich wurden solche Inschriften zu besonderen Ereignissen errichtet, wie etwa anlässlich der Rückkehr des Septimius Severus aus dem Partherkrieg im Jahre 202; in diesem Fall ist die Inschrift von zwei kaiserlichen Freigelassenen aufgestellt (CIMRM-01, 00407). Ein Priester des Mithras-Kultes ließ zusammen mit anderen Kultanhängern dem Sol Invictus ein Heiligtum erbauen, das sie mit einem Kultbild des Gottes schmückten; den Anlass bildeten die Siege der Kaiser (CIMRM-01, 00626).
Wichtig scheint mir zu sein, dass wir solche Inschriften aus allen Teilen des Römischen Reiches besitzen, in denen der Mithras-Kult verbreitet war, und von Stiftern aller insgesamt vertretenen sozialen Gruppierungen. Zwei seviri coloniae aus Bad Deutsch-Altenburg (Österreich), Lucius Septimius Valerius und Lucius Septimius Valerianus, stifteten gemeinsam ein Mithras-Relief sowie einen Altar und ließen das Mithräum restaurieren (CIMRM-02, 01659, 01661). Den Altar errichteten sie zum Wohl des Septimius Severus, das Relief für denselben Herrscher und seinen Sohn Caracalla. Der Anlass für diese Geste bestand zweifellos in ihrer Freilassung durch den Kaiser. Als seviri, als Vorsteher eines Priesterkollegiums von Freigelassenen, reussierten sie rasch in der Provinzstadt. Dadurch, dass sie ihre kaiserlichen Wohltäter dem „Unbesiegten Sonnengott Mithras“ empfahlen, sahen sie eine geeignete Möglichkeit, dem Herrscherhaus, dem sie das Bürgerrecht verdankten, ihre Loyalität zu zeigen.
Der Mithras-Kult ist nie ein öffentlich staatlich geförderter Kult geworden und hat nie eine Aufnahme in den staatlichen Fest- und Heereskalender erhalten, soweit uns deren Festtage aus dem Exemplar von Dura-Europos (Syrien) bekannt sind; dies gilt auch für alle übrigen Mysterienkulte. Das schließt aber nicht aus, dass die Kaiser und ihre Umgebung mehr als gelegentliche individuelle Sympathie für den Kult gezeigt haben, sondern die Zugehörigkeit ihrer Untergebenen zum Mithras-Kult tolerierten, vielleicht sogar förderten. Eine zumindest personelle Verbindung zwischen Staatskult und Mithras-Mysterien stellt sich für uns in jenen Kultanhängern dar, die Provinzialoberpriester oder städtische Priester waren. Dies gilt auch für jenen Priester des kaiserlichen Haushalts aus der Zeit des Commodus, der gleichzeitig ‚Vater‘ (S. 130) des Mithras-Kultes war.54
Der Sol Invictus Mithras war ein Gott des Vertrages und der Loyalität, er war damit in hervorragender Weise herrschaftskonform. Diese Wirkung verstärkte sich, als der Sol Invictus zunächst von einzelnen Herrschern gelegentlich, dann seit Commodus und den Severern in herausragender Weise dauernd proklamiert wurde. Der Kaiser erschien selbst als Repräsentant des Sonnengottes, er war „unbesiegt“, „Begleiter“ und „Bewahrer“. Er verwandte dabei die gleichen Bezeichnungen, „unbesiegbar“, „Begleiter“ und „Beschützer“, die Mithras, dem unüberwindlichen Sonnengott, schon lange eigen waren. Parallel damit läuft die erstaunliche Ausbreitung des Mithras-Kultes im 2. und im beginnenden 3. Jahrhundert, in jenem Zeitraum also, in dem auch der Sonnengott als Bild auf den Münzrückseiten erscheint. Der öffentliche Zuspruch für Sol Invictus motivierte zum Eintritt in die Mithras-Mysterien. Diese sich an den Denkmälern dokumentierende außerordentliche Ausdehnung findet ihren literarischen Ausdruck in zwei Werken, die etwa in der Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden. Ein gewisser Pallas widmete Mithras eine eigene Darstellung; etwas später wirkte Eubulus, der in mehreren Büchern eine eine „Geschichte über Mithras“ in griechischer Sprache verfasste.55 Beide schrieben vor allem für das stadtrömische Publikum und trugen zweifellos dazu bei, den Kult weiter bekannt zu machen.
Wer in die Mysterien des Mithras eingeweiht war, konnte die öffentliche Anerkennung für Sol, vor allem auf den zahllosen Münzen, als Reverenz vor demjenigen Gott verstehen, dem er diente, ungeachtet der Tatsache, dass andere, die nicht zur Kultgemeinschaft gehörten, dies nicht taten. Aber die Mithras-Anhänger sprachen sicherlich davon, dass Mithras Sol sei und dass es im Mithras-Kult die Möglichkeit gebe, dem offiziell verkündeten Sol Invictus in ihrem Mysterienkult zu begegnen. Es gab, wie auszuführen sein wird (S. 98–102), eine Reihe von Geheimnissen, von geheimen Worten oder von besonderen Bedeutungen, die normalen Formulierungen beigelegt wurden. Viele der im Kult verwendeten Worte und Begriffe behielten aber ihren üblichen Sinngehalt und dienten dazu, den Kult mit der weiteren Welt des Alltags, mit der Normalität und mit alltäglichen religiösen Praktiken zu verbinden; die Bezeichnung des Mithras als Invictus gehörte zweifellos dazu.
Wer Mithras als Sol Invictus Mithras verehrte, konnte durchaus der Meinung sein, er pflege den offiziellen Sol-Kult, wenngleich der Mithras-Kult selbst weder offiziell noch öffentlich war. Die Mithras-Anhänger erkannten ihren Gott als Schutzgott des Herrscherhauses, weil die Kaiser dem Sol Invictus Anerkennung zollten, jenem Sol Invictus, der seit alters her identisch war mit ihrem Gott.