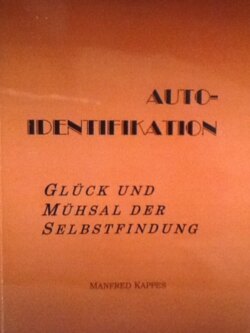Читать книгу Auto-Identifikation - Glück und Mühsal der Selbstfindung - Manfred Kappes - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wer also bin ›ich‹?
Оглавление»Willst du dich selbst erkennen,
so sieh, wie die anderen es treiben;
willst du die anderen verstehen,
blicke in dein eigenes Herz.«
Schillers Musenalmanach 1797
Wer also bin ›ich‹ steht als erste aller Fragen der Menschheit in nahezu jeder frühen urtümlichen und späteren Hochkultur zu Gebote; sie steht damit in erster Rangordnung noch vor der unendlich alten Frage nach Gott – nach der Gnosis – den die Welt beherrschenden Mächten, den Göttern. Sie hat das Privilegium aller Denkübungen, nicht nur in philosophischer, soziologischer, sondern vor allem aus bedeutungsvoller theosophischer Sicht, nach der Gottsuche. Sie stellt die Menschheit andauernd in die allgemein gültige und in die Neuzeit richtungweisende Erkundigung nach der eigenen Existenz.
Wie der Würdetitel des Bildes Gottes ist auch das Person sein des Menschen eine seiner faktischen Wirklichkeit überbietende Kategorie, die sich weder aus seinen empirischen Eigenschaften erschließen, noch an seiner artspezifischen Differenz zu anderen Lebewesen ablesen lässt. Die Kategorie der Person benennt das von Gott angerufene Selbstsein. Es wird nicht gefragt nach seinem ›was bin ich?‹, sondern nach dem ›wer bin ich?‹, was jeden Menschen erst durch seine Einmaligkeit kennzeichnet.
Urfragen zu unserem ›ich‹ formuliert in der Neuzeit der französische Philosoph Blaise Pascal aus Clermont (1623-1662) mit seiner fragenden Deutung:
»Woher kommen wir? «
» Was sind wir? «
» Wohin gehen wir?«
Falls wir faktisch andeutungsweise die Aufklärung zum Ende des 17./18. Jh. vorwegnehmen – aber nicht endgültig erklärend und verifizierend, das bleibt dem ferneren Verlauf dieser Exegese zugänglich – ist sie vorangehend mit der hervorragend brillanten ›Cartesischen Sinngebung‹ von René Descartes (1596-1650) unter Anwendung seiner Fassung: »Cogito ergo sum« installiert, was übersetzt soviel heißt wie: »Ich denke, also bin ich.« – Einer modischen volkstümlichen Ausdeutung zufolge könnte man meinen, es sähe so aus: »Woher weiß ich, wer ich bin? Durch mein Denken.« – Es bleibt dem wohlwollenden Leser überlassen, ob er sich an die populäre Fassung halten will, oder eher dem Ursprung zuneigt.
Beweisführung und Konklusion einer unzureichenden Klärungsmöglichkeit auf die trügerisch anachronistisch beschriebene Frage wird obendrein kommenden Geschlechtern oder künftigen Fraktionen von Philosophen nicht möglich sein! – Ein Triumpf der Konservativen über die zu bewahrenden autochthonen Werte? Oder eine altmodische Beharrlichkeit in vorgegebenen Denkschemata? – Zum Wandel der Werte merkt der französische Romancier Honnorè de Balzac (1799-1850) an: Der einzige Zweck des Romans sei es, Katastrophen zu beschreiben.
Wir werden unten ergründen und erfahren, ob es nicht doch einen Königsweg gibt, um den Wissensdurst und den Erkennt-nisdrang zu befriedigen.
Wer bin ›ich‹? – diese Frage ist qualitativ nicht gleichzusetzen mit dem Pascalschen Motiv ›wo bin ›ich‹? – Sicher ist es der Zerstreuung halber in diesen Spalten gestattet, vom rechten Wege der Erleuchtung abzukommen, um ein Kuriosum zu manifestieren. Denn für das ›wo?‹ gibt es vorher, schauen wir einmal zurück in die Antike, eine Übereinstimmung. Man sollt es kaum für möglich halten, ein solches Wegfindungssystem gab es bereits im Altertum.
Für Humanisten besteht kein Klärungsbedarf, sie wissen kurzerhand und erkennbar, wo das ›ich‹ gegenwärtig anzutreffen ist. Nun lassen wir die frühzeitliche Lösung der Findung von Personen unter schwierigsten Prämissen einmal ans Licht treten, die das erst seit einigen Jahren weltweit bestehende Navigationssystem GPS – Global-Positions-System – ganz schön alt aussehen lässt.
Das GPS ist die heutige moderne Form des Fadens der Ariadne, zufolge des damaligen Mythos: Die auf Kreta und den Ägäischen Inseln heimische Vegetationsgöttin Ariadne, in der griechischen Götterlehre die Tochter des Königs Minos, gab Theseus ein Wollknäul, mit dem er aus dem ihn umgebenden Labyrinth herausfand. Gemeinsam flüchtete Ariadne mit Theseus, wurde aber von ihm, dem Undankbaren, auf Naxos zurückgelassen. Dionysos machte Ariadne zur Gattin; ob sie mit ihm fruchtbarer wurde, ist nicht überliefert.
Von der antiken Kunst im 18. und 19. Jh. wurde Ariadne in Bildwerken des Minotaurus-Abenteurers, später als verlassene Ariadne, abgebildet.
Eine Gedächtnisstütze für Opernliebhaber: Das mystische Motiv wurde in den Opern von Claudio Monteverdi (1567-1643) und Richard Strauß (1864-1949) charakterisiert. – Monteverdi war übrigens der früheste Opernkomponist überhaupt, zugleich war er Kapellmeister des Markusdomes in Venedig. Seine erste Oper hieß Orfeo.
Um eine offizielle kompetente Version zu unserem Thema zu erhalten, befragen wir das philosophische Wörterbuch von Kröner, das zu unserem Zielgedanken ›ich‹ folgenden Ansatz erklärt:
»Ausdruck für den Bewußtseinskern, d. h. für den Träger des Selbstbewusstseins der leiblich-seelisch-geistigen Ganzheit des Menschen, oder einen Teil dieser Gesamtheit gegenüber einem anderen Teil zu bezeichnen, wenn und in sofern dieser andere Teil des Ganzen sich besonders abhebt oder abgehoben werden soll. Außer seiner Eigenschaftsarmut fällt dagegen eine gewisse Seite des Freiheitsbewusstseins auf: der gewaltige Unterschied nämlich, den es für manchen Menschen ausmacht, ob man, ihn zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, sich an ihn selbst wendet, sich der Vermittlung seines ›ich‹-Kerns bedient, oder ob man, äußerlich zu dem selben Endzweck, unmittelbar an seinen Gliedern, an seinen Trieben oder Gelüsten (bei der Verführung) oder unmittelbar an seinen unerwünschten Gewohnheiten angreift. In der frühkindlichen Entwicklung des Menschen aus einem einheitlichen Urbewusstsein, das Außenwelt und ich in ungeschiedener Einheit umfasst. Der Mensch erkennt, dass er im Grunde genommen immer derselbe ist.«
Vom Standpunkt der Psychologie aus wird das ›ich‹ als Quellpunkt des eigenen Verhaltens und als Verankerungspunkt der Person in ihrer menschlichen Umgebung betrachtet, allgemein als Bezeichnung für den Kern oder die Struktur der Persönlichkeit. Mit dem ›ich‹ wird das sich veränderbare steuernde und wertende Prinzip bestimmt, das eine Person befähigt, sich von anderen Personen und Dingen verschieden wahrzunehmen, und das die Erlebnisse und Handlungen einer Person steuert. Dabei unterscheidet man das vorausschauende, prospektive ›ich‹ mit bewussten Willens- und Denkprozessen oder Verhaltensabläufen vom propulsiven ›ich‹ mit seinen nicht festgelegten Antrieben, die sich in unbestimmten Wünschen und Gefühlen äußern. [Humboldt Psychologie Lexikon]
Die provakante Frage der Überschrift, ›wer bin ich?‹, kann gewisslich nicht in den ersten Textseiten dieses Schriftstückes eine hinreichende Beantwortung finden. – Hoffen wir auf ein Näherrücken an den fraglichen Hauptgedanken weiter unten.
Das Debut aus dem Fokus eines Themenkreises heraus kann als eine erkennbar gute Grundlage zur Zielsetzung unseres Gegenstandes gestaltet werden, denn der Ausgangspunkt des Lebens in dieser unserer Welt kann in Ewigkeiten weder prä- oder annähernd posthistorisch, letztlich nicht nach der Epoche, wie lange sie den Menschen sowie Fauna und Flora zu Diensten steht, gesehen werden. Folglich ist die verbriefte Gesetzmäßigkeit einer jeden Inspiration, wenn sie denn einen lobenswerten Hintergrund hat, dort und dann zu entstehen, wo es ihm opportun, daher zufriedenstellend, zweckmäßig und logisch erscheint.
Setzen wir also Lauf und Praxis dieser doch wohl förderlichen Betrachtung über das eigene Bestehen – das eigene ›ich‹ – dort an, wo es uns besonders berechtigt erscheint. Denn erlaubt sei nichtsdestoweniger in jeder ernsthaften Diskussion die in ihrer Form unbekümmerte Frage, wo ist der langwierige Ausflug in ein profundes Arboretum? Als Parabel setzen wir die umfangreichen Ansammlungen von exotischen Bäumen als Nutzhölzer ein, die den Dendrologen beiläufig befrieden könnte. Doch macht die Einsicht einer Zeiteinteilung in der menschlichen Ausdehnung für den Fachmann des zur vorerst unmessbaren Frist angelegten Waldes nicht möglich.
So ist der beherrschende Leitgedanke zur Erforschung des gesuchten ›ich‹ weder an Ort noch Zeit gebunden, er bleibt, so viel ist jetzt schon zu konstatieren, in nebulösen Milchstraßen verborgen. Denn dauernd wird mit der Begegnung des Geschöpfes Mensch das Motiv auftauchen. Mit diesem Gedanken könnten wir die eigentlich unlösbare Aufgabe verlassen und es uns in komfortablen Fauteuils bequem machen, darüberhinaus in philosophische Aporie verfallen und den Zweck der so schwierigen Betrachtung ganz geordnet aus unserem Focus entlassen, um ihn schmähend zu ächten.
Allerdings: Der überall laut werdende Ruf nach Klärung dieser unstrittigen wie heterogen wichtigen Frage nach dem eigenen ›ich‹ lässt es demungeachtet nicht zu, sie im oben beschriebenen Forst so hilfreicher Nutzhölzer verhallen zu lassen, die Relevanz der notwendigen Aufklärung wird uns geraume Muße des Studierens im Verlauf dieses Lesestoffs in Anspruch nehmen. –
Vielleicht, und unser Optimismus leitet uns in die Unebenheiten der Gehirnwindungen, entdecken wir in der Sequenz des Übereinkommens doch beiläufig eine brauchbare Lösung? Oder ist dem erbötigen Bücherwurm mithin die Neigung ausgegangen, Nachforschungen nach sich selbst, denen wir uns vereint hingeben könnten, in die Wege zu leiten?
Nun denn gewagt, mit allem zu Gebote stehendem Ernst und möglichen Denkwerkzeugen des selbst zugemessenen Forschungsauftrages werden wir die Meinung einer Reihe von Fachleuten der verschiedenen Disziplinen konsultieren und hoffen darauf, am Ende des Buches sagen zu können, wer ›ich‹ bin, wer ›wir‹ sind?
Evolution der Kopfarbeit – mithin der manchmal voranschreitende Intellekt des Geistes bei angestrengtem Nachdenken – ist ein ganz hervorragendes Phänomen des Prozesses der Denkarbeit und stellt eine jeweilige Zielrichtung dar, in welche erlesenes oder erarbeitetes Gedankengut über die Jahrtausende – oder für alle des Menschentums gemäßen Abläufe – erhalten bleibt. Oder aber, was verständlicher sein mag, es tritt eine Änderung ein. Wägt man unter der Konklusion dieser Basis die Gedankenwelt der Moderne, so liegen uns die gravierenden Unterschiede in den verschiedenen Epochen konkret vor Augen.
Betrachten wir die chronologisch-äußeren Einflüsse auf Religion, Literatur und Philosophie, um nur drei der Wegbereiter individueller Gedankenentwicklungen der letzten vier Jahrhunderte als Muster heranzuziehen, so stellen wir fest, dass gravierende Unterschiede, nicht nur vermittels Veränderung der Gesellschaftsformen, zu verzeichnen sind. – Erwägung ist dem Anschein nach en vogue und nicht nur als Berufung, der wir uns widmen. Die imaginäre Suche nach dem ›ich‹, nach der Bestimmung des eigenen Vorhandensein, des Daseins, folgerichtig der Seinsfrage im Allgemeinen und typisch unter dem Aspekt eigener optischer Täuschung. Ein Crescendo sollte die Entfaltung von Bildung und Kultur für den Citoyen möglich werden lassen; die bisherige Anthropologie zeichnet im Grundsatz diesen Weg auf, wir müssen ihn nur aufs Geratewohl mit Leben füllen.
Es soll der Ernsthaftigkeit dieser Ausführungen keinen Abbruch tun, wenn es erlaubt ist, mit einem Bonmot den Leser vor erweiterter aufreibender Lektüre aufzumuntern und zu belustigen. Also denn, es sei bewilligt, wenn aus literarischer Sicht etwas zu dem Denkvorgang im Absoluten überliefert ist:
»Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann!«
Diese ideenreiche Gelehrtheit unerwarteter Genese teilte uns Anfang der Zwanziger des letzten Jahrhunderts ein wichtiger Anreger der Kunst des Surrealismus und Dadaismus, der französische Maler und Schriftsteller, Francis Picabia (1879-1953) in übermütiger Posse mit. Auf diese Illusion muss man kommen, und dennoch, die Schlussfolgerung daraus ist nicht einfach nachzuvollziehen; meinten wir doch bisher, das Cerebrum sei autonom, apodiktisch festzustellen, Gradlinigkeit – ebenfalls der Gedanken – frommt dem Versierten. Denkvorgänge sind bei launigen Geschöpfen meist diffuser, langatmiger, es braucht dann nicht gleich eine Amnesie vorzuliegen.
Es steht zu befürchten, dass die Kopfidee des Franzosen Picabia, dessen Teile künstlerischer Werke nahe Düsseldorf in einer Dauerausstellung zu sehen sind, eine Rarität darstellen könnten; eine Weltphilosophie oder einen herausragenden Lehrsatz kann man daraus unschwer ableiten. Das kleine Pariser Völkchen der Dadaisten indes, dem Picabia angehörte, wird darüber amüsiert gewesen sein: »Nach Dada kommt Kaka«, höhnte André Gide (1859-1951). Und außerdem – ohne die Kunstrichtung jetzt näher zu interpretieren – die fürs erste abschließende pünktliche Bemerkung: »Dada war da, als Dada schon da war.« – Nun, wer sagte das in den frühen Zwanzigern des vergangenen Jahrhunderts? Der Pariser Schriftsteller, Dadaist und Surrealist André Breton (1896-1966), er hatte die Idee dazu.