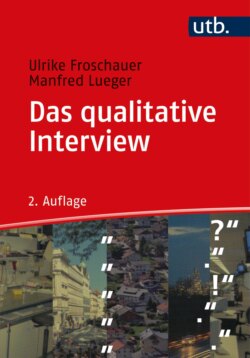Читать книгу Das qualitative Interview - Manfred Lueger - Страница 9
2Grundlagen qualitativer Forschungsgespräche
ОглавлениеStellen Sie sich vor, Sie sollen einem größeren Auditorium eine Vortragende vorstellen, die Sie selbst nicht kennen, von der Sie auch nichts wissen und mit der zu sprechen Sie erst fünf Minuten vor dieser Kurzpräsentation eine Gelegenheit haben. Wie gehen Sie dabei vor?
Natürlich gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, diese Situation zu meistern. Eine davon ist folgende: Da Sie zwar das Auditorium kennen, nicht aber die Vortragende, überlegen Sie sich, was das Auditorium über die vorzustellende Person wissen sollte. Entsprechend stellen Sie Fragen wie beispielsweise nach dem Werdegang, den wichtigsten Stationen ihres Wirkens und vielleicht (damit Sie zur Auflockerung auch etwas sagen können) stellen Sie eine Frage zur Anreise.
Eine solche Vorgangsweise wäre durchaus verständlich und ist in derartigen Kontexten auch üblich. Aber was erfahren Sie auf diese Weise? Zuerst einmal füllen Sie mit solchen Fragen Lücken in Ihrem eigenen Denkschema (z. B.: Was will das Publikum hören, wie kann man die Vorstellung auflockern, was sind zentrale Informationen, um die vorgestellte Person einordnen zu können? etc.). Eine solche Fragetechnik setzt voraus, dass Sie schon im Vorfeld wissen, was relevant ist. Im Zuge dessen erfahren Sie, was Sie für wichtig erachten – aber eben nur dieses (sofern die von Ihnen befragte Person nicht extemporiert). Indem Sie mit Ihren Fragen die Struktur vorgeben, erfahren Sie nichts darüber, was möglicherweise der Vortragenden selbst wichtig sein könnte.
Wenn Sie hingegen wissen möchten, was der befragten Person wichtig ist, müssen Sie ganz anders vorgehen: Sie können schlicht danach fragen, was die Vortragende möchte, dass Sie dem Auditorium über sie erzählen. Die Intention dieser Strategie ist daher eine völlig andere: Nicht Sie geben eine Struktur vor, sondern die befragte Person muss auf der Grundlage einer Frage eine eigene Struktur entwickeln. Diese enthält zwangsläufig eine Präferenz über die Selbstdarstellung. Und selbst wenn Sie nichts anderes zur Antwort bekommen, als die erstgenannte Fragestrategie ihnen offenbart hätte, so besteht dennoch ein fundamentaler Unterschied: Im ersten Fall wissen Sie nichts über die Bedeutung dieser Inhalte; im zweiten Fall können Sie jedoch davon ausgehen, dass diese Inhalte etwas mit der Person oder ihrer Einschätzung der Situation zu tun haben.
Im Zentrum qualitativer Interviews steht die Frage, was die befragten Personen für relevant erachten, wie sie ihre Welt beobachten und was ihre Lebenswelt charakterisiert. Dafür bietet sich eine Vorgangsweise an, die der zweiten Variante entspricht, weil nur diese die Möglichkeit eröffnet, aus der Perspektive der befragten Person heraus den für sie bedeutsamen Kontext zu untersuchen. Das gilt generell für die Analyse sozialer Systeme. Wenn Sie sich etwa für Führungsstrukturen in einem Unternehmen interessieren, können Sie nach diesem Muster danach fragen, was ,Führen‘ im Unternehmen heißt oder welche ,Führungsrichtlinien‘ gelten. Die be-[15]fragten Personen müssen dann für sich klären, was überhaupt Führung bedeutet, sie müssen also ihre Antwort in ein Relevanzsystem integrieren, das sie in der Antwort implizit transportieren. Eine solche Frage kann aber auch eine Gegenfrage auslösen, etwa in der Art, was man denn in dieser Frage unter ‚Führung‘ verstehe, damit man die Frage richtig beantworten kann. Aber selbst diese Gegenfrage ist bereits eine erste Antwort auf die Frage, denn damit fordert die rückfragende Person eine (autoritative) Vorgabe, an der sie sich orientieren oder der sie widersprechen kann. Und damit wird bei genauer Hinsicht das Führungsthema bereits in der Interaktionssituation vorgeführt. Der Nachteil einer solchen Strategie ist, dass die angesprochenen Personen von ihren eigenen Führungserfahrungen abstrahieren und erzählen, was man eben über Führung so erzählt, womit sie die Antwort auf eine öffentliche Situation (wie das Interview eine ist) anpassen. Dadurch erfahren Sie zwar etwas über führungsrelevante Vorstellungen, aber wenig über Führung im alltagspraktischen Kontext.
Darüber hinaus können Sie noch offener vorgehen, indem Sie Ihr primäres Interesse, nämlich Führung, überhaupt nicht thematisieren, sondern das Gespräch generell über den Arbeitsalltag führen. Eine solche Verfahrensweise erscheint zwar etwas paradox, weil vielfach angenommen wird, Interviewer*innen müssten das ansprechen, was sie unmittelbar interessiert. Aber indem man die Themenführung den befragten Personen überträgt, entscheiden diese, ob führungsrelevante Aspekte überhaupt zur Sprache kommen. Wenn dies der Fall ist, dann ist von Interesse, wie diese Thematik zum Ausdruck kommt. Auf diesem Weg erfahren Sie nicht nur etwas über ‚Führung‘, sondern darüber hinaus etwas über die Bedeutung, den Kontext oder damit verbundene Handlungsstrategien. Falls die Gesprächsteilnehmer*innen ‚Führung‘ explizit ansprechen, können Sie diese Thematik vertiefend behandeln.
Damit ist der Gegenstand der folgenden Ausführungen bereits angesprochen: Qualitative Forschung widmet sich der Untersuchung der sinnhaften Strukturierung von Ausdrucksformen sozialer Prozesse. Es geht also darum zu verstehen, was Menschen in einem sozialen Kontext dazu bringt, in einer bestimmten Weise zu handeln, welche Dynamik dieses Handeln im sozialen Umfeld auslöst und wie diese auf die Handlungsweisen zurückwirkt. Im Zuge dessen fokussieren qualitative Analysen die gesellschaftliche Verankerung der Praxis menschlichen Handelns, sozialer Ereignisse und deren Entwicklungsdynamik (allgemein: die Strukturiertheit sozialer Prozesse) und versuchen diese einem theoretisierenden Verständnis zuzuführen. Die Erhebungsmethode übernimmt dabei die Funktion, jene Materialien zu beschaffen, die diesem Anspruch gerecht werden können.
Hinter einer solchen Fragestrategie, die den befragten Personen eine möglichst umfassende Strukturierungsleistung abfordert, stehen – und das wird im Kapitel 7 noch ausführlicher besprochen – eine Reihe von Annahmen. Diese beziehen sich auf die Durchführung der Erhebung und deren Integration in einen Forschungskontext, um ein bestmögliches Verständnis eines untersuchten sozialen Systems zu ermöglichen. Einen allgemeinen Hintergrund bilden die im Folgenden kurz umris-[16]senen Annahmen über den Gegenstandsbereich, die eine interpretativ orientierte Forschungsstrategie leiten:
•Phänomene kommen nur in einem kommunikativen Prozess der Vergesellschaftung zur Geltung. Wie Menschen handeln, ist nicht bloß Resultat subjektiver Überlegungen oder Planungen, die Außenstehenden nicht zugänglich sind (gemeinter Sinn), sondern ist in einen kollektiv geformten lebensweltlichen Horizont aus Relevanzstrukturen und Typisierungen integriert. Dies rückt die Prinzipien der Strukturierung sozialer Beziehungen und der Bedingungen der Verständigung in das Zentrum qualitativer Studien. Die Perspektive einzelner Personen, wie sie in Interviews zum Ausdruck kommt, ist folglich nur der Ausgangspunkt für die Analyse, die in die (Re-)Konstruktion der subjektunabhängigen Regeln der Organisierung von sozialen Systemen mündet.
•Die Praxis menschlichen Handelns weist darüber hinaus eine eigenständige Dynamik auf. Die im sozialen Kontext produzierte Sinnhaftigkeit und die Orientierung des Handelns an anderen Personen bilden einen gemeinsamen Rahmen, der individuelle Handlungsstrategien in einen Kontext integriert. Durch das miteinander verbundene Handeln vieler Akteur*innen entsteht ein gesellschaftliches Milieu, welches diesen als äußerliche Rahmenbedingung entgegentritt und dem sie potenziell ausgeliefert sind. Die Analyse sozialer Systeme mittels Interviews ist ein typischer Fall einer solchen Kontextanalyse: Das Gespräch wird als Manifestation eines Kontextes, nämlich des sozialen Systems interpretiert, in dem die Menschen ihre situativen und allgemeinen Vorstellungen, Erwartungen und Handlungsweisen entwickeln. Dabei sind die Inhalte nur eine Komponente für die Analyse; genauso wichtig sind die Darstellungsformen, weil sich hier die Reproduktionsmechanismen eines sozialen Systems sowie die Spezifika der Außendarstellung am deutlichsten offenbaren.
•Soziale Phänomene unterliegen einer permanenten Fluktuation, in der sich die Reproduktionsstrategien von Kollektiven und die Lebensbedingungen aller Mitglieder einer Gesellschaft (langsam oder krisenhaft) verändern. Aus diesem Grund ist die Entwicklungsdynamik, d. h. die (Re-)Konstruktion der Logik und die Entfaltung von Entwicklungskräften, Bestandteil jeder Analyse. Der Begriff der sozialen ‚Logik‘ meint dabei jene Regeln, die konkretes Handeln mit einer sinnhaft erlebbaren Ordnung versehen. Zum einen bezieht sich diese Ordnung auf die Beziehungen zwischen den Elementen eines Phänomens (Relationalität), andererseits auf die zeitliche Abfolge (Sequentialität) von Interaktionen.
•Den zentralen Analysefokus im Untersuchungsfeld bilden folglich Lebensäußerungen und deren zugrundeliegende Regeln (z. B. die Äußerungsstruktur, die spezifische Kontextbezogenheit, die kommunikative Dynamik). Interpretative Analysen sind hierbei mit dem Problem konfrontiert, sich mit einem Gegenstandsbereich zu befassen, der sich einer Beobachtung nicht unmittelbar präsentiert (z. B. Sinn, Struktur), sondern sich nur erschließen lässt. Erkenntnisse sind daher Konstruktionen aus einer spezifisch wissenschaftlichen Perspektive, die den Erkenntnisgegenstand theoretisierend dem Verständnis zugänglich machen. [17]Dieser konstruktive Charakter erfordert gewissenhafte Maßnahmen zur Qualitätssicherung, um zuverlässige Ergebnisse bereitzustellen.
Im Gegensatz zur quantitativ orientierten Forschung besteht die Zielsetzung folglich nicht in der Prüfung vorgefasster Annahmen, sondern im Aufbau eines (meist fallorientierten) theoretischen Verständnisses eines Untersuchungsbereiches, wie etwa das sozialer Systeme. Viele Studien widmen sich einer solchen theoriegenerierenden Vorgangsweise, indem sie etwa
•die untersuchten Phänomene auf den kulturellen Kontext bezogen im Sinne einer dichten Beschreibung (vgl. Geertz 1991) durchleuchten (z. B.: Was bedeutet Durchsetzung im kulturellen Kontext eines Unternehmens?),
•aus dem untersuchten Bereich eine gegenstandsorientierte Theorie (vgl. Glaser/Strauss 2010: 50ff.) herausdestillieren (z. B.: Was sind typische Durchsetzungsstrategien in einem spezifischen Unternehmen?),
•aus einer umfassenden vergleichenden Studie vieler heterogener Fälle formale Theorien (vgl. Glaser/Strauss 2010: 93ff.) mit einem hohen Verallgemeinerungsgrad zu erstellen versuchen (z. B.: Wie lässt sich die Logik von organisationaler Durchsetzung unabhängig von einem spezifischen Fall verstehen?).
Soziale Systeme, deren Analyse in den folgenden Ausführungen im Zentrum steht, zeichnen sich durch ihre Grenzziehung aus. Dadurch bildet die Generierung gegenstandsorientierter Theorien mit der Möglichkeit einer Weiterentwicklung zu formalen Theorien den Analyseschwerpunkt. In erster Linie soll also ein im Rahmen einer Untersuchung fokussiertes soziales System durch die Analyse dem Verstehen zugänglich gemacht werden. Dies lenkt die Aufmerksamkeit primär auf das theoretische Verständnis von Prozessen, Ereignissen, Differenzierungen oder Strukturierungen innerhalb des sozialen Systems, auf die Untersuchung der Gestaltung und Entwicklung der sozialen Beziehungen nach innen und nach außen zu relevanten Systemumwelten und auf die Erkundung von Zusammenhängen individuellen Handelns und kollektiver Dynamiken. Führt man solche Analysen im Sinne einer fallübergreifend vergleichenden Analyse weiter, so trägt dies zu immer tragfähigeren Verallgemeinerungen im Sinne der Entwicklung formaler Theorien bei. Dichte Beschreibungen spielen eine Rolle, wenn die spezifischen Bedeutungskontexte und subkulturellen Verankerungen von Sinnstrukturen innerhalb einer Fallstudie zum Tragen kommen. Insofern sind die drei Vorgangsweisen zwar miteinander verbunden, setzen aber spezifische Schwerpunkte in der Analyse und stellen infolgedessen unterschiedliche Anforderungen an die Sammlung bzw. Erhebung von Materialien und deren Interpretation.
Das kommunikative Fundament sozialer Systeme (siehe Abschnitt 7.2.1) macht die Durchführung von Interviews zu einem wichtigen Instrument organisationaler Reflexion. Es wäre jedoch völlig unzureichend, sich in der Textauslegung von den vordergründigen Gesprächsinhalten vereinnahmen zu lassen, weil diese nicht mit den Charakteristika des untersuchten Systems gleichzusetzen, sondern Ausdruck der kognitiven Verarbeitung von Systemprozessen sowie deren sprachlicher Ausdruck gegenüber einer (meist außenstehenden) anderen Person sind. Eine seriöse [18]qualitativ orientierte Vorgangsweise versteht daher Gesprächsaussagen als Manifestation sozialer Beziehungen und Verhältnisse, deren Regeln in der Selektivität der Mitteilungen zum Ausdruck kommen. Mitglieder eines sozialen Systems sind daher nicht bloß Expert*innen ihres Systems, sondern repräsentieren in ihren Aussagen das System und ihre Beziehungen zu diesem. Sie müssen dabei nicht alles verstehen und sie können je nach Gesprächssituation aus ihrer Sicht Dinge ansprechen, besonders herausheben, verändert darstellen oder verschweigen. Erst die Berücksichtigung dieser komplexen Dynamik erlaubt es, durch die Inhalte hindurch die Sinnstrukturierung des Systems erkennen zu können.
Diese Ausführungen lassen bereits erkennen, dass sich qualitative Forschungsstrategien nicht für alle Fragestellungen gleichermaßen eignen, sondern deren spezifische Stärken in der Analyse der Organisierung und Manifestation sozialer Prozesse, deren Entwicklungsdynamik und die ihnen zugrundeliegenden Sinnstrukturen liegen. Typische Themen könnten daher beispielsweise sein: Wie organisieren Familien die Beziehungen zu ihrer relevanten Umwelt? Woran orientieren sich Unternehmen bei ihrer Entscheidung über eine Unternehmensberatung? Wie und vor welchem Hintergrund wird ein bestimmtes Problem an einer Universität erzeugt, stabilisiert, verändert und bewältigt? Wie sind in einer Gemeinde die Beziehungen zwischen verschiedenen Bereichen geregelt? Nach welcher Logik entwickeln die Vereinsmitglieder ihre spezifischen Sichtweisen?
Eine theoriegenerierende Vorgangsweise macht es unmöglich, Forschungsfragen bereits am Beginn der Untersuchung endgültig zu präzisieren oder die Erhebung auf einen Teilbereich des Untersuchungsfeldes zu konzentrieren. Vielmehr erkundet die Forschung den allgemeinen Phänomenbereich (etwa die Organisation als Ganzheit, auch wenn nur ein Teilbereich interessieren sollte), wobei aus den erlangten Erkenntnissen sukzessive adäquate Fragestellungen, die Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes sowie dem jeweiligen Forschungsstand angemessene methodische Vorgangsweisen abgeleitet werden. Die gesamte Forschungsstrategie muss die Voraussetzungen für die Generierung neuen Wissens, dessen Prüfung, Erweiterung und Präzisierung schaffen. Auch das Ende eines solchen Forschungsverlaufes lässt sich nicht genau abschätzen, sondern hängt von der Stabilisierung des Wissens, d.h. von der Frage ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit zusätzliche Erhebungen neue Erkenntnisse erschließen könnten. Die Dynamik der sozialen Welt findet insofern ihre Entsprechung in der Vorläufigkeit jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis.
Die Durchführung qualitativ orientierter empirischer Studien erfordert eine Forschungskonzeption, die den Anforderungen qualitativer Sozialforschung gerecht wird. Um die spezifische Vorgangsweise der Gesprächsführung in der qualitativ-empirischen Sozialforschung nachvollziehbar zu machen und zu zeigen, wie Forschungsentscheidungen in diesem Sinne begründet werden, befasst sich dieses Kapitel mit mehreren Komponenten der Gesprächsvorbereitung und -führung: die Verankerung im Forschungskontext, Funktionen im Rahmen der Analyse, die Auswahl der Gesprächspartner*innen und angemessene Gesprächsstrategien. Den [19]Abschluss bildet ein kurzes Anwendungsbeispiel, welches die Grundidee des Ansatzes veranschaulicht.