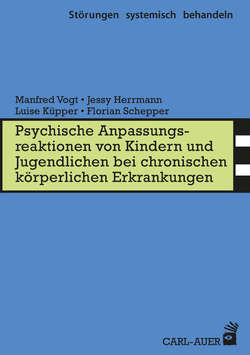Читать книгу Psych. Anpassungsreaktionen von Kindern und Jugendlichen bei chronischen körperlichen Erkrankungen - Manfred Vogt - Страница 51
1.6.4Folgen für die betroffenen Patienten und ihre Familie
ОглавлениеDie Diagnose einer lebensverkürzenden Krankheit ist für die betroffenen Kinder und Jugendlichen eine große Belastung. Je nach Alter des Kindes gilt es zu differenzieren, wie die notwendigen Informationen vermittelt werden können. Gerade Jugendliche können die Tragweite einer infausten Prognose kognitiv erfassen, haben aber aufgrund ihres Alters rechtlich gesehen oft keinen Einfluss auf weitere Behandlungsentscheidungen (Stillion a. Papadatou 2016).
Zu beachten ist, dass gerade depressive Episoden häufig mit einer verminderten Therapieadhärenz assoziiert sind (Quittner, Saez-Flores a. Barton 2016). Ein Großteil der Betroffenen erreicht trotz der zusätzlichen Herausforderungen alterstypische Entwicklungsstufen wie die Unabhängigkeit vom Elternhaus und den Eintritt in die Erwerbstätigkeit (Besier a. Goldbeck 2012). Als besonders belastend wird das Wissen um das Fortschreiten der Krankheit und den bevorstehenden Tod wahrgenommen. Mit steigendem Alter der Erkrankten sinkt deren Lebenszufriedenheit, vermutlich weil sich die Symptome verstärken und vermehrte bzw. invasivere therapeutische Maßnahmen vonnöten sind (Besier a. Goldbeck 2012). Große Sorge bereiten der Vergleich mit ebenfalls erkrankten Wegbegleitern, deren Zustand sich akut verschlechtert hat, und der Gedanke daran, dass das Sterben möglicherweise mit großen Schmerzen und Unwohlsein verbunden ist. Patienten nehmen die Erkrankung als unvorhersehbar und folglich beängstigend wahr. Ein Großteil der Betroffenen wünscht sich, schnell und ohne Leid sterben zu dürfen (Higham, Ahmed Ahmed 2013). In der Realität tritt der Tod aber bei den meisten Erkrankten in der Klinik ein, wobei 75 % von ihnen in den letzten zwölf Stunden noch Antibiotika und weitere Medikamente verabreicht werden (Robinson et al. 1997).
In der finalen Phase lebensverkürzender Erkrankungen ist der Kontakt zu Gleichaltrigen häufig eingeschränkt, zum einen aufgrund der Symptome der Kinder oder Jugendlichen, zum anderen aufgrund der Sorge, dass im Falle enger Beziehungen mit anderen diese nach dem Versterben verletzt und traurig sein könnten (Stillion a. Papadatou 2016).
Die Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung eines Kindes bedeutet für die Familie eine massive Traumatisierung. Erhöhte Angstsymptome und eine verringerte Lebensqualität (Besier et al. 2011), Schuldgefühle bei genetisch begünstigten Erkrankungen (Kappler u. Griese 2009), Unsicherheiten hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Krankheit und Gedanken über das unausweichliche Lebensende des Kindes (Holroyd a. Guthrie 1986) begleiten die Familie fortan. Neben der emotionalen Belastung muss der Familienalltag oft komplett neu strukturiert werden: Die Versorgung eines Kindes mit zystischer Fibrose mit täglicher Physiotherapie, Atemtherapie, hochkalorischer Diät, Inhalation, Medikamentengabe, Abklopfen der Brust, Enzymkapseln etc. bedeutet einen immensen zusätzlichen Zeitaufwand für alle Beteiligten (Foster et al. 2001). Eltern sind häufig dazu gezwungen, ihre Anstellung zu beenden oder zu wechseln bzw. Karrierechancen aufzugeben, um ihre Kinder zu den vielen Therapien begleiten zu können (Neri et al. 2016). Resultierende finanzielle Engpässe stellen ein weiteres Problem dar. Für Geschwisterkinder ist die Situation ebenfalls eine große Herausforderung. Die Behandlung findet oft im häuslichen Umfeld statt, und die Aufmerksamkeit der Eltern ist primär dem erkrankten Kind gewidmet (Foster et al. 2001). Dennoch berichten manche Geschwister von an Mukoviszidose erkrankten Kindern von einer höheren Lebensqualität als Geschwister gesunder Kinder (Havermans et al. 2011).