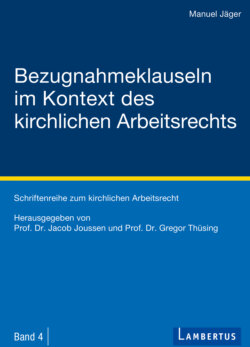Читать книгу Bezugnahmeklauseln im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts - Manuel Jäger - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.Stellungnahme zum Rechtsgehalt des „Dritten Weges“ a)Stellungnahme zu den Literaturansichten
ОглавлениеWeder der öffentlich-rechtliche noch der privatrechtliche Ansatz kann überzeugen. Daher ist im Ergebnis und im Einklang mit der seit 2005 ständigen Rechtsprechung des BAG eine normative Wirkung der AVR des „Dritten Weges“ abzulehnen.
Der öffentlich-rechtliche Ansatz verkennt die Stellung des verfassungsrechtlichen Selbstbestimmungsrechts im Gefüge des kirchlichen Arbeitsrechts. Das Selbstbestimmungsrecht garantiert in diesem Zusammenhang nur das staatliche Anerkenntnis einer eigenständigen und autonomen kollektiven Arbeitsrechtssetzung, nicht aber eine vom Staat verliehene oder abgeleitete Souveränität.175 Greifen die Kirchen beim Abschluss von Dienstverträgen auf die staatliche Privatrechtsordnung zurück, sind sie auch an die Grenzen dieser Ordnung gebunden. Die fehlende Kompetenz der Kirchen eine normative Geltung der AVR anzuordnen, ist die Folge der Wahl des säkularen Arbeitsrechts.176 An diesem Verhältnis von weltlichem und kirchlichem Arbeitsrecht vermag auch die Selbstbestimmungsgarantie i. S. v. Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV nichts ändern.
Die kirchliche Autonomie hört dort auf, wo die Kirche zur Begründung von Arbeitsverhältnissen auf die jedermann offenstehende Privatautonomie zurückgreift. In diesem Bereich ist das kirchliche Arbeitsrecht nicht als eigenständige Rechtsquelle zu verstehen, sondern es fügt sich in das säkulare Arbeitsrecht ein. Im Rahmen der Selbstbestimmungsgarantie können die Kirchen also die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass der kirchliche Dienst mit dem Selbstverständnis vom kirchlichen Auftrag in der Welt erfüllt werden kann. Die in das weltliche Arbeitsrecht hineinreichende Anordnung einer normativen Wirkung steht aber nicht im Zusammenhang mit dem kirchlichen Selbstverständnis und ist für die Erfüllung ihrer selbst gesetzten Aufgaben nicht erforderlich.
Der privatrechtliche Ansatz zur normativen Wirkung der AVR sieht im Abschluss des Arbeitsverhältnisses einen Unterwerfungsakt, der die Legitimationsbasis zur Rechtsnormqualität der von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen festgelegten AVR darstellt. Allerdings kann auch der zur Begründung dieses Ansatzes hergestellte Vergleich von kirchlichen Arbeitsbedingungen des „Dritten Weges“ mit Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, wenn es die Anordnung einer normativen Geltung im staatlichen Recht nicht gäbe, nicht überzeugen.
Das liegt zunächst daran, dass auch im Tarifvertragsrecht bei fehlender Verbandsmitgliedschaft einer Arbeitsvertragspartei ein Tarifvertrag nur einzelvertraglich durch Inbezugnahme des Tarifvertrages zur Geltung gelangt.177 Daher lässt sich auch nicht mit einem Beitritt zur Gewerkschaft die Anerkennung einer normativen Wirkung kollektivrechtlicher Regelungswerke begründen.
Zudem kann aus dem Abschluss eines Dienstverhältnisses kein Unterwerfungsakt hergeleitet werden, der zu einer normativen Wirkung der AVR führt. Es fehlt regelmäßig sowohl am äußeren Tatbestand einer Unterwerfungserklärung als auch am spezifischen Erklärungsbewusstsein.178 Zwar hat ein Dienstnehmer durch Abschluss eines Dienstvertrages die Möglichkeit der Teilhabe am Beschluss einer Arbeitsrechtlichen Kommission. Dies genügt jedoch ebenso wenig wie der bloße Verbandsbeitritt im Tarifvertragsrecht, um eine Rechtsnormqualität der AVR zu begründen. Durch den Abschluss des Dienstvertrages gibt der einzelne Dienstnehmer nach außen lediglich zu erkennen, dass er die Regeln zur Beschlussfassung kirchlicher Arbeitsbedingungen akzeptiert. Darin einen Normunterwerfungsakt zu sehen, der letztlich eine normative Wirkung der Arbeitsbedingungen des „Dritten Weges“ legitimiert, würde jedoch zu weit gehen. Die inhaltliche Unterwerfung unter die konkreten Arbeitsrechtsregelungen erfordert jedoch einen weiteren erkennbaren Gestaltungsakt, wie etwa die Vereinbarung einer Bezugnahmeklausel.
Darüber hinaus kann auch aus der Rechtsfigur des Gestaltungsrechts keine Normsetzungsbefugnis der Arbeitsrechtlichen Kommission hergeleitet werden. Ein derartiges Gestaltungsrecht käme dem Leistungsbestimmungsrecht eines Dritten nach § 317 BGB gleich.
Ein Leistungsbestimmungsrecht eines Dritten nach § 317 BGB kann aber in doppelter Hinsicht nicht als Legitimation einer Rechtsnormqualität der AVR überzeugen. Voraussetzung ist zunächst, dass die paritätisch aus Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern zusammengesetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen, trotz der widerstreitenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen und dem Rückgriff auf eine Schlichtungskommission im Konfliktfall, als „einheitlicher Dritter“ verstanden werden.179 Stellt man auf den Gedanken der Dienstgemeinschaft ab, mag sich die Arbeitsrechtliche Kommission noch als „einheitlicher Dritter“ konstruieren lassen. In der Praxis kann aber wegen der zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmerseite teils sehr kontrovers diskutierten und verhandelten gegensätzlichen Standpunkte, die Arbeitsrechtliche Kommission nicht als „einheitlicher Dritter“ angesehen werden. Das Modell des Gestaltungsrechts weist darüber hinaus eine weitere Schwäche auf: Der „Dritte“ nach § 317 Abs. 1 BGB hat die Leistungsbestimmung im Zweifel nach „billigem Ermessen“ auszuüben. Arbeitsbedingungen nach „billigem Ermessen“ stehen aber im Widerspruch zum christlichen Selbstverständnis und insbesondere zu dem Ziel der paritätisch ausgehandelten Arbeitsrechtsregelungen.180
Auch die letzte Begründung des privatrechtlichen Ansatzes, die Rechtsfigur einer sachlich und zeitlich begrenzten unwiderruflichen Ermächtigung, kann nicht als Begründung einer normativen Wirkung des „Dritten Weges“ überzeugen. Diese Ermächtigungskonstruktion sieht in dem Erlass der Arbeitsbedingungen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen den Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrages, der Wirkungen für und gegen die Dienstnehmer erzeugen soll. Diese Konstruktion würde jedoch zu einer dem BGB fremden „Verpflichtungsermächtigung“ führen, bei der es sich anders als bei der Verfügungsermächtigung um eine unzulässige Rechtsfigur handelt.181