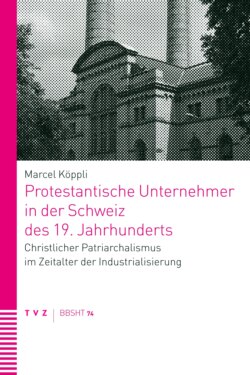Читать книгу Protestantische Unternehmer in der Schweiz des 19. Jahrhunderts - Marcel Köppli - Страница 10
1.2 Forschungsstand
ОглавлениеWie bereits angedeutet, liegt zum SABBK bislang keine gründliche historische Untersuchung vor, obwohl verschiedentlich darauf hingewiesen wurde, dass eine solche gerade aufgrund des dürftigen Forschungsstandes zu begrüssen wäre. Josef Mooser schreibt dazu: «Die Ursachen für diese deutsch-schweizerische Verbindung [des SABBK] in der konservativ-protestantischen, grossindustriellen Sozialreform harren noch der Aufklärung.»2 Auch wenn der SABBK und insbesondere die Ursachen für dessen Entstehung noch nie gründlich aufgearbeitet wurden, so finden sich dennoch einige Monographien und Aufsätze, in denen der SABBK dargestellt wurde. Der ausführlichste Beitrag zum SABBK, insbesondere zu seiner Entstehung innerhalb der Inneren Mission, bietet die bereits erwähnte Monographie Shanahans.3 Martin Gerhardt berichtet über die Hintergründe, die zur Bonner Konferenz geführt haben.4 Unter der Überschrift «Die Bonner Industriekonferenz von 1871 und ihr Ableger in der Schweiz»5 beschreibt Erich Gruner den SABBK und seine Bedeutung für die sozialpolitische Diskussion in der Schweiz. Arthur Bernet verweist in zwei seiner Publikationen auf den Einfluss des SABBK auf die Entwicklung der betrieblichen Sozialpolitik in der Schweiz.6 Da Sarasin das wichtigste Mitglied des SABBK war, finden sich auch in Beiträgen zu seiner Person Hinweise auf diesen Ausschuss.7 In sämtlichen Untersuchungen wird betont, dass die Unternehmer des SABBK in der schweizerischen Debatte um die soziale Frage eine zentrale Rolle spielten. Worin diese Rolle bestand und welche |14| sozialpolitischen Haltungen der SABBK favorisierte, blieben allerdings bislang weitgehend unbeantwortete Fragen.
Von zentraler Bedeutung für die Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstandes ist aber nicht allein diejenige Forschung, in welcher der SABBK explizit diskutiert wird. Es gilt auch nach dem gegenwärtigen Stand der Erforschung des sozialen Protestantismus, insbesondere der Inneren Mission und Johann Hinrich Wichern (1808–1881), zu fragen. Vereinfachend sieht Jochen-Christoph Kaiser drei Phasen: «Eine herkömmliche Sichtweise, die noch heute nachwirkt, eine revisionistische, die mit dem Aufbruch der 1968er Jahre verknüpft ist, und eine noch vergleichsweise junge, die seit etwa 15 Jahren zu diesen Fragen arbeitet und die Methodenvielfalt der Sozial-, Religions- und Kirchengeschichte integrieren will».8 Die «revisionistische» Phase macht Kaiser in der Forschung um den Bochumer Sozialethiker Günter Brakelmann aus. In dieser Phase sei herausgearbeitet worden, dass das reaktionäre und antidemokratische Politikverständnis des Protestantismus «letztlich für das Scheitern des Protestantismus vor den Herausforderungen der sozialen Frage mit verantwortlich gewesen sei».9 In der dritten Phase beobachtet Kaiser eine Wegbewegung von den «Revisionisten». Er schreibt zu dieser jüngsten Phase: Sie «entdeckt das innovative Handlungspotential Wicherns für die Entfaltung des sozialen Protestantismus und seiner gesellschaftlichen Wirkungen wieder neu. Sie argumentiert nicht auf der Folie von heute aus wünschbarer Entwicklungen, sondern nimmt zeitgenössische Aussagen ernst und ordnet die Quellen in ein gesellschafts- respektive kulturgeschichtliches Gesamttableau ein».10 Stephan Sturms Forschung zu Wichern kann dieser jüngsten Phase zugeordnet und soll hier als Beispiel angeführt werden. In seiner Dissertation betont Sturm vehement, die Innere Mission habe zeitgemäss und adäquat auf die soziale Frage reagiert. Gerade in Bezug auf die Zeit der |15| Bonner Konferenz kommt Sturm zu einer äusserst positiven Einschätzung der Inneren Mission: «Die Analyse der in der einschlägigen Forschungsliteratur häufig nur sporadisch oder gar nicht berücksichtigten Spätphase der Wichernschen Wirksamkeit zeigt darüber hinaus deutlich, dass Wichern die Spezifika der Industrialisierung durchaus erkannt und die Arbeiterfrage zu einem eigenständigen Thema der Inneren Mission erhoben hat.»11
Die vorliegende Arbeit knüpft an Brakelmanns Forschung, also gemäss Kaiser an die zweite Phase an, indem einerseits nämlich gewürdigt wird, dass der SABBK mit seiner sozialpatriarchalen, sozialdiakonischen und ansatzweise sozialkonservativen Haltung die soziale Frage als Problem erkannte. Zudem wird auch – wiederum im Anschluss an Brakelmann – kritisch davon ausgegangen, dass in der Inneren Mission die sozialpolitische Dimension der sozialen Frage nicht genügend erkannt wurde, da ihre Vorschläge sich an einem veralteten patriarchalischen Gesellschaftsmodell orientierten und deshalb die grundlegenden Veränderungen der Industrialisierung unberücksichtigt blieben. Ob die jüngste Phase und insbesondere Sturms Forschung tatsächlich wesentlich neue und nachvollziehbare Aspekte in die Diskussion eingebracht hat, soll schliesslich am Ende der Untersuchung diskutiert werden.12