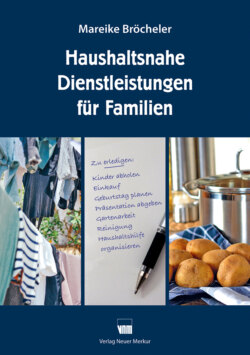Читать книгу Haushaltsnahe Dienstleistungen für Familien - Mareike Bröcheler - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1.2 Leitbilder für Männer
ОглавлениеFür Männer ist in den letzten Jahrzehnten ebenfalls ein deutlicher Wandel der hegemonialen Geschlechterrolle(n) zu spüren, der sich in einer Pluralisierung von Männlichkeit und damit verbunden dem Bild von „neuen“ oder „aktiven“ Vätern ausdrückt.50 Das Bild von vollzeiterwerbstätigen Vätern, die als Familienernährer vorrangig ihre Funktion der Unterhaltssicherung erfüllen, im Familienalltag wenig bis gar nicht präsent sind und daher kaum Sorgearbeit übernehmen, wird abgelöst von Vätern, die sich gleichermaßen am Familienleben beteiligen, aktiv und in größerem Umfang und von Geburt an Aufgaben der Kinderbetreuung wahrnehmen, dafür im Idealfall ihre Erwerbsarbeit reduzieren und nicht allein die Unterhaltsverantwortung tragen müssen und sollen (schließlich sind auch ihre Partnerinnen erwerbstätig). Das Leitbild des Familienernährers scheint daher ebenfalls auf dem Rückzug zu sein. Allerdings korrigieren zahlreiche Befunde diesen Eindruck und stellen fest, dass insbesondere Männer selbst weiterhin den Anspruch an ihre Versorgerrolle aufrechterhalten (vgl. Kortendiek 2010; Wippermann 2013; Lück 2015). Wippermann (2013) konstatiert eine ambivalente Ausprägung der Erwartungen an Männer und von Männern heute, indem zwar einerseits immer wieder (für bestimmte Gruppen) moderne, egalitär ausgerichtete Leitbilder gezeichnet, andererseits aber auch die Präsenz und Persistenz traditionellerer Entwürfe betont werden, was bei ihnen zur Überforderung führen kann. Es erklärt zudem, warum ein zwar im historischen Vergleich gesunkener, aber dennoch bedeutender Anteil von 70 % aller Männer angibt, dass sie von einer Frau erwarten, eine Familie gut versorgen zu können, und damit die Hauptverantwortung für die familiäre Sorgearbeit von sich weist. Ähnlich wie für Frauen lässt sich auch bei den Männern eine größere Bedeutsamkeit egalitär ausgerichteter Leitbilder in den modernisierten (Leit-)Milieus feststellen, sodass soziale und Umfeldfaktoren für die Ausprägung von Leitbildern bedeutsam erscheinen (vgl. Wippermann 2013).
Zum Alltag von Familien gehören darüber hinaus weitere Leitbilder, etwa von guter Elternschaft und Kindheit, die heute das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt familiären Alltagslebens stellen und deren Versorgung mit zum Teil hohen Anforderungen an Bildungs- und Erziehungsaufgaben verbinden, denen Eltern versuchen gerecht zu werden. Zusätzlich können Leitbilder u. a. hinsichtlich der Selbstverständlichkeit von Kindern, der idealen Anzahl von Kindern oder der Partnerschaft als solche formuliert werden und verdeutlichen exemplarisch die Vielfalt von internen und externen Einflüssen auf und Anforderungen an die Lebens- und Alltagsgestaltung in Familien (vgl. Henry-Huthmacher, Borchard 2008; Schneider, Diabaté, Ruckdeschel 2015). In der Zusammenschau wird somit deutlich, wie junge Eltern heute divergierenden Vorstellungen, Leitbildern und persönlichen Wünschen gegenüberstehen, wenn es um Fragen der Balance von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit geht.
36 Inzwischen finden sich auch erste Charakterisierungen der nachfolgenden sog. „Generation Z“, die die Kohorte der um die Jahrtausendwende (ab 1995) geborenen Menschen erfasst. Viele Aspekte der wesentlichen Werte und Grundeinstellungen der Generation Y setzen sich darin tendenziell fort und verstärken sich. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der Generation Z um die aktuelle Generation der Kinder und Jugendlichen handelt, ist die Forschung hierzu jedoch noch wenig ausgeprägt (vgl. Klaffke 2014).
37 In der repräsentativen Studie werden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt (Stichprobengröße: 2.558); neben der quantitativen wurde eine qualitative Teilstudie auf Basis von 21 Tiefeninterviews mit Jugendlichen durchgeführt (vgl. Shell Deutschland Holding GmbH, TNS Infratest Sozialforschung 2015).
38 So äußern 2015 lediglich 64 % einen klaren Wunsch nach eigenen Kindern, während es 2010 noch 69 % der befragten Jugendlichen waren. Gleichzeitig ist zu sehen, dass auch in den vorherigen Ausgaben der Studie Schwankungen im Kinderwunsch deutlich waren. Der Tiefstwert von 62 % (Mittelwert beider Geschlechter) wurde 2006 gemessen. Die Autor/innen der Studie sehen hier einen starken Zusammenhang zu den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die noch 2006 etwa u. a. aufgrund einer hohen Jugendarbeitslosigkeit mehr Unsicherheit verbreitet haben können (vgl. Shell Deutschland Holding GmbH, TNS Infratest Sozialforschung 2015).
39 Das Sample dieser Studie bestand aus Familien, die sich entweder durch die Einzelmerkmale „niedriges Einkommen“, „alleinerziehend“ und „große Familie“ (drei oder mehr Kinder) oder eine Kombination aus diesen auszeichnen (vgl. Schröder, Siegers, Spieß 2013).
40 Datenbasis ist eine repräsentative Stichprobe von 5.000 Personen zwischen 20 und 39 Jahren, die mittels CATI-Verfahren befragt wurden (vgl. Lück, Naderi, Ruckdeschel 2015).
41 Die Autorinnen und Autoren der Studie verweisen für verschiedene Aspekte von Leitbildern auf Unterschiede zwischen den persönlichen Leitbildern und Leitbildern, die Personen innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen. Auf diese Unterschiede kann an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen werden.
42 Datenbasis sind 3.151 Interviews mit Müttern und Vätern aus 2.080 Familien mit Kindern unter sechs Jahren (in etwa der Hälfte der Familien wurden jeweils Mutter und Vater befragt), sowie 40 qualitative Tiefeninterviews mit Eltern von Kindern unter drei Jahren (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2015b).
43 Daten aus der Zeitverwendungserhebung 2012/13, der eine repräsentative Stichprobe von rund 11.000 Befragten zugrunde liegt. Befragt wurden alle Personen ab 10 Jahren, die jeweils an zwei Werktagen und einem Wochentag ein Tagebuch mit 10-Minuten-Intervallen zur Zeitverwendung geführt haben (vgl. Destatis 2015b)
44 Dieser und die folgenden Befunde basieren auf einer Analyse des Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS), mit einer repräsentativen Stichprobe von 15.000 Befragten (vgl. Lietzmann, Wenzig 2017).
45 Haben die befragten Mütter selbst Kinder unter drei Jahren, erhöht sich auch deren Zustimmung zu einer Teilzeit- oder Vollzeiterwerbstätigkeit bereits in dieser Lebensphase des Kindes (vgl. Lietzmann, Wenzig 2017).
46 Dies gilt für Westdeutschland ebenso wie Ostdeutschland, auch wenn die neuen Bundesländer zu Beginn der Ausbauinitiative bereits ein höheres Versorgungsniveau aufwiesen als die Länder im Westen der Bundesrepublik. Regionale Unterschiede bestehen fort: So liegt der artikulierte Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren 2017 in Ostdeutschland bei rund 59 %, in Westdeutschland immerhin bei rund 42 %, wobei sich hier eine größere Lücke zum aktuellen Platzangebot ergibt (vgl. BMFSFJ 2018b).
47 Auf die theoretischen Grundlagen und Erkenntnisse zum Zusammenhang von Identität, (biologischem) Geschlecht und Gender (soziales Geschlecht, Geschlechterrolle) kann an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen werden. In den letzten Jahrzehnten haben hier insbesondere die Arbeiten von Hagemann-White (1984), Butler (1991) sowie West und Zimmerman (1987) zu einem neuen, sozialkonstruktivistischen Verständnis von der Kategorie „Geschlecht“ geführt (Überblick über diese Forschungsperspektive geben im deutschsprachigen Raum u. a. die Arbeiten von Villa, Gildemeister und Wetterer). Der lange alleingültigen
Annahme, Geschlecht sei rein biologisch und damit natürlich bedingt, wird damit widersprochen. Die Autorinnen und Autoren verweisen auf die Heteronormativität unserer Gesellschaft, die hauptsächlich zwei Geschlechter (männlich und weiblich) kennt. Auch die Tatsache, dass seit dem 01. Januar 2019 ein drittes Geschlecht („divers“) im Personalausweis geführt werden kann, ändert daran bisher wenig. Die Gender- und Queer-Studies thematisieren zudem die Realität verschiedenster Geschlechterrollen, Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten, die sich jenseits dieser hegemonialen Binarität verorten.
48 In der hier zugrunde liegenden Studie (Wippermann 2016) wird mit der Systematik der DELTA-Milieus® gearbeitet. Auch bei einigen weiteren milieutheoretischen Zuordnungen innerhalb dieser Arbeit wird sich, soweit nicht anders benannt, auf diese Systematik bezogen.
49 Dies sind lediglich zwei, hier beispielhaft genannte Grundtendenzen mütterlicher Leitbilder, die vielfältige Formen annehmen können (vgl. Diabaté 2015).
50 Ein Blick in die Literatur zur Männer- und Väterforschung zeigt zweierlei: Zum einen ist der Begriff der „neuen Väter“ nicht so neu, wie es oft scheint – liegen die Anfänge der Diskurse hierzu doch bereits in den 1970er Jahren. Zum anderen hat sich in den letzten Jahrzehnten ein höchst differenziertes Forschungsfeld aufgetan, welches im Rahmen dieser Arbeit nicht wiedergegeben werden kann. Im Kontext familienwissenschaftlicher Diskussionen hat zudem die Einführung des Elterngeldes, als eine familienpolitische Maßnahme, mit der auch Männer klar adressiert und in der Erfüllung der „neuen Erwartungen“ unterstützt werden sollten, einen weiteren Aufschwung an Forschung in diesem Feld bewirkt. Gleichzeitig gibt es politische und gesellschaftliche Bereiche, die in den auch medial wirksamen Diskursen oftmals nicht im Zentrum stehen: So werden Benachteiligungen von Männern, etwa im Gesundheitswesen, auf dem Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich („Jungen als Bildungsverlierer“, Bräutigam 2012), aufgedeckt; als nicht oder (bisher) wenig bearbeitete Problemfelder werden diese etwa auch für den zunehmenden Antifeminismus verantwortlich gemacht (vgl. exempl. Bundeszentrale für politische Bildung 2012).