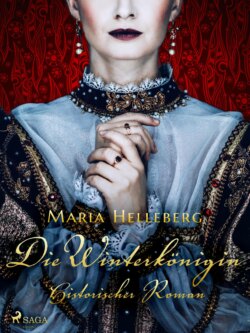Читать книгу Die Winterkönigin - Ein historischer Roman - Maria Helleberg - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.
ОглавлениеMargarete kletterte auf das Fensterbrett und versteckte sich. Die Fenster hatten kleine Sitzbänke mit Kissen, und unter den Kissen würden sie sie nicht finden. Die Fenster waren aus klarem Glas, und man konnte sie auch öffnen. Aber das durfte sie nicht.
Es regnete, und sie war wütend. Die Sonne war verschwunden, und nichts passierte. Sie hatte am Morgen solche Bauchschmerzen gehabt, und jetzt dröhnte es in ihrem Kopf. Obwohl sie ganz lange geschlafen hatte, war sie so müde, daß sie sich am liebsten auf den Boden gelegt hätte und gleich wieder eingeschlafen wäre.
Es kam ihr so vor, als ob sie schon seit einer Ewigkeit hier auf Vordingborg sei, ohne Vater und ohne Mutter. Jeden Morgen stand sie auf, zog dieselben Kleider an, bekam dieselbe Grütze zu essen und wurde sich dann selbst überlassen.
Kristoffer fehlte ihr. Soweit sie wußte, ging es ihm schon wieder viel besser.
Sie war kurz davor, Ingeborg zu vermissen. Zwar hatte sie immer mit ihrer großen Schwester gestritten, aber wenn Ingeborg auf Vordingborg wäre, würde doch immerhin irgend etwas passieren.
Ingeborg war nach Mecklenburg geschickt worden. Das vergaß Margarete jede Nacht und wunderte sich dann am Morgen, wo ihre große Schwester war. Ingeborg würde wohl nie wieder zurückkommen.
Sie könnte sich ja auch runter zu den Mönchen schleichen. Aber letztes Mal hatte sie ein Tintenfaß umgeworfen, so daß ihr der Zutritt verboten wurde. Sie könnte auch zu den Ställen gehen, doch die Pferde waren so groß und gefährlich, wenn man nicht auf ihrem Rücken saß. Sie könnte sich auch verstecken und darauf warten, daß man sie suchte, aber das langweilte sie auch, und darum fing sie an, an Ort und Stelle vor sich hin zu summen und zu singen.
Einige Zeit später fanden sie sie.
Sie wurde vom Fensterbrett heruntergehoben, und die große Frau, die sie nicht kannte, knetete ihre kalten, fast steifen Hände.
»Du bist ja vollkommen durchgefroren, Kind!« sagte sie und nahm ihr Gesicht in ihre rauhen Hände, die schrecklich kalt waren.
Früher hätte sie gebissen, jetzt aber zuckte sie nur zusammen. Die Hände waren noch kälter als ihre Wangen.
»Allmächtiger Gott«, sagte die Frau und nahm sie in ihre Arme, »das überlebt sie nicht.« Auch ihre Kleidung war kalt, und ihr grober Mantel kratzte an ihrem Hals.
Die Frau packte sie mit einer Hand am Genick, so daß sie beinahe keine Luft bekam. Sie schloß die Augen und hoffte, bald abgesetzt zu werden. Ihre Füße baumelten vor dem Bauch der Fremden. Sie war sechs Jahre und eigentlich schon zu alt, um noch getragen zu werden. Nur Vater trug sie ab und zu, und das auch nur, weil sie so klein und leicht war.
Endlich wurde sie auf ein großes Bett gelegt. Sie zitterte schon bei dem Gedanken an die klammen, blanken, eisigen Bettlaken und Decken. Aber die Frau nahm ihren pelzgefütterten Mantel und deckte sie damit zu, hob ihre Füße hoch, wickelte sie darin ein und schob warme Steine ins Bett.
Es war ein komisches Gefühl, wie ein kranker Säugling behandelt zu werden.
Mutter hatte zwei kleine kranke Kinder bekommen, die gestorben waren. Sie hatten viel geschrien und waren dann in kleinen Holzkisten verschwunden. Und dann gab es da die Pest, die sie noch nie gesehen hatte, nur ihr Spuren. Vater wollte nicht, daß über die Pest gesprochen wurde, das würde sie herbeibeschwören. Doch sie hatte Tote am Wegesrand gesehen. Das waren ihre Spuren.
Sie brachten einen Zuber mit warmem Wasser, zogen ihr die Kleider aus und setzten sie hinein. Sie gossen Wasser über ihren Kopf und drückten sie tief in den Zuber hinein, so daß es ihr den Atem nahm. Gleichzeitig wurde sie ganz schläfrig.
»Er verzeiht es uns niemals, wenn sie stirbt«, hörte sie die große Frau sagen, die noch weitere Steine unter die Decke schob. Dann machte sie sich daran, ihr langes schwarzes Haar zu kämmen, das sich so oft verfilzte. Normalerweise schrie sie dabei immer vor Schmerzen, aber die fremde Frau war so behutsam, daß sie ganz ruhig war.
»Kleines Mädchen«, sagte die Frau, »du darfst nicht krank werden. Wir haben einen Boten zu deinem Vater geschickt. Wir trauen uns nicht, deiner Mutter eine Nachricht zu senden, bevor wir nicht sicher sind, daß du dich wieder erholst.«
Ihr war das ganz egal. Sie konnte sich auch nicht mehr erinnern, wie sie hieß oder wo sie gerade war. Nur die Hände, die ihr über das Gesicht streichelten, waren im Moment wichtig.
Das letzte Mal, als ihr Vater zu Besuch kam, hatte sie gesehen, wie die Fahne mit dem Löwenbanner auf dem Turm gehißt wurde. Kristoffer hatte ihr gerade erzählt, was es damit auf sich hat. Sie war schnell vom Salzhaus weggerannt und die äußere Treppe hinunter in den Burghof gelaufen. Auf dem Weg dorthin lag ein kleiner Hügel, den sie Schweinekamm nannten. Dort stolperte sie.
Vaters Pferd scheute und bäumte sich vor ihr auf. Er trug sie zurück in die Burg zu Kristoffer und Mutter. Schon am nächsten Tag reiste er wieder fort. Sie konnte sich nicht erinnern, wieviel Zeit seitdem vergangen war. Ihre Sehnsucht war als bitterer Schmerz zurückgeblieben und verblich langsam. Nun war nur noch ein kleiner Rest übrig.
Als sie plötzlich Getrappel hörte, setzte sie sich im Bett auf. Laute Hufschläge und das Wiehern vieler Pferde im Burghof hatten sie geweckt. Das mußte Vater sein. Denn sie riefen da unten alle durcheinander, und die Fanfaren wurden geblasen. Doch die Signale sagten ihr nichts. Vielleicht war es auch nur Kristoffer. Im Moment wäre auch Kristoffer genug.
Die große Frau öffnete die Tür, knickste kurz und fing an, mit einer vollkommen anderen Stimme zu reden. Sie plapperte in einem fort, als gälte es ihr Leben.
Vater trat ins Zimmer. Er hörte ihr nicht zu, ging zum Bett und nahm Margarete mitsamt der schweren Decke in seine Arme und trug sie hinaus.
»Sie ist ja nur Haut und Knochen«, sagte er, »was habt ihr mit ihr gemacht?«
Die große Frau lief hinter ihm die enge Treppe hinunter und erklärte, daß sie das einzig Richtige getan und sie gewaschen und ins Bett gesteckt hätten. Aber sie hätte keine Beulen und Flecken, es sei also nicht die Pest.
Erst als Vater am Fuße der Treppe angelangt war, drehte er sich um und brachte die Frau dadurch zum Stehen – und zum Schweigen. Er trug Margarete über den Burghof in das Holzhaus direkt an der Mauer. Er schloß die Tür und setzte sie auf dem Tisch ab.
»So, laß uns jetzt mal sehen, was mit dir los ist«, sagte er und nahm die Decke von ihren Schultern. Er nahm eine ihrer Hände, drehte sie hin und her und suchte sie nach Flecken oder anderen Zeichen einer Krankheit ab.
»Nun ja, klein bist du wirklich, aber das kann sich noch alles geben«, sagte er.
Erst da wurde ihr klar, daß er sie noch gar nicht begrüßt hatte, ihr noch nicht einmal einen Kuß gegeben hatte. Er hatte sie behandelt wie ein Pferd, das er kaufen wollte.
Die Tür ging auf. Die große Frau blieb in der Tür stehen.
»Danke du deinem Gott, daß sie nicht krank ist«, sagte Vater mit dem Rücken zur Tür, er wußte offenbar, wer da stand. »Und hol ihre Sachen. Ich möchte auch Ingeborgs weißes Kleid sehen, wir werden es benötigen.«
»Aber sie ist doch so viel kleiner«, wandte die Frau leise ein und schloß hinter sich die Tür.
Margarete wußte das. Es war ihr größter Fehler: Sie war klein und dunkelhaarig. Vater liebte Ingeborg, die ihm so ähnlich sah. Ingeborg war hochgewachsen, üppig und stattlich.
Als Ingeborg sechs Jahre alt war, konnte sie schon mit den Pferden umgehen, sie benutzte ihre Sporen, ihre Peitsche und vor allem ihren starken Willen. Margarete traute sich nicht, allein zu reiten. Wenn sie reiste, saß sie entweder zusammen mit einer der Frauen im Sattel oder in einem Wagen, der langsam durch die Landschaft schaukelte.
Vater nahm ihre andere Hand und öffnete sie mit seinen langen rauhen Fingern.
»Wie konntest du nur so klein und fein werden?« fragte er. »Man hat Angst, daß dich der nächste Windstoß umwerfen kann. Aber da irren wir uns bestimmt.«
Dann küßte er ihre Stirn und griff in ihre Haare, die ungewaschen und schwer waren.
»Wie ein Rabenkind«, sagte er mit einem Lächeln.
Dann erhob er sich wieder, und seine Gedanken richteten sich auf etwas anderes. Sie blieb in ihrem Hemdchen auf dem Tisch stehen und fror, traute sich aber nicht, die Decke aufzuheben, um sich darin einzuwickeln.
Den ersten Tag der Reise schlief sie fast die ganze Zeit, obwohl sie im Arm der großen Frau lag, deren Namen sie immer noch nicht kannte. Die Frau sprach die ganze Zeit über, aber nie mit ihr. Das wunderte sie nicht besonders, so behandelten sie fast alle. Also konnte sie auch genausogut schlafen.
Sie ließ sich tragen und bewegen wie ein kleines Paket, und es war ihr gleich, wo die Reise hinging. Wenn sie angekommen waren, würden ihre Kleider und Spielsachen ausgepackt werden, wie immer. Eigentlich war es gut, endlich von Vordingborg weg zu sein, wo sie die ganze Zeit nur allein gewesen war.
Sie schreckte auf, als ihr Vater angeritten kam. Ohne jede Ankündigung nahm er sie aus den Armen der namenlosen Frau. Er hielt sie viel zu fest und drückte ihr die Brust zu. Sie wollte sich beklagen, wußte aber genau, daß es nichts nützen würde. Wenn er unterwegs war, trug er immer diese schuppige Rüstung, die aus vielen kleinen Eisenteilen bestand. Sogar sein Arm und seine Handschuhe waren aus Eisen, das sich kalt durch ihre Kleider drückte. Die Kälte ging ihr durch Mark und Bein.
Während er vom Pferd abstieg, hielt er sie weiter fest im Arm. Steifbeinig erklomm er die Treppen eines Turmes und stellte sie oben auf einem Tisch ab, so wie er es auf Vordingborg getan hatte. Fremde Menschen nahmen ihm seinen Mantel ab und fingen an, das ganze Eisen von seinem Körper zu lösen, so daß er langsam wieder begann, ihrem Vater zu ähneln. Aber sie kannte ihn ja. Er sah ihr in die Augen, die Tür stand offen, und das Licht fiel herein, funkelnde Sonnenstrahlen.
»Du bist doch nicht mehr krank?« fragte er, und sie wußte, daß es auf diese Frage nur eine Antwort gab. Endlich hatte er sich von seiner Rüstung befreit und kam zu ihr. Er war so groß, daß sie ihn nur umarmen konnte, wenn sie auf einem Tisch stand.
Er löste ihre Umarmung und nahm ihr Kinn in seine Hand.
»So klein, wie du bist. Auf dich müssen wir gut aufpassen. Eberstein hat einen Boten geschickt, der Ingeborgs schönstes Kleid bringen soll. Sie sind gerade dabei, es für dich umzunähen. Übermorgen sind wir in Kopenhagen. Du sollst heiraten, mein Mädchen. Ich kenne keine, die so jung geheiratet hat. Wir wollen hoffen, daß sich die Schweden zufriedengeben mit einer, die so klein ist.«
Sie sah ihm die ganze Zeit in die Augen, um zu verstehen, was er sagte. Aber dann schwieg er, lächelte und streichelte ihr mit der Hand über das Gesicht. Seine Hand war so groß, daß sie ihr ganzes Gesicht bedeckte. Eberstein, dachte sie, wer ist das? Ein großer, rauher und kalter Stein. Wie die Hand ihres Vaters.
Auf einmal war Vater wieder fort, und sie stand auf dem Tisch und wußte nicht, ob sie dort stehenbleiben oder hinunterklettern sollte.
Vater war größer als alle anderen, und sie hatte noch keine Tür gesehen, die groß genug war für ihn. Er mußte sich immer vornüberbeugen, und dann sah man seinen Kopf mit dem hellen lockigen Haar. Seine Haare und Augen waren wie die von Ingeborg, Margarete hingegen ähnelte ihrer Mutter. Das war ihr größter Fehler. Wenn sie Ingeborg und ihrem Vater ähnlicher sehen und schneller wachsen würde, würde alles anders sein. Mit Ingeborg redete er wie mit einer Erwachsenen.
Zeit verstrich, und keiner kam. Sie sprang vom Tisch und ging zu der geöffneten Tür. Draußen schien immer noch die Sonne, aber es war kalt, und darum ging sie nicht weiter, sondern blieb in einer windgeschützten Ecke stehen und sah hinunter auf die Wiese.
Dort unten war Kristoffer! Auf Vordingborg hatte sie ihn so sehr vermißt, und hier war er plötzlich. Sie wollte sofort zu ihm hinunterlaufen. Aber er stand mit Vater zusammen, hielt seinen Helm in der Hand. Nicht den großen Turnierhelm, sondern den, den er beim Training aufhatte. Dazu trug er den zerschlissenen braunen Brustpanzer aus Leder, der viel zu groß für ihn war.
Sie setzte sich auf die oberste Stufe der Treppe, wo die geöffnete Tür ihr Windschutz bot, und sah hinunter auf ihren Vater und Bruder. Kristoffer war wie sie, zu klein und schwach, um wirklich von Nutzen zu sein. Jede Krankheit erwischte ihn, und er wuchs einfach nicht. Doch jetzt, in seinem Panzer und mit dem Schwert, sah er Vater sogar ähnlich.
Sie hatte einmal einen Mönch beobachtet, der das Bild eines Königs auf eine Kirchenwand malte. Er war stolz auf sein Bild, bis Vater an seine Seite trat und ihn fragte, ob er noch nie zuvor einen richtigen König gesehen habe. Das Bild zeigte einen kleinen dünnen Mann mit einer Krone. Ihr Vater trug nie eine Krone. Sie zweifelte sogar daran, daß er eine besaß. Die Würde eines Königs sei auch ohne Krone spürbar, hatte er dem Mönch erklärt, und so müsse ein König auch gemalt werden.
Warum sollte eigentlich Kristoffer nicht zuerst heiraten? Er war viel älter als sie, wenn auch nicht viel größer. Sie kannte niemanden, der mit sechs schon verheiratet war. Vielleicht würde sie von zu Hause wegziehen müssen. Vater und Mutter waren verheiratet, aber sehr selten zusammen. Und das war auch gut so.
»Da hockst du hier und frierst!« kam eine laute Stimme von unten. Die große Frau raffte ihre Röcke und beeilte sich, die Stufen hinaufzulaufen. Sie wollte nicht schon wieder getragen werden und machte einen Schritt rückwärts in den Turm hinein.
»Ich bin nicht krank, und ich kann selbst gehen«, sagte sie zornig, »und wer bist du?«
Die große Frau starrte sie an mit ihren kugelrunden Augen.
»Du bist also wieder ganz gesund, wie ich höre«, sagte sie und verbeugte sich. »Ich bin Margarethe von Eberstein, und dein Vater hat mir die Verantwortung für deine Person übergetragen.«
Meine Person, dachte Margarete. Das hätte Vater niemals so gesagt. Sie schritt an dieser Eberstein vorbei die Treppe hinunter. Im Eingang des Turms blieb sie demonstrativ stehen und schaute zu ihrem Vater und Kristoffer. Ihr Bruder hatte einen kleinen runden Schild, mit dem er die Schläge parierte. Sie konnte genau sehen, daß Vater nicht mit ganzer Kraft zuschlug, sondern Kristoffer die Möglichkeit bot, sich zu verteidigen. Es war ein zäher Kampf, und Kristoffer schwitzte, schimpfte laut, sank nieder und stützte sich auf das Knie. Mit einer Hand strich er sich den Schweiß aus der Stirn, während er das Schwert mit der anderen zitternd festhielt.
Eberstein war ebenfalls die Treppe hinuntergekommen und stellte sich schwer schnaufend hinter Margarete. So war sie wenigstens schön windgeschützt, wenn sie sich gegen deren dicke Beine lehnte.
Vielleicht sollte ein Turnier zu ihrer Hochzeit stattfinden. Vielleicht hatte Vater deshalb begonnen, mit Kristoffer zu üben. Das letzte Mal hatte er aus lauter Wut das Schwert von sich geworfen, so daß es sich in die weiche Erde bohrte und vibrierte. Das war auf Vordingborg gewesen.
»Warum heiratet Kristoffer nicht zuerst?« fragte sie Eberstein, die von dieser Frage überrascht wurde.
»Der König entscheidet für seine Kinder«, antwortete Eberstein. Es war deutlich, daß dies nicht die richtige Antwort war, aber daß sie irgend etwas sagen mußte, um Margarete die Antwort nicht gänzlich schuldig zu bleiben. So war es mit fast allen Erwachsenen. Sie glaubten immer, daß sie die Wahrheit nicht verstehen würde.
Sie wurde in den Saal mit den spitzen Fenstern gebracht. Der Raum kam ihr bekannt vor, aber wo genau sie war, wußte sie nicht.
Als erstes fiel ihr der gedeckte Tisch auf. Es sah so aus, als würde sie heute auch mit ihren Eltern und nicht nur mit Eberstein essen. Im Halbdunkel sah sie eine Frau. Es war ihre Mutter.
Fast ein Jahr war es her, daß sie sich gesehen hatten. Voller Schmerz und Verwirrung erinnerte sie sich an ihre Abreise damals: ein dunkler Abend, Fackeln und Geschrei, große Pferde, die ihr angst machten, und ihr Vater, der sie hochhob und einem Reiter aufs Pferd setzte.
Das war die Nacht, in der ihre Geschwister starben.
»Geh schon rein«, sagte Eberstein und gab ihr einen kleinen Schubs. »Deine Mutter ist wieder gesund«, fügte sie hinzu, »geh hinein und begrüße Königin Helvig.«
Trotzdem traute sie sich nicht sofort, zu ihrer Mutter zu gehen.
»Geh und begrüße deine Mutter, und denk daran, dich tief zu verbeugen«, flüsterte Eberstein.
Etwas zögerlich ging sie endlich über den Fußboden, an den sie sich auch noch erinnern konnte: schöne Steine mit Bildern von Löwen und Lilien. Hier war sie gewesen, bevor sie nach Vordingborg gebracht wurde. Wie konnte sie das nur vergessen haben?
Ihre Mutter saß an der Mitte des Tisches. Sie war allein im Raum. Mutter sah kaum anders aus als früher, immer noch schmächtig und zerbrechlich und vollkommen von Kleidern umhüllt. Nur ihr Gesicht und die Hände waren nackt. Das Gesicht war blaß und schmal, mit ganz dunklen Augen und einem kleinen runden und bemalten Mund.
Schließlich wagte Margarete es doch, die letzten Schritte zu ihrer Mutter zu gehen. Sie umrundete den Tisch, näherte sich vorsichtig und verbeugte sich, so wie Eberstein es immer machte, in gutem Abstand.
»So schön bist du geworden«, sagte ihre Mutter. »Bist du meine tote oder meine lebende Margarete?«
Margarete war nach ihrer verstorbenen großen Schwester und ihrer ebenfalls verstorbenen Tante benannt worden, aber ihre Mutter mußte doch sehen können, daß sie lebte. Margarete hatte auch ganz vergessen, daß ihre Mutter so eine merkwürdige Stimme hatte. Alle Erwachsenen konnten sich hinter Worten verstecken, die man nicht verstand. Vater hatte ihr beim letzten Mal, als sie sich hier sahen, versprochen, ihr Deutsch beizubringen. Doch dann passierte all das andere, und dann kam Vordingborg. Mutter und Vater sprachen nur dänisch, wenn sie zusammen waren.
»Wie groß du geworden bist«, sagte ihre Mutter. Das weiße Kopflinnen war straff über ihre Wangen und ihre Brust gezogen, und auf ihrem Scheitel prangte ein großer schwarzer Ring, der das schwarze Übertuch zusammenhielt. Dies fiel über ihre Schultern, so daß sie aussah wie eine Nonne. Wenn man nahe genug bei ihr stand, konnte man sehen, daß der Ring wie eine Krone geformt war. Sie hätte so gerne diese merkwürdige Krone berührt.
»Setz dich zu mir«, sagte ihre Mutter, deren Hände immer noch unbewegt auf dem Tisch lagen, links und rechts von dem Teller. Sie sah aus wie eine Holzstatue.
Margarete mußte ihre Mutter berühren, streckte ihre Hand aus und legte sie vorsichtig neben die kleine erwachsene Hand mit all den Ringen an den Fingern.
»Nein! Laß mich!« zischte Helvig, zog aber nicht die Hand, sondern den Blick fort.
Margarete gehorchte sofort und setzte sich.
Kristoffer hatte versucht, es ihr zu erklären. »Unsere Mutter ist krank«, hatte er gesagt, »darum hat Vater sie fortgeschickt.« Das war in der Nacht, in der die Zwillinge starben. Aber das waren für sie nur Worte. Sie verstand es nicht.
»Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen«, sagte ihre Mutter. Margarete sah sie an und versuchte ihren Blick einzufangen, aber es war, als ob die schmalen dunklen Augen keinen Blick mehr hatten.
Genau hier war es geschehen. Sie wollte sich um keinen Preis daran erinnern, aber es war genau hier geschehen.
Die Tür ging auf, und ihr Vater und Kristoffer kamen herein, begrüßten Helvig und setzten sich. Dann wurde das Essen aufgetragen, ein Gang nach dem anderen. Sie hatte noch nie zuvor nur mit ihren Eltern und Kristoffer gegessen. Es war sehr still. Kristoffer schnitt ihr Essen in kleine Stücke und probierte jeden Gang zur Sicherheit vorher, denn sie war sehr wählerisch. Sie weigerte sich, Rote Bete zu essen. Darum würgte er sie an ihrer Stelle hinunter.
»Vielleicht wächst man von Roter Bete«, flüsterte er ihr zu. Das wäre sehr gut, dachte sie, dann wäre Vater bestimmt zufrieden mit ihm. Dann könnte er ja auch heiraten.
Es war nicht gern gesehen, daß die Kinder beim gemeinsamen Essen laut am Tisch miteinander sprachen. Aber sie hatten sich so lange nicht gesehen, daß niemand sie wegen dieses Verstoßes zurechtwies. Kristoffer gratulierte ihr zu ihrer bevorstehenden Hochzeit.
»Hat Vater daran gedacht, dir zu erzählen, wen du heiraten wirst?« fragte er, während er seine Pastete aß. Sie schüttelte den Kopf. Darüber hatte sie noch gar nicht nachgedacht, es war doch ohnehin schon alles abgemacht.
»Kannst du dich an Håkon erinnern?« fragte er leise. »Meinen Freund Håkon? Er ist viel größer als ich und auch älter. Blankas Håkon«, fügte er hinzu.
Wie sollte sie sich an ihn erinnern? Menschen kamen und gingen. Sie erkannte sie, wenn sie sie wiedertraf, aber Namen allein sagten ihr nichts. So war es auch mit Kristoffers Geschichte über die toten Zwillinge und die Krankheit ihrer Mutter. Sie wußte schon, worüber er sprach, aber für sie, in ihr, sah es ganz anders aus.
Sie hatte ihre Mutter gesehen, halbnackt, ihre langen schwarzen Haare hingen ihr wie Schlangen auf Schultern und Arme. Sie hatte ein totes nacktes Baby herumgetragen. Sie hatte es im Arm hin und her geschaukelt. Das Kind hatte keinen einzigen Laut von sich gegeben. Auf dem Boden hatte das andere Kind gelegen, klein und still.
Zuerst hatte sie gedacht, es seien Puppen. Doch nein, es waren ihre neugeborenen Geschwister, sie hatte sie in der Wiege liegen sehen, zwei kleine Jungen. Sie hatten schon Namen erhalten, waren getauft worden und waren also zwei kleine christliche Menschen, die man berühren durfte. Doch auf einmal lagen sie auf dem kalten Boden, oder Mutter trug sie umher. Aus ihrem Mund war ein seltsamer, schriller Laut gedrungen, sie war umhergelaufen und hatte gestampft, aber nur mit dem rechten Fuß, und sie hatte mit sich selbst in einer fremden Sprache gesprochen. Dann hatte sie das Kind fallen lassen, war zum Fenster gegangen und hatte sich niedergekniet.
Margarete hatte nicht mehr sehen können, denn dann waren andere Leute hereingestürzt. Sie hatten die kleinen stummen Babys zugedeckt und sie mit aus dem Zimmer genommen. Ihr waren die Augen zugehalten worden, sie hatte geschrien und in die Hand gebissen, die ihr die Sicht versperrte. Erst in den Armen ihres Vaters konnte sie sich wieder beruhigen, fest hatte sie seinen Hals umschlungen. Sie war sich so sicher gewesen, daß er sie beschützen und alles Böse und Unbegreifliche von ihr fernhalten würde.
Aber nein. Er hatte ihren Griff gelöst und sie in die Arme anderer weitergereicht. Und dann war sie auf einmal von viel Lärm, Pferden, Dunkelheit und Fackeln umgeben gewesen, und sie hatte geweint. Kristoffer hatte versucht, es ihr zu erklären. Weil die zwei Kleinen gestorben waren, war ihr Leben in Gefahr. Vater hatte sie fortgeschickt, um ihr Leben zu retten.
Nun saßen sie wieder hier, in dem gleichen Saal. Aber nichts war wie vorher, sie durfte ihre Mutter nicht berühren und hatte Angst, ihr in die Augen zu sehen. Ihre Mutter konnte zwar essen und trinken, aber ihr Vater wachte über jede ihrer Bewegungen. Er füllte ihren Becher und half ihr, das Fleisch in kleine Stücke zu schneiden. Und jedesmal, wenn sie ihre rechte Hand zum Mund führte, folgte sein Blick ihrer Bewegung.
»Wir werden morgen weiterfahren«, sagte ihr Vater, während ihre Mutter sorgsam ihr Gesicht abwischte und immer und immer wieder ihre Hände in einer Schale wusch. Das war sein erster richtiger Satz gewesen, abgesehen von den Begrüßungen und Anweisungen an die Dienerschaft. Margarete beobachtete, wie ihre Mutter bei diesen Worten erstarrte und beide Hände auf den Tisch legte, obwohl sie noch naß waren.
»Warum hast du keine Frau für Kristoffer?« fragte sie. Ihre Stimme klang fremd, so als hätte sie selbst vergessen, wie sie klang, und als würde sie nach ihr suchen. Kristoffer saß vollkommen still da. Er hoffte wohl, übersehen und vergessen zu werden, wenn er keinen Laut von sich gab.
»Sieh ihn dir doch an«, sagte Vater. »Er muß sich erst wesentlich verbessern, bevor ich ihn zu Kaiser Karl schleppen und vorstellen kann.«
»Aber Margarete kannst du verschenken, gerade einmal sechs Jahre alt«, erwiderte ihre Mutter. Margarete hatte genau hingesehen und eine Art Lächeln im Gesicht ihrer Mutter entdeckt. Während ihr Vater seine Frau die ganze Zeit über ansah, starrte die unentwegt in die Luft.
»Und dann zu diesen Menschen!« fügte sie hinzu und lachte bitter auf. »Es gibt keine Sünde, die sie nicht begangen haben. Letztes Jahr noch wolltest du Magnus beim Papst anklagen und ihn verbannen lassen, und jetzt sollen wir ihn und seine verzogenen Söhne empfangen und ihnen unsere Kinder schenken. Ob Magnus seine Liebhaber mitbringt, was meinst du? Was ist mit dem Sohn, gegen den er Krieg führt? Wie kannst du auch nur daran denken, uns mit dieser sündigen schwedischen Brut und diesen häßlichen Menschen zu verbinden?«
»Magnus begreift nur direkte Handlungen, die gegen ihn gerichtet sind«, sagte Vater in einem Tonfall, als spräche er mit einem Kind. »Und noch ist gar nichts entschieden. Wir behalten sie bei uns und können alles auch jederzeit rückgängig machen, wenn sie unseren Erwartungen nicht entsprechen.«
»Du hast also gar nicht vor, den Vertrag einzuhalten?« fragte ihre Mutter. Sie wandte sich abrupt zu ihrem Mann und sah ihm in die Augen. »Du hast gar nicht vor, sie ihnen auszuhändigen? Habe ich es mir doch gedacht! Alle, die man zum Narren halten kann, sollen ruhig zum Narren gehalten werden. Alle, die man ausnutzen kann, sollen ruhig ausgenutzt werden. Glaubst du nicht, ich kenne dich? Alle Menschen sind nur für dich und deine Pläne da. Und wenn es nicht so geschieht, wie du es willst, dann schlägst du zu. Meiner willst du dich hoffentlich nicht so entledigen wie der drei bei Middelfart, die du hast töten lassen.«
»Ich habe niemanden getötet!« schrie Margaretes Vater und blieb aufgelöst und mit offenem Mund sitzen. Seinen Arm, in dessen Hand er das Messer hielt, hatte er vor sich auf dem Tisch ausgestreckt, und die Klinge zeigte drohend nach oben. Diese Hand schien dem, was er soeben beteuert hatte, widersprechen zu wollen.
Ihr Vater hörte nicht auf, sich zu erklären und sich zu verteidigen. Margaretes Mutter erhob sich geräuschvoll von ihrem Stuhl. Ihr Blick bat um Hilfe, und Kristoffer erhob sich auch sofort. Doch zu spät. Die Füße versagten ihr den Dienst, sie strauchelte und konnte sich gerade noch fangen. Ihr Mann rührte sich nicht von der Stelle. Sie winkte Kristoffer zu sich und ließ sich von ihm stützen. Stehend war sie eine weit weniger imposante Erscheinung, als es diese steife Statue am Tisch gewesen war.
Erst jetzt erhob sich der König und gab dem Diener, der an der Tür gestanden und gewartet hatte, ein Zeichen. Ihre Mutter verließ den Saal, und auf einmal wimmelte es von Menschen, die den Tisch abräumten. Ihr Vater ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Margarete sah hinüber zu Kristoffer. Blaß und still saß er da und aß sein Brot, aber nur die weichen Krümel. Die harte Kruste blieb auf dem Tisch liegen, denn er hatte so empfindliche Zähne, und sein Zahnfleisch blutete schnell.
Kurz darauf kam Eberstein zurück und holte sie. Aber dieses Mal nahm sie Margarete an der Hand, und das war viel besser, als getragen zu werden. Sie würden jetzt das schöne Kleid für den morgigen Tag anprobieren gehen, sagte sie.
»Morgen werden wir in Kopenhagen ankommen«, fügte Eberstein hinzu, während sie ausgezogen und vermessen wurde. Sie bekam ein dünnes Hemdchen aus furchtbar hartem Stoff übergestreift, das so oft zusammengesteckt wurde, bis es ganz eng an ihrem Körper saß.
Sie wollten sichergehen, daß das feine, edle Kleid, das sie darüber tragen würde, nicht beschädigt wurde. Vier junge Frauen saßen daran und nähten es für sie um. Es war Ingeborgs prächtiges Verlobungskleid, das sie nun erben würde. Ingeborg hatte es nur ein einziges Mal getragen, aber danach angekündigt, daß sie es auch zu ihrer Hochzeit tragen wolle.
Als Ingeborg damals das Kleid bekommen hatte, war Margarete ganz krank und unglücklich vor Neid gewesen. Ihr Vater hatte keine Königskrone, und seine Kinder mußten jeden Tag mit grauen Wollkleidern herumlaufen und trugen ihre Schuhe so lange, bis sie in Stücke fielen. Sie aßen Grütze und andere einfache Gerichte und tranken ihr Bier mit Wasser verdünnt. Nur zu besonderen Anlässen gab es Pasteten und Wein. Mehr konnten sie sich nicht leisten.
Sie hatte sich immer darüber gewundert, daß sie, Ingeborg und Kristoffer so viel ärmlicher lebten als die Kinder der Gutsherren. Wenn sie die Klöster oder die Höfe der Adligen besuchten, sah sie immer Kinder, die so feine Kleider trugen wie ihre Mutter. Jeden Tag aßen sie festlich und glaubten gewiß, daß es so auch im Hause des Königs zugehen würde.
»Da kannst du einmal sehen, wie arm der König ist«, hatte ihr Vater immer gesagt, wenn sie nach einem solchen Besuch den Hof wieder verließen. Und sie hatte nie gewußt, ob er das gut oder schlecht fand. Aber sie wünschte sich so sehr schöne Kleider und schönen Schmuck. Sogar ihre Spielsachen waren alt.
Ingeborgs Kleid hatte den ganzen Weg aus Italien hinter sich. Von dort kamen die Ballen mit dem weißen Stoff, in den Silberfäden und Perlen eingewirkt waren und der dann von Königin Helvigs Zofen und Kammerfrauen in dieses wunderschöne Kleid verwandelt wurde. Ingeborg hatten sie von Kopf bis Fuß vermessen, dann den Stoff ganz vorsichtig zugeschnitten und ihren Körper wie den einer Puppe darin eingenäht. Sie hatte zum Schluß wie ein Engel ausgesehen, mit ihren langen blonden Haaren, die ihr über die Schultern fielen. Aus der Domkirche zu Lund hatte Vater den goldenen Blumenkranz Unserer Gnädigen Frau geliehen, der über und über mit Juwelen besetzt war. Den trug Ingeborg auf ihrem goldenen Haar. Margarete hatte nicht mitbekommen, ob sie den Kranz auch dieses Mal wieder aus Lund hatten kommen lassen, aber vielleicht sollte es auch eine Überraschung sein.
Schließlich zogen sie ihr ein ganz neues und sehr dünnes Hemdchen an und umhüllten sie dann mit dem silbrigen Stoff.
Er roch trocken und duftete ein wenig nach Frühling. Doch er legte sich um ihren Körper wie ein Korsett aus Seide. Die Ärmel waren so eng, daß sie die Arme nicht beugen konnte. Das Kleid und das Leibchen darunter zwangen sie in eine Körperhaltung, die sie während der gesamten Feierlichkeiten einhalten sollte: leicht angewinkelte, vor dem Körper hängende Arme, so daß sie lange stehen und etwas Schweres halten konnte. – Sie steckte in einem vornehmen Käfig, so als wäre das Kleid eine sehr strenge Erzieherin, noch strenger als Eberstein und weitaus fordernder als ihr Vater. Früher hatte sie öfter zusammen mit ihren Eltern wichtigen Versammlungen auf dem Thingplatz beiwohnen müssen. Da war sie dann nach einer Stunde einfach umgefallen. Das letzte Mal war sie mit Vater allein dort gewesen, und er hatte sie auf Mutters leeren Stuhl gesetzt, auf dem sie sofort in einen tiefen Schlaf gefallen war.
»Wir können das Kleid soviel enger und kürzer machen, wie wir wollen, aber wir werden es nie wieder auftrennen können«, sagte Eberstein und drehte sie zwischen ihren Händen hin und her. Das brachte sie zum Lachen, und sie gab sich selbst noch ein bißchen Schwung und drehte sich immer schneller. Sie versuchte, sich die Augen zuzuhalten, konnte ihre steifen Arme aber nicht hochheben. Die Frauen griffen erschrocken nach ihr und brachten sie zum Stehen.
»Herrgott, Mädchen, sei doch vorsichtig! Sieh mal, schon ist eine der Perlen abgefallen!« riefen sie alle gleichzeitig und hielten sie fest. Ihr wurde das Kleid vom Körper gezerrt. Das fühlte sich an, als ob sie gehäutet werden würde, sie jammerte und wehrte sich nach Kräften.
»Sie ist so klein«, sagte eine der Frauen.
»Und das schwarze Haar sieht so ganz anders aus auf dem weißen Kleid«, sagte eine andere.
»Wie ein Rabenkind«, sagte die dritte.
Das sagte ihr Vater immer zu ihr, wenn er ihr über das Haar strich. Ihres hatte dieselbe Farbe wie das Haar ihrer Mutter. Doch das hatte sie seit dem Tod der Zwillinge nicht mehr gesehen. Und daran wollte sie sich auch nicht erinnern, nie mehr.
Das alte, vertraute Wollkleid wurde ihr wieder angelegt, ihr Haar wurde gekämmt und geflochten. Nun sah sie überhaupt nicht mehr aus wie eine Königstochter. Sie sah aus wie ein Kind von einem Jedermann.
Sie erkannte den Geruch einer Stadt schon von weitem. Burgen hatten keinen Geruch, nur der Wallgraben. Und Klöster dufteten. Aber Städte sandten einen scheußlichen Gestank aus, eine Mischung aus allerlei übelriechenden Essenzen. Sie war sich sicher, daß die Burgen deshalb etwas außerhalb der Städte und für sich allein standen. An Riberhus konnte sie sich gut erinnern, dort hatte es ihr am besten gefallen. An Kopenhagen konnte sie sich zwar nicht mehr erinnern, als sie aber in die Stadt ritten, fiel ihr doch eine Sache wieder ein: Der Gestank dieser Stadt hatte noch zusätzlich einen besonderen Geruch, sie roch nach Fisch. Nach Hering und Salz. Dieser Geruch war bis in die Burg vorgedrungen und hatte sich überall festgesetzt, sogar in den Bettlaken.
Nun regnete es auch noch in Strömen, und das Wasser tropfte nur so von Reitern und Pferden herab. Sie fing an, sich nach Vordingborg zurückzusehnen, vor allem als Eberstein sie auszog und wieder nach Spuren einer gefährlichen Krankheit untersuchte. Es war feucht und kalt in dem Raum.
Am nächsten Morgen erkannte sie, daß es weder ein rauschendes Fest noch ein Turnier geben würde. So etwas fand wohl nur bei richtigen Hochzeiten statt, sie sollte ja nur verlobt werden, wie man ihr inzwischen erklärt hatte. Ihre Eltern ließen sich nirgends blicken, überhaupt schien keiner so richtig Verwendung für sie zu haben, also schlenderte sie ziellos umher. Die Burg war so viel kleiner als Vordingborg, gleichzeitig waren aber viel mehr Menschen hier, die alle geschäftig umhereilten.
Es müßten doch eigentlich Gäste gekommen sein, dachte sie, jemand müßte doch mit ihrem Vater besprochen haben, daß sie verlobt werden sollte. Warum hätten sie denn sonst Ingeborgs Kleid umnähen sollen? Jemand müßte doch gekommen sein, um sie zu sehen. Aber für sie interessierte sich im Moment offensichtlich kein Mensch.
Kristoffer war nirgendwo zu finden, also ging sie in die Kapelle, in der es wie immer ganz still war. Es gab keine Stühle und Bänke dort, aber sie konnte sich in eine Fensternische setzen. Von dort würde sie auch sofort sehen können, wenn Vater kam. Er war auf der Burg, das hatte sie an dem Löwenbanner erkannt, das auf dem höchsten Turm im Wind wehte.
Aber kaum hatte sie sich eine Nische ausgesucht, als auch schon ein großer, weiß gekleideter Mann mit Tonsur auf sie zugestürzt kam.
»Kannst du da wohl rauskommen!« schrie er. »Jetzt ist hier schon wieder eines von diesen Wendenkindern. Die muß hier weg, sonst haben wir wieder überall Läuse!«
Ein zweiter Mönch kam angerannt. Er hatte seine Kutte mit beiden Händen hochgehoben, und Margarete konnte einen Blick auf seine behaarten Beine erhaschen. Auch er brüllte wütend: »Raus mit dir, du Bettelkind!«
Sie rührte sich nicht von der Stelle. Das war ihr Haus, ebenso wie es das Haus ihres Vaters war. Er hatte ihr einmal erklärt, daß die Kirche ein Ort für alle sei. Alle wären dort willkommen, vom König bis zum Bettler. Die Burg war das Haus des Königs, aber die Kirche war das Haus Gottes und offen für alle. Das verstanden sie bestimmt nicht, diese dummen Mönche. Der eine ergriff ihren geflochtenen Zopf und zerrte sie daran hinter sich her. Sie wehrte sich, machte sich schwer und ließ sich über den Boden schleifen. Der Schmerz auf der Kopfhaut betäubte alles andere, sie schloß die Augen und versuchte nicht zu schreien. Sie trat wild um sich und griff mit ihren kleinen Händen nach der Kutte des Mönchs.
»Was ist denn hier los?« fragte eine Frauenstimme. Die Tür stand sperrangelweit offen, und der kalte regnerische Wind schlug Margarete entgegen. Endlich wagte sie es, ihrem Schmerz nachzugeben und zu schreien. Die Tränen flossen ihr die Wangen hinunter. Der Mönch ließ sie los, und sie fiel auf die Knie. Was für eine Erleichterung! Mit gepeinigtem Blick sah sie zu Eberstein hoch, die den ganzen Türrahmen ausfüllte. Verglichen mit ihr waren die Mönche kleine Buben, die jetzt vor Scham erröteten.
»Wir dachten, sie sei von unten aus der Stadt«, stammelten sie. Margarete stand auf und legte beide Hände auf ihren Kopf. Es fühlte sich an, als wären Kopf und Gesicht zum Zerreißen gespannt. Eberstein zog sie zu sich und legte ihre großen weißen Hände auf ihre Schultern.
»Dies ist das Königskind, König Håkons Verlobte«, sagte sie. »Seht genau hin, und prägt euch ihre Gesichtszüge ein. Wenn ihr einst Äbte sein werdet, ist sie die Königin von Norwegen. Seid froh und dankbar, daß ich nicht vorhabe, dem König von eurem Fehltritt zu berichten.«
Das schöne weiße Kleid wurde ihr angezogen, und danach wurde sie vom Ankleidetisch auf den Boden gesetzt. Dort stand sie ganz still, während ihr Haar gekämmt und mit einem Blumenkranz geschmückt wurde. Es war kein gewöhnlicher Blumenkranz, stellte sie fest. Er war mit Stahldraht geflochten, so daß er sich nicht auflösen und herabfallen konnte. Aber es war auch nicht der Kranz aus der Domkirche, den Ingeborg damals getragen hatte. Vielleicht würde sie den zur Hochzeit tragen dürfen.
Auch die Festlichkeiten enttäuschten sie sehr. Eberstein begleitete sie in den großen Festsaal, und alle erhoben sich, als sie hereinkam. Aber es gab weder Musik noch einen Bräutigam. Da sie ihre Arme nicht beugen konnte, blieb ihr nichts anderes übrig, als still neben ihrem Vater zu sitzen, der ihr das Essen in kleine Stücke schnitt und sie wie ein Baby fütterte.
Das hier entsprach so überhaupt nicht ihren gespannten Erwartungen.
Das einzig Spannende war, wie sich Eberstein vor ihrem Vater verneigte. Sie verneigte sich so tief, daß man ihre großen weißen Brüste sehen konnte, die von dem zur Seite fallenden Halstuch entblößt wurden. Ihre Brüste sahen aus wie riesige weiße Tauben. Als sie sich wieder aufrichtete, schaute sie ihm in die Augen. Margarete folgte ihrem Blick und beobachtete das Gesicht ihres Vaters. Seine Wangen waren gerötet, und sein Mund stand offen. Aber er sagte nichts. Statt dessen griff er unbeholfen nach seinem Becher und stieß ihn dabei um. Er war leer und wurde sofort von einem Diener mit Wein gefüllt. Schnell nahm er einige Schlucke und wandte seinen Blick von Eberstein ab. Margarete vergaß das Geschehene sofort wieder.
Sie bekam ein Glas Wein mit Wasser verdünnt und mit Honig gesüßt. Plötzlich trat ein Mann an ihre Seite und las laut einen langen Brief vor. Danach tat ihr Vater das gleiche, und zum Schluß wurde ihr ein Ring überreicht. Da dieser aber viel zu groß für sie war, verwahrte ihn Vater in einem kleinen Kästchen. Schließlich zeichnete er den Brief mit seinem Siegel, und der Fremde tat es ihm nach.
Mutter saß still an der Tafel und aß nur wenig. Vater wachte die ganze Zeit über ihre Bewegungen. Sie achteten nicht auf Margarete, die Kristoffer am anderen Ende des Tisches zuwinkte. Er lächelte und winkte zurück, obwohl er immer ängstlich darauf bedacht war, nicht zu jung und kindlich zu wirken, wenn fremde Menschen dabei waren.
Die Stimme ihres Vaters weckte sie auf. Er war wütend. Sie erinnerte sich langsam, wo sie waren und daß sie nun verlobt war. Und trotzdem hatte sich nichts geändert.
»Ich lasse dich nicht gehen«, sagte er. Er mußte ganz in der Nähe sein, und sie machte sich ganz klein und versteckte sich unter den Decken. Sie standen mitten im Zimmer, Vater und Mutter. Ihre Mutter trug ein langes weißes Nachtkleid, ihr Vater war nackt.
»Ich lasse dich nicht wieder davongehen«, sagte er, während er versuchte, sie in den Arm zu nehmen. Aber sie wand sich aus seiner Umklammerung, schlug stumm und verbissen nach ihm. Er drehte ihr beide Arme auf den Rücken, und sie sank mit einem merkwürdigen, halberstickten Laut auf die Knie. Er kniete sich neben sie, und seine langen weißen Arme umschlangen sie.
»Ich lasse dich nicht gehen«, wiederholte er. »Es gibt nichts, was ich nicht kann. Es gibt keinen, den ich nicht erreichen kann.«
»Ja, Eberstein hast du auch erreicht«, sagte Margaretes Mutter und warf ihren Kopf nach hinten. Ihr langes schwarzes Haar floß über den Steinfußboden, und sie ließ sich nach hinten auf den Rücken sinken. Mit ausgebreiteten Armen lag sie da, ihren Kopf warf sie von einer Seite auf die andere und lachte dabei. Er legte seine Hand auf ihren Mund und sagte ihr, sie solle leise sein. Er streckte sich neben ihr aus, legte eine Hand um ihren Nacken und zog sie zu sich heran. Leise flüsterte er auf sie ein, während heftige Zuckungen und Stöße durch ihren Körper gingen. Zum Schluß zuckten nur noch ihre kleinen nackten Füße.
Dann hob er sie hoch und trug sie zum Bett. Sie mußte schwerer sein, als sie wirkte, denn er ließ sie ins Bett fallen.
»Aber ich will keine toten Kinder mehr haben«, sagte er dann, drehte sich um und ging zur Tür hinaus. Einen Augenblick später war es wieder ganz still.