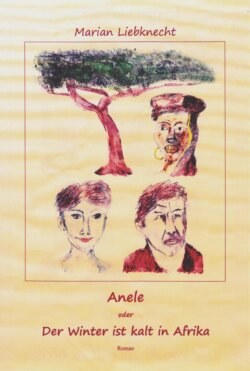Читать книгу Anele - Der Winter ist kalt in Afrika - Marian Liebknecht - Страница 11
8.
ОглавлениеIn den nächsten Wochen freute sich Philipp jedesmal auf die zwei Stunden am Montag und Donnerstag Abend, die er mit der Vorbereitung auf seine künftige Beschäftigung verbrachte. Wie schon am ersten Abend ließ Fritz bei seinem Vortrag keine Langeweile aufkommen und ergänzte auch trockenere Themen immer mit spannenden Geschichten aus seiner Praxis. Da er sich bei seinen Besuchen in den Projektgebieten regelmäßig mit den vor Ort tätigen Mitarbeitern austauschte, blieb er bei allen Unternehmungen auf dem Laufenden.
Am vierten Abend beschloss man wieder, gemeinsam wegzugehen und diesmal schloss Philipp sich an. Sarah ging ebenfalls mit und da auch sonst keiner fehlte, war der gesamte Kurs vertreten. Es war der 20. Januar und – wie an den vorhergehenden Abenden auch – bitter kalt. Man ging deshalb in ein Gasthaus gleich in der Nähe, das Fritz recht gut kannte. Es hieß „Zum alten Römer“ und war einfach, aber gemütlich eingerichtet. Holztische und Holzbänke luden zum Hinsetzen ein und in der Ecke stand ein großer Kachelofen, der die heimelige Wärme der Gaststube noch unterstrich. Von den etwa zehn Tischen im Lokal waren drei besetzt, so dass die kleine Gruppe problemlos Platz fand. Die Speisekarte wirkte äußerst anziehend auf alle, sie war voll mit echter Wiener Hausmannskost und auch die Größe der Portionen konnte sich sehen lassen, wie die Speisen der anderen Gäste bewiesen.
Als alle bestellt hatten, entwickelte sich ein nettes Gespräch, bei dem es sehr lustig zuging, wobei sich vor allem Piet als richtige Stimmungskanone erwies. Helmut war so, wie er bei seiner Vorstellung am ersten Kursabend gewirkt hatte, sehr überlegt und ruhig, aber auch sehr ernst. Er sprach offensichtlich gerne über Probleme jeder Art, tagespolitische, wissenschaftliche oder philosophische, eben alles, was ihn gerade beschäftigte. Diese Eigenschaft kam auch Philipp sehr entgegen, der zwar bei Albernheiten mitmachte, dem aber im Grunde ernsthafte Gespräche lieber waren. Deshalb unterhielt er sich an diesem Abend auch viel mit Helmut, der sehr interessant über sein Studium und die Erlebnisse bei der Ausbildung zum praktischen Arzt erzählen konnte.
Alfred war der einzige, der kaum etwas sagte. Auf Grund seines Verhaltens vermutete Philipp eine Art Minderwertigkeitsgefühl oder Unsicherheit bei ihm, wobei nicht klar war, was dem zu Grunde lag. Es schien aber, dass Fritz ihn kannte und auf keinen Fall abseits stehen lassen wollte, da er ihn immer wieder bewusst ins Gespräch einbezog, was schließlich auch den Erfolg zeitigte, dass Alfred ein wenig auftaute.
Sarah war in dieser Runde der weibliche Hahn im Korb. Sie verhielt sich in solchen Situationen immer äußerst charmant. Philipp und sie ließen nach außen nicht erkennen, welches gemeinsame Schicksal sie verband. Zumindest in dieser Hinsicht bestand Einvernehmen zwischen ihnen.
Unerwartet begann Piet mit Philipp eine Unterhaltung, als dieser mit Helmut gerade wieder einmal ein Thema erschöpfend abgehandelt hatte. Er fragte ihn nach seiner bisherigen Arbeit und was die genauen Gründe für den Entschluss waren, seine jetzige Firma zu verlassen. Philipp versuchte, ihm so gut er es konnte verständlich zu machen, was an seiner derzeitigen Situation so unerträglich war und fragte Piet dann genauer nach dessen Wurzeln, wo in Holland er aufgewachsen war und was er in seiner Jugend gemacht hatte. Es war nicht Höflichkeit, die ihn diese Fragen stellen ließ, sondern einfach Interesse an den Mitstreitern im Kurs, die das gleiche Schicksal gewählt hatten wie er. Außerdem wollte er immer etwas über andere Länder erfahren, die er bisher noch nie gesehen hatte. Das Gespräch machte Philipp großen Spaß, da Piet eine sehr witzige Art hatte, die Dinge zu erzählen. Dieses Talent schien den Holländern in die Wiege gelegt worden zu sein, denn Philipp konnte sich keines Vertreters dieser Nationalität entsinnen, der auf den Mund gefallen war. Zwischendurch beschlich ihn allerdings das seltsame Gefühl, dass es da etwas gab, das Piet dazu trieb, von sich zu erzählen. Er schien den Wunsch zu verspüren, etwas loszuwerden, etwas, über das er nicht sprechen konnte, weshalb er alles andere, worüber er reden konnte, ständig zum Thema machte. Aber als diese Ahnung bei Philipp auftauchte, vertrieb er sie auch schon wieder, da er keinerlei rationale Erklärung dafür fand.
Irgendwann während des Gesprächs erwähnte Philipp, dass er früher einmal Mitglied bei einem Schachklub gewesen sei, worauf ihm Piet sofort erzählte, dass er ebenfalls in seiner Jugend vereinsmäßig Schach gespielt habe, jetzt aber – auch mangels eines geeigneten Partners – so gut wie nie mehr zum Spielen kam. Er fragte Philipp, ob er nicht einmal auf eine Partie Schach und ein Glas Wein zu ihm kommen wolle. Seit der Trennung von Babsi starrte Philipp am Abend regelmäßig der Einsamkeit ins Gesicht, so dass er nicht lange zu überlegen brauchte, bevor er zusagte. Neben der Aussicht auf einen netten Schachabend hatte er auch ein gewisses Interesse, gerade Piet näher kennen zu lernen. Er wusste, dass er in Afrika wahrscheinlich mehr mit ihm zu tun haben würde als mit den anderen, da Piet auf Grund seines bisherigen Berufslebens eine ähnliche Tätigkeit ausüben würde wie er selbst. Außerdem schätzte er den Holländer als interessante Persönlichkeit, an der er noch nicht alle Seiten entdeckt zu haben glaubte. Sie versprachen, einander anzurufen, sobald es sich ausginge, und tauschten die Telefonnummern aus.
Mit Sarah sprach er an diesem Abend außer ein paar Belanglosigkeiten kaum etwas. Wie auch? Philipp sah zwischen ihnen so Vieles, das erst weggeräumt werden musste, bevor unbelastete Gespräche wieder möglich waren, und er zweifelte daran, dass diese Herkulesarbeit überhaupt zu bewältigen war.
Etwa um zehn Uhr nachts wurde zum allgemeinen Aufbruch geblasen.
Sarah schlug heute eine andere Richtung ein als Philipp, so dass sie diesmal nicht gemeinsam zur Haltestelle gingen. Seltsamerweise mischte sich bei Philipp in die äußere Genugtuung darüber ein leises Gefühl der Enttäuschung, das er aber nicht wahrhaben wollte. Nachdem er sich von allen verabschiedet hatte, ging er langsam durch die Kälte zur Straßenbahn, die ihn nach Hause bringen würde, wo niemand ihn erwartete.
Nach einem recht ereignislosen Wochenende kam Philipp am folgenden Montag etwas früher als sonst ins Büro. Er hatte im Laufe der letzten Woche im Büro des Generaldirektors wegen eines Termins angefragt, da er auf Grund seiner Absicht, die Bank zu verlassen, reinen Tisch machen wollte. Auch Erich, seinen unmittelbaren Chef, hatte er von seiner bevorstehenden Besprechung auf höchster Ebene informiert und irgendwann Ende letzter Woche war ihm schließlich die Mitteilung zugegangen, dass Dr. Schröder heute um zehn etwas Zeit für ihn erübrigen könne.
Schon auf dem Weg in die Bank hatte ihn nichts anderes beschäftigt als die Besprechung. Er hatte keine Ahnung, wie sie ablaufen würde. Wahrscheinlich war auch Erich eingeladen. Dr. Schröder würde ihn zweifellos dabei haben wollen. Philipp hatte jedenfalls den Plan, seine völlig perspektivlose Situation in der Bank zur Sprache zu bringen und, davon ausgehend, ein Ausstiegsszenario zu für ihn günstigen Konditionen, sprich, mit einer angemessenen Abfertigung, anzustreben. Schon seit er aufgestanden war, hatte er sich deshalb alle möglichen Wendungen des Gesprächs ausgemalt, um für jede auch noch so unwahrscheinliche Situation eine optimale Antwort parat zu haben. Das meiste, was er sich ausdachte, vergaß er allerdings kurze Zeit später wieder. Im Grunde war es nur seine Methode, mit der Nervosität vor der für ihn ungewissen Situation umzugehen.
Fünf Minuten vor zehn fuhr er mit dem Lift in den fünften Stock und meldete sich bei der Sekretärin des Generaldirektors, von der er gebeten wurde, noch einige Minuten zu warten. Wie er vermutet hatte, kam ein paar Minuten später Erich. Als er Philipp wahrnahm, sah er ihn etwas vorwurfsvoll an und sagte etwas wie: „Was führst du denn jetzt im Schilde?“. Zum Unterschied von Philipp wurde Erich sofort ins Zimmer von Dr. Schröder gebeten, als er kam. Zwei Minuten später war es dann schließlich soweit und die Sekretärin ersuchte Philipp, ins Chefzimmer einzutreten.
Als die Türe geöffnet wurde, war er wie immer beeindruckt von dem vielen Leder auf der Türe, auf den Stühlen und auf dem Schreibtisch. Die Kästen und Aktenschränke waren aus gediegenem Mahagoni und an den Wänden hingen abstrakte, aber sehr harmonisch zur Büroatmosphäre passende Bilder, bei denen es sich erkennbar um keine Drucke, sondern um Originale handelte.
Dr. Schröder und Erich saßen am Besprechungstisch. Als sie Philipp wahrnahmen, wies Dr. Schröder auf einen Sessel an der gegenüberliegenden Seite des Tisches und Philipp setzte sich. Irgendwie erinnerte ihn die Situation an eine Anklagebank.
„Sie haben um diese Unterredung gebeten, Herr Engelbrecht“, begann Dr. Schröder, „ich möchte aber vorausschicken, dass diese Vorgangsweise einer direkten Besprechung mit dem leitenden Angestellten ohne vorhergehende Befassung des unmittelbaren Vorgesetzten keineswegs den Normalfall darstellt. Da es allerdings gerade in Ihrer Abteilung vor Kurzem zu einigen Veränderungen gekommen ist und Ihr Ersuchen, wie ich annehme, damit im Zusammenhang steht, habe ich zugestimmt. Worum geht es also bitte?“
Dr. Schröder war ein Typ, der keinerlei Wert auf Freundlichkeiten oder sonstige Äußerlichkeiten legte. Wie Philipp aus sämtlichen bisherigen Begegnungen mit ihm erkannt hatte, waren seine Bestrebungen ausschließlich darauf gerichtet, Probleme bei der Verwirklichung seiner Vorhaben aus dem Weg zu schaffen. Diesem Ziel ordnete er alles unter. Dem entsprechend liefen auch seine Abteilungsleiter-Besprechungen ab, wie er von Erich wusste. Sie bestanden aus der Erörterung der offenen Probleme mit anschließender Festlegung der Lösungsmaßnahmen, deren Realisierung dann exakt überprüft wurde. Offensichtlich sah er auch in der Vorsprache von Philipp ein mögliches oder bereits reales Problem, das gelöst werden musste.
„In der Kreditabteilung hat es, wie Sie bereits angedeutet haben, große Veränderungen gegeben. Ich kann und will nicht die Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen beurteilen, aber es ist eine Tatsache, dass mehrere qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter der Kreditabteilung, unter anderem ich, derzeit ohne genaue Aufgabenzuteilung und großteils unqualifiziert beschäftigt werden. Dies ohne irgendeine Erklärung der Geschäftsleitung, so dass keine wie immer geartete Perspektive aus Mitarbeitersicht erkennbar ist. Deshalb möchte ich von Ihnen direkt hören, was Sie mit mir und den anderen Mitarbeitern der Kreditabteilung beabsichtigen, welche Zukunftsaussichten Sie uns geben können.“ Philipp sagte das alles mit festem Ton und war selbst überrascht, dass, spätestens seit er in seinem Sessel saß, jede Nervosität und Zurückhaltung von ihm abgefallen war. Auch die sachliche Art Dr. Schröders, der, wenn er etwas zu sagen hatte, dies ohne alle Umschweife tat, war dazu angetan, bei der Antwort einen adäquaten Ton anzuschlagen. Die Tatsache, dass Philipp sich von seiner Firma bereits innerlich gelöst hatte, trug das ihre dazu bei.
„Herr Engelbrecht, ich kann Ihnen nur sagen, was Sie schon wissen: Wir haben die Kreditabteilung auf ein vernünftiges Maß redimensioniert, wodurch das Problem zu lösen ist, was mit den frei werdenden Mitarbeitern geschehen soll, insbesondere da es durch ähnliche Aktionen in anderen Abteilungen auch sonst im Haus keine entsprechenden Posten gibt. Aus diesem Grund wurde ein Mitarbeiterpool für besondere Aufgaben geschaffen, der aus diesen Kolleginnen und Kollegen besteht. Das aus Ihrer Sicht Positive dabei ist, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit keine finanziellen Einbußen haben, obwohl ihre derzeitige Verwendung in ihrer Wertigkeit nicht Ihren Bezügen entspricht. Durch die mit Ihnen und den meisten anderen betroffenen Mitarbeitern abgeschlossenen Arbeitsverträge, die die Möglichkeiten des Dienstgebers, was Beendigung oder Bezugsreduktion betrifft, sehr stark einschränkt, sind Sie vor einer Kündigung ohnehin recht gut geschützt. Heute gibt es solche Verträge längst nicht mehr. Zu Ihren Zukunftsaussichten und Perspektiven kann ich Ihnen und auch Ihren Kollegen keinerlei Zusagen machen. In einem Betrieb, in dem rationalisiert wird, gibt es mittelfristig keine vernünftigen Perspektiven für die betroffenen Mitarbeiter. Etwas anderes zu sagen wäre Augenauswischerei, und dafür bin ich nicht zu haben. Sie haben im Grunde Glück, dass Ihre Arbeitsverträge in einer Zeit entstanden sind, in der noch nicht an solche Maßnahmen gedacht wurde, weshalb die Absicherung der Dienstnehmer in den Verträgen auch weit über jede sachgerechte Regelung hinaus geht und Rationalisierungen äußerst mühsam macht. Die derzeitige Situation muss aber nicht zwingend bedeuten, dass es für die betroffenen Mitarbeiter keinerlei Möglichkeiten mehr gibt. Die Finanzkrise macht die Aussichten zwar nicht rosiger, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.“ sagte Dr. Schröder.
Erich saß nur dabei und sagte kein Wort. Sein Blick verriet aber, dass er sich in der Rolle des Beobachters bei diesem Gespräch nicht besonders wohl fühlte.
Für Philipp hatte die ausschließliche Sachorientierung, die aus den Worten Dr. Schröders sprach, einen beklemmenden Beigeschmack. Er hatte das Gefühl, dass für diesen Mann die Kategorie Mensch keinerlei Stellenwert hatte und soziale Komponenten nur lästige Verpflichtungen waren, die ihn sein Ziel schwerer erreichen ließen.
„Und Sie glauben, wenn Sie so mit den Mitarbeitern verfahren, fördern Sie die Motivation und Produktivität?“ konnte sich Philipp nicht zurückhalten.
„Ich würde ersuchen, dass wir bei der Sache bleiben, meinen Kopf brauchen Sie sich in Bezug auf die Führung dieses Hauses wirklich nicht zu zerbrechen. Haben Sie noch eine Frage oder ein Anliegen? Aus meiner Sicht ist zu diesem Thema alles gesagt. Sollten Sie keine weiteren Punkte mehr haben, würde ich gerne Schluss machen, da ich noch einige Termine habe“, sagte Dr. Schröder.
„Ich habe noch etwas, das ich ihnen vorschlagen möchte. Sie haben selbst gesagt, dass eine Kündigung von Ihrer Seite nicht möglich ist, selbst wenn Sie es wollten“, begann Philipp.
„Das habe ich keineswegs gesagt, es gibt im Zuge von Geschäftseinschränkungen oder Betriebsübergängen durchaus Möglichkeiten, auch Dienstverhältnisse mit Kündigungsschutz zu lösen, derzeit wird daran aber nicht gedacht“, fuhr ihm Dr. Schröder dazwischen.
„Sei’s wie es sei, eine Frage habe ich. Was wäre es Ihnen wert, wenn ich einer einvernehmlichen Lösung meines Dienstverhältnisses zustimme? Meine Frage zielt natürlich auf die Höhe der Abfertigung ab.“ Als er es ausgesprochen hatte, sah er, wie Erich aufhorchte. Auch Dr. Schröder wirkte kurzfristig etwas überrascht. Er hatte offensichtlich nicht damit gerechnet, dass es jemand überhaupt in Betracht ziehen würde, die Sicherheit des geschützten Dienstverhältnisses für ein paar Monatsgehälter Abfertigung aufzugeben. Philipp selbst wartete nach seiner Frage gespannt auf die Antwort.
„Das müsste man sich ansehen. Grundsätzlich ist die Zahlung einer Abfertigung bei einer einvernehmlichen Lösung nicht ausgeschlossen. Wie ich gerade gesagt habe, ist durch die Maßnahmen im Zuge der Rationalisierung die Situation nun einmal so, dass wir zu viele Mitarbeiter haben. Sollten Sie anderweitig Möglichkeiten haben, wäre eine einvernehmliche Lösung natürlich auch in unserem Interesse.“ sagte Dr. Schröder nach der ersten Verwunderung sehr schnell. „Aber es hängt natürlich von der Höhe Ihrer Wünsche ab. Deshalb würde ich gerne konkrete Zahlen hören.“
‚Dir ist doch vollkommen egal, ob ich andere Möglichkeiten habe oder nicht‘, dachte sich Philipp, und der bisherige Verlauf des Gesprächs zeigte ihm deutlich, dass für Dr. Schröder die Entscheidung über seinen Vorschlag eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung darstellen würde. Aber das war beinahe mehr, als er sich erwartet hatte. Schließlich wäre es auch möglich gewesen, dass Dr. Schröder für Einzelfalllösungen wegen der Vorbildwirkung für andere Kollegen überhaupt nicht zu haben gewesen wäre.
„Ich könnte mir das Doppelte der gesetzlichen Abfertigung vorstellen bei Bezugszahlung bis Ende März und Dienstfreistellung ab sofort. Die Abfertigung soll beim formellen Ende des Arbeitsverhältnisses, also Ende März, zur Auszahlung kommen.“ Philipp hatte sich natürlich schon im Vorhinein überlegt, wie viel er, je nachdem wie es lief, fordern wollte. Da das Gespräch seiner Meinung nach keine schlechte Wendung genommen hatte und ihn wegen der Kaltschnäuzigkeit Dr. Schröders auch keinerlei Hemmungen davon abhielten, unverschämte Forderungen zu stellen, hatte er sehr hoch gegriffen.
„Meinen Sie das im Ernst?“ fragte Dr. Schröder.
„Ich glaube nicht, dass ich aussehe, als wollte ich Späße machen? Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder, Sie zahlen mir mein Gehalt, bis ich fünfundsechzig bin und anschließend noch die vertraglich vereinbarte Zusatzpension, obwohl ich ja Ihrer Meinung nach überzählig bin, oder Sie zahlen mir ein Jahresgehalt und sind mich dafür für immer los“, antwortete Philipp, dem seine Forderung, nachdem er das gesagt hatte, gar nicht mehr so unbescheiden vorkam.
„Na gut“, meinte Dr. Schröder, „ich ersuche um schriftliche Formulierung Ihres Angebotes, dann werde ich mich damit befassen, aber ich kann Ihnen keinerlei Zusagen machen, nur die, dass es ernsthaft geprüft wird.“
„In Ordnung“, sagte Philipp, „ich werde meinen Vorschlag auch noch schriftlich formulieren und anmerken, dass ich innerhalb von einer Woche eine Entscheidung erwarte, sonst gilt er als zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber meines Erachtens stehen Sie jetzt vor der Wahl, auf mein Angebot einzusteigen oder für die nächsten sechsundzwanzig Jahre eine Beschäftigung für mich zu finden.“ Nachdem er das gesagt hatte, verabschiedete er sich, stand auf und ging aus dem Zimmer. Er hätte gern die Gesichter von Erich und Dr. Schröder gesehen, widerstand aber der Versuchung sich noch einmal umzudrehen.
Als er wieder in seinem Büro war, schrieb er seinen Vorschlag zusammen, ging zu Erichs Sekretärin und gab ihr das Schriftstück mit dem Ersuchen um dringende Weitergabe an die Generaldirektion. Ihm kam das Ganze fast wie ein Spiel vor, bei dem er ausnahmsweise einmal eine reale Chance hatte, etwas zu gewinnen. Für ihn selbst war entschieden, dass er die Bank verlassen würde, egal ob er auch nur einen Cent Abfertigung bekommen würde. Sein Vorteil aber war, dass Dr. Schröder das nicht wusste, und wenn es irgendwie möglich war, wollte er diesen Informationsvorsprung in bares Geld umsetzen.
Dienstag Nachmittag bekam Philipp einen Anruf. Es war Piet, der an diesem Abend Zeit hatte und deshalb fragte, wie es mit einer Partie Schach und einem Glas Wein wäre. Philipp, der außer Montag und Donnerstag, den Tagen der Schulung, abends fast immer zu Hause war, ließ sich nicht lange bitten und es wurde vereinbart, dass er um sieben kommen sollte. Piet beschrieb ihm am Telefon nochmals genau den Weg zu seiner Wohnung. Sie befand sich in einem Außenbezirk, nicht in unmittelbarer Nähe von Philipp, aber mit dem Bus recht gut erreichbar.
Nach dem Büro machte Philipp noch einen Abstecher in seine Lieblingsvinothek und besorgte eine Flasche eines Weins, den er selbst sehr schätzte, als Mitbringsel für den Abend. Es war draußen ziemlich bewölkt und etwas nebelig, aber nicht mehr so kalt wie in den letzten Tagen. Durch den Nebel waren die Straßen nass, obwohl es nicht regnete, und der ganze Tag schien mehr in den Spätherbst als in den Winter zu passen. Vereinzelt hatten die letzten Wochen, die mit Frost und gelegentlich auch Schnee aufgewartet hatten, noch Reste der weißen Pracht übrig gelassen, welche durch die jetzt milderen Temperaturen allerdings vor sich hin schmolzen, während ihr prächtiges Weiß langsam ergraute. Es war die Zeit, in der man tun konnte, was man wollte, man hatte immer schmutzige Schuhe, wenn man eine Wohnung betrat. Bevor er nach Hause kam, war Philipp noch in den Sinn gekommen, ein paar Erdnüsse und Chips zu besorgen, denn Piet hatte keine Andeutung gemacht, dass es etwas Essbares bei ihm geben würde. Auf diese Weise wollte Philipp sicher stellen, zumindest ein wenig zum Knabbern zu haben.
Zehn vor sieben erreichte er das Haus, in dem Piet wohnte. Es war ein sechsstöckiges Wohnhaus aus den sechziger- oder siebziger Jahren, als Mangel an Wohnraum herrschte und von daher auf Äußerlichkeiten nicht viel Wert gelegt wurde. In der Straße, in der es stand, wechselten Plattenbauten und Industrieanlagen einander ab. Die ganze Gegend wirkte nicht besonders einladend und der Nebel samt dem Nieselregen, von dem er begleitet wurde, machte die Umgebung nicht sympathischer. Unten an der Eingangstür befand sich eine Sprechanlage. Philipp suchte sich unter den vielen Namensschildern jenes von Piet heraus und drückte auf die Klingel. Nach etwa einer halben Minute hörte er eine Art Krächzen, das offensichtlich Piets Stimme war.
„Ja bitte“, nahm Philipp mit einiger Anstrengung wahr. Es folgten noch ein paar unverständliche Geräusche, deren Bedeutung er aber nicht mehr entschlüsseln konnte.
„Hier ist Philipp“, antwortete er und hoffte, dass das genügen würde, um eingelassen zu werden.
„Es ist im vierten Stock, gleich links vom Lift“, rauschte aus dem Lautsprecher, diesmal etwas deutlicher als zuvor, worauf die Tür zu surren begann und Philipp sich beeilte, sie zu öffnen, bevor es zu spät war.
Das Stiegenhaus sah ziemlich verwahrlost aus und es schienen nicht alle Wohnungen belegt zu sein, da einige der Postkästchen neben dem Eingang aufgebrochen waren.
Philipp stieg in den schon etwas antiquarisch wirkenden Lift, der sich, nachdem das Stockwerk gedrückt war, langsam und bedächtig in Bewegung setzte. Als er im vierten Stock ausstieg, sah er auf der linken Seite neben einer geöffneten Wohnungstür schon Piet stehen, der ihm zuwinkte.
„Hallo, Philipp, da bist du ja“, rief er ihm freundlich entgegen. „Tag Piet, wie geht es Dir?“, antwortete er und freute sich ebenfalls.
Die Wohnung von Piet war nicht sehr groß, etwa fünfzig Quadratmeter, und eher spärlich eingerichtet. An das Wohnzimmer, in das man vom Eingang durch einen winzigen Windfang kam, schloss sich eine durch eine breite Schiebetür getrennte kleine Küche. Vom Wohnzimmer ging außerdem noch ein kleiner Gang weg, von dem aus man zum Schlafzimmer und zu einem kleinen Badezimmer kam.
Philipp sah sich kurz in der Wohnung um, ehe er Piet den mitgebrachten Wein und die Knabbersachen überreichte, wofür dieser sich bedankte. „Bitte, setz‘ dich doch“. Piet wies auf eine dunkelblau tapezierte Sitzbank im Wohnzimmer. „Ich komme gleich, ich hole nur was zu trinken und ... verdammt, wo habe ich eigentlich das Schachbrett hingegeben?“ rief er und verschwand in der Küche. Nach zwei Minuten kam er wieder mit einer geöffneten Flasche eines italienischen Rotweins in der einen und zwei Gläsern in der anderen Hand. Er stellte alles auf den Tisch und ging zu einem Kasten an der gegenüberliegenden Wand, wo er in einer Lade so lange herumkramte, bis er ein abgestoßenes, aber funktionstüchtiges Schachbrett samt Figuren herauszog.
„Hier, ich habe es schon lange nicht mehr verwendet, mindestens zehn Jahre. Ich kann mich noch erinnern, wie ich es als Junge zu meinem Abitur von einem Onkel geschenkt bekommen habe. Es sieht nicht mehr ganz so gut aus wie damals, aber man kann darauf spielen. Die Figuren sind handgeschnitzt, aus Belgien. Sieh mal, wie genau alles gearbeitet ist. So was bekommt man heute kaum mehr“, sagte Piet, während er sich zu Philipp an den Couchtisch setzte.
„Die sind wunderschön“, bemerkte Philipp, und betrachtete die wirklich sehr edlen Figuren, die die Zeit in ihrer Schachtel wesentlich unbeschadeter überdauert hatten als das Brett.
Plötzlich schlug Piet sich auf die Stirn. „Du hast ja Salzgebäck mitgebracht, warte, ich hole es, das können wir daneben essen. Ich kann auch ein paar Brote machen, wenn du Hunger hast.“ Philipp lehnte dankend ab. Piet holte die Chips und Erdnüsse, während Philipp bereits die Figuren aufstellte.
„Von wo in Holland kommst du eigentlich“, fragte Philipp, während er den ersten Zug machte. Er hatte die weißen Figuren.
„Ich bin in einem kleinen Ort im Süden von Holland geboren, er heißt Chavenede und hatte damals vielleicht zweitausend Einwohner. Total spießbürgerlich ging es da zu, das kann man sich kaum vorstellen. Aber mit achtzehn kam ich dann nach Amsterdam zum Studieren. Dort hab‘ ich Bodenkultur angefangen, das hat mich immer schon interessiert. Ich hab mir gedacht, ich könnte irgendwann in den Süden gehen und Wein anbauen. Nach dem Abschluss habe ich dann Ausschau gehalten nach einem interessanten Job. Eine Weile konnte ich aber gar nichts kriegen. Dann hat sich die Möglichkeit in der Firma eröffnet, wo ich heute noch arbeite. Es war zwar nicht genau das, was ich immer machen wollte, aber es war zumindest gut bezahlt. He, sieh mal an, da führt jemand was im Schilde!“ sagte Piet, während er die Flasche entkorkte und einschenkte.
Sie hatten beide die Eröffnung recht schnell gespielt und dabei erkannt, dass der jeweils andere tatsächlich einiges vom Schach verstand. Philipp hatte eine sehr offensive Eröffnung gewählt und Piet mit dem letzten Zug einiges aufzulösen gegeben.
„Na, na, nur die Nerven bewahren“, erwiderte Philipp, „und wie bist du dann nach Österreich gekommen?“
„Zunächst mal: Zum Wohl! Trinken wir einen Schluck!“ und sie tranken auf das Gelingen ihres Afrika-Projektes, das ihnen beiden im Grunde noch sehr unwirklich vorkam. „Na gut, wie bin ich nach Österreich gekommen?“, wiederholte Piet Philipps Frage, „Meine Firma hatte das Glück, gute Geschäfte zu machen und wurde immer größer, bis ihnen Holland zu klein wurde und sie mehrere europäische Niederlassungen eröffneten, unter andere jene in Österreich. Na ja, ich war schon immer interessiert gewesen, die Welt zu sehen, und da man mir die Vertretung in Österreich angeboten hat, habe ich nicht lange gezögert.“
Während er redete, sah Piet auf das Brett und brütete sichtlich am nächsten Zug. „Aber sag mal, was hast du in deinem Leben bisher gemacht? Beim Kurs damals hat man ja nicht viel erfahren.“
„In meinem Leben gibt es nicht viel Spektakuläres“, antwortete Philipp, „ich habe in Wien maturiert. Danach bin ich ein halbes Jahr nach Amerika gegangen und habe dort die Gegend unsicher gemacht. Als ich vor der Entscheidung stand, entweder zu studieren und noch mindestens vier Jahre meinen Eltern auf der Tasche zu liegen oder gleich selbst etwas zu verdienen, brauchte ich nicht lange zu überlegen. Meine Unabhängigkeit war mir immer schon heilig. Bald darauf fand ich eine aussichtsreiche Anstellung in der Bank, in der ich noch immer arbeite. Allerdings haben sich die Bedingungen seit damals entscheidend geändert. Mittlerweile haben die Mitarbeiter und ihre Anliegen überhaupt keinen Stellenwert mehr. Es zählen nur noch die Kennzahlen. Menschen sind zu reinen Kostenfaktoren geworden. In einem solchen Klima macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Wenn ich daran denke, wie wir uns früher ins Zeug gelegt haben, wenn es darum ging, etwas auf die Beine zu stellen oder eine Sache zeitgerecht zu schaffen, da hat niemand auf die Uhr gesehen, sondern wir sind alle so lange geblieben, bis wir fertig waren, und wenn es bis Mitternacht dauerte. Das hat damals keine Rolle gespielt, und glaub‘ mir, es wurden längst nicht alle Überstunden, die wir geleistet haben, auch bezahlt. Damals war auf allen Ebenen Teamgeist und Zusammenhalt spürbar, den es jetzt nicht mehr gibt. Heute wird den Mitarbeitern nur noch Geringschätzung und Misstrauen entgegengebracht. Da können solche Gefühle wie Motivation und Begeisterung gar nicht erst aufkommen. Du musst entschuldigen, aber wenn ich davon anfange, geht es fast immer mit mir durch. Jetzt wirst du sicher verstehen, warum ich von dort weg möchte.“
Piet hatte seinen Zug inzwischen gemacht und sagte: „Nur keine vornehme Zurückhaltung, die habe ich auch nicht. Ich verstehe dich da vollkommen. Meinst du, in meinem Unternehmen haben nicht auch schon längst die Kostenrechner und Rationalisierer das Kommando übernommen? Heute ist das leider so. Wenn man die Möglichkeit hat, wird man sich von so einer Firma verabschieden. Die meisten sind aber darauf angewiesen. Was würdest du machen, wenn du eine Frau und drei Kinder hättest. Dann könntest du dich nicht ohne weiteres auf so ein Afrika-Abenteuer einlassen, wie wir es vorhaben. Na, wie gefällt dir mein Zug?“
Philipp sah sich Piets Antwort auf seinen vorhergehenden Zug an und erkannte, dass dieser damit alle Drohungen pariert und gleichzeitig einen Bauern zum Schlagen angeboten hatte, der, wie Philipp nach kurzem Nachdenken erkannte, nicht genommen werden durfte, ohne dass er selbst entscheidend in Nachteil zu geraten drohte.
„Mir scheint, du hast nicht in der untersten Liga gespielt“, sagte er und überlegte seinen nächsten Zug sehr sorgfältig, da Piet offenbar auf einem Niveau spielte, das keinen Fehler erlaubte. Er hoffte, überhaupt mit ihm mithalten zu können.
„Ein wenig Erfahrung habe ich“, sagte Piet auf eine Weise, die heraushören ließ, dass er sehr wohl um seine Spielstärke wusste.
„Im Kurs hast du gesagt, dass du verheiratet warst, hast du auch Kinder?“ Als Philipp diese Frage stellte, glaubte er zu bemerken, wie Piet kurz zusammenzuckte, dachte aber gleich darauf, dass er sich getäuscht haben musste.
„Ja, ich habe zwei Kinder“, sagte Piet etwas kurz angebunden, „warst du schon mal verheiratet?“ Philipp hatte das unbestimmte Gefühl, dass Piet das Gespräch von seiner Person weglenken wollte.
„Ich bin geschieden, habe ich das nicht im Kurs gesagt?“
Philipp hatte sich die Stellung sehr genau angesehen und schließlich einen vorsichtigen Zug gefunden, der seiner Meinung nach kein Fehler sein konnte. Aber nachdem er gezogen hatte, erkannte er sofort, dass Piet nun eine Möglichkeit hatte, sehr schnell in eine überlegene Stellung zu kommen und war sicher, jetzt auf der Verliererstraße zu landen. Zu seiner Überraschung verpasste Piet aber den Gewinn mit einem überhasteten Zug, was Philipp die Möglichkeit gab, recht einfach wieder in eine ausgeglichene Stellung zu kommen. Die Partie endete schließlich remis, ein Ergebnis, das Philipp eher schmeichelte.
„Interessante Partie“, sagte Piet, „leider war ich zwischendurch unkonzentriert, ich hätte mehr daraus machen können.“
„Ja, das glaube ich auch. Willst du noch eine spielen?“ fragte Philipp.
„Etwas später vielleicht, noch einen Schluck Wein?“ Ohne die Antwort abzuwarten schenkte Piet nach.
„Na, wie war das mit deiner Ehe? Viel hast du ja bisher nicht gesagt, Herr Schweigsam. Hast du Kinder?“ fragte er ziemlich direkt, was Philipp vor allem deshalb verwunderte, da Piet offenbar selbst Probleme hatte, über seine Ehe zu reden. Aber vielleicht war das eine Art Flucht nach vorne.
„Ich habe ziemlich früh geheiratet“, begann Philipp, „und weiß bis heute eigentlich nicht, warum ich geschieden bin. Interessiert dich die Geschichte wirklich?“ Er nahm einen Schluck Wein.
„Hätte ich sonst gefragt?“, antwortete Piet.
„Ich habe geheiratet, als ich zwanzig war“, begann Philipp, „danach kam die schönste Zeit meines Lebens. Eheglück, bald darauf ein Kind. So ging es fast zehn Jahre. Dann wurde Sarah wieder schwanger.“
„Sie hieß Sarah, wie unsere nette kleine Krankenschwester im Kurs“, bemerkte Piet.
Philipp biss sich auf die Zunge, dass ihm der Name heraus gerutscht war, ließ sich aber nichts anmerken.
„Ach ja, richtig. Also, ich werde nie verstehen, warum sie dieses zweite Kind nicht wollte. Ab dem Zeitpunkt, als sie es erwartete, wurde sie ganz anders als vorher. Man konnte nicht mit ihr reden, jedes Gespräch endete in grundlosen Streitereien. Und dann hat sie etwas getan, das ich nie verstehen werde. Eines Abends hat sie mir plötzlich eröffnet, dass sie abgetrieben hat. Ich habe geglaubt, meinen Ohren nicht zu trauen, habe sie gefragt, warum sie nicht vorher mit mir geredet hat, da es ja nicht nur ihr Kind war, sondern auch meines. Aber sie hat sich nur eingesperrt und geweint. Ab diesem Zeitpunkt ist sie nachts nicht mehr zu mir ins Schlafzimmer gekommen, sondern hat im Gästezimmer übernachtet. Im Grunde haben wir seither nicht mehr geredet. Sie sagte mir nur noch, dass sie sich scheiden lassen wolle, die Bedingungen seien ihr egal. Ich habe der Scheidung schließlich zugestimmt, obwohl ich nicht wusste, wie mir geschah. Es wäre auch sinnlos gewesen, sich dagegen zu wehren, nach einiger Zeit der Trennung ist die Scheidung ohnehin nicht zu verhindern. Unsere Tochter Julia blieb bei mir. Meine Frau hatte nichts dagegen.“ Er nahm noch einen Schluck Wein, da er nichts mehr zu sagen wusste. „Tja, das war meine Ehe, mehr gibt’s nicht, Fortsetzung mit Happy Ende fehlt.“ Durch das Reden über diese Dinge war Philipp momentan den Tränen nahe, fühlte sich aber auch seltsam erleichtert.
„Und du hast keine Ahnung, was mit deiner Frau damals war, vielleicht war sie krank und hat nichts gesagt“, sagte Piet.
„Ich weiß keinen Grund, warum sie sich so hätte verhalten sollen, wir haben ja über alles geredet. Außerdem ist es nicht so, dass ich sie seither nicht mehr gesehen hätte, und sie machte nie den Eindruck, ernsthaft erkrankt zu sein“, sagte Piet.
„Vielleicht eine psychische Krankheit, Depressionen. Eine Schwangerschaft kann das manchmal auslösen“, setzte Piet seine Vermutungen fort.
„So starke Depressionen, dass sie abtreibt, ohne mit mir vorher zu reden und sich anschließend unverzüglich scheiden lässt? Ehrlich gesagt, möchte ich mir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, das habe ich lange genug jeden Tag getan. Jetzt will ich es nicht mehr wissen, es hat keine Bedeutung mehr für mich, ich habe damit abgeschlossen. Damals wollte sie mir nichts sagen, jetzt will ich nichts mehr hören.“
„Das klingt, als hättest du die Möglichkeit, sie zu fragen, was damals passiert ist, willst es aber nicht tun“, stellte Piet fest. Philipp fragte sich, ob dieser Holländer den sechsten Sinn hatte, oder ob sich aus dem, was er gesagt hatte, wirklich diese Schlussfolgerung ergab. Zum Glück sprach Piet weiter, ohne auf eine Antwort von Philipp zu warten.
„Hast du ihr vielleicht einen Grund gegeben, so zu reagieren?“
„Du meinst, ob ich sie betrogen habe? Glaubst du wirklich, ich würde dir diese ganze Geschichte erzählen und dabei verschweigen, dass ich der bin, der es faustdick hinter den Ohren hat?“ entrüstete Philipp sich.
„Na, na, es muss ja nicht gleich Ehebruch sein, vielleicht ein bisschen vernachlässigt, zu viel zu tun oder so was. Frauen reagieren auf so was oft mit völligem Unverständnis, unberechenbar, reden oft gar nicht vorher, drehen plötzlich durch, das kommt immer wieder vor:“ sagte Piet.
„Oh, da sitzt mir ein absoluter Frauenexperte gegenüber und ich habe es bisher gar nicht gemerkt“, erwiderte Philipp und beide mussten lachen.
„Ja, die Frauen, das ist eine eigene Geschichte“, sagte Piet sinnierend.
„Wie war eigentlich deine Ehe und woran ist deine Frau gestorben?“, fragte Philipp plötzlich, da er das Recht zu haben glaubte, auch etwas mehr zu erfahren, nachdem er selbst Einiges von sich erzählt hatte.
Piet wurde ernst. „Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe meine Frau in Holland kennen gelernt, kurz nachdem ich zu arbeiten begonnen hatte, und wir hatten eine glückliche Ehe. Dann passierte dieser furchtbare Unfall und seit damals bin ich wieder allein und habe auch keine Ambitionen, diesen Zustand zu ändern. Ein Jahr nach dem Unfall ging ich nach Österreich, ein Intermezzo, das demnächst zu Ende sein wird, wie ich hoffe.“
„Das tut mir leid!“ Philipp fiel nichts besseres ein, er meinte es aber ehrlich. Dennoch kam es ihm irgendwie seltsam vor, dass Piet so gar nichts Genaueres darüber sagen wollte. Immerhin war es schon sehr lange her und er war ja auch sonst nicht gerade ein wortkarger Typ.
„Komm, wir trinken noch ein Glas!“, sagte Piet plötzlich, und schenkte nach. Philipp, der normalerweise nach zwei Gläsern Schluss machte, ließ sich überreden, vor allem da Protest ohnehin nutzlos gewesen wäre.
„Wir müssen auf unsere bevorstehende gemeinsame Zeit in Afrika trinken. Schließlich werden wir, wenn ich es richtig verstanden habe, ziemlich eng zusammen arbeiten. Du organisierst die ganze Genossenschaft samt dem Kreditkram und ich werde mich um die Maschinen kümmern. Zum Wohl!“ Sie stießen an. Der italienische Wein, den sie tranken, lief hinunter wie Öl, Piet schien sich darin gut auszukennen.
„Also ganz ehrlich“, sagte Piet, „ich kann mir unter der ganzen Sache noch gar nichts vorstellen. Irgendwie ist es ein richtiges Abenteuer.“
„Mir geht’s genauso. Ich hoffe nur, dass ich meiner Aufgabe dort unten auch gewachsen bin. Bisher habe ich noch nie versucht, vollkommen selbständig etwas auf die Beine zu stellen“, erwiderte Philipp.
„Du wirst doch keine Angst haben, das schaffst du mit links, außerdem bin ich ja schließlich auch noch da. Wo zwei Köpfe etwas prüfen, da kann nichts schief gehen. Also, ich freu‘ mich schon auf unsere gemeinsame Arbeit dort unten. Komm‘, spielen wir noch eine Partie Schach!“ sagte Piet und begann, die Figuren neu aufzustellen.
„Nach der Partie muss ich aber los“, bemerkte Philipp. Wenn er auch noch nicht alles von Piet wusste und dieser sicher auch seine Ecken und Kanten haben würde, so konnte er sich doch vorstellen, dass sie beide bestens miteinander auskommen und sich in Afrika gut ergänzen würden. Langsam wurde ihm bewusst, dass dieses Afrika, dem sie alle entgegen fieberten, nicht nur eine Idee war, sondern dass es kommen würde, was immer es auch bringen mochte.