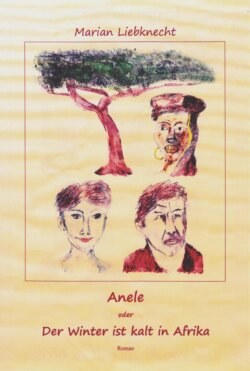Читать книгу Anele - Der Winter ist kalt in Afrika - Marian Liebknecht - Страница 6
3.
ОглавлениеAm Samstag traf Philipp sich mit seinem Freund Bernhard, mit dem er schon zusammen das Gymnasium besucht hatte. Er war der Einzige von damals, mit dem er noch regelmäßigen Kontakt pflegte. Der aktive Teil von beiden war meist Bernhard. Üblicherweise meldete er sich, worauf eine Zeit lang über alte Zeiten geredet und schließlich ein Treffen vereinbart wurde, bei dem es einmal ins Kino, dann wieder ins Kaffeehaus, oft auch ins Theater oder eben sonst wohin ging, wo gerade etwas Interessantes los war.
Diesmal hatte Bernhard sich etwas Besonderes ausgedacht. Er hatte seit Kurzem ein Kind in Afrika. Nicht sein eigenes, sondern eine dieser Patenschaften, bei denen man regelmäßig einen bestimmten Betrag - im Grunde lächerlich wenig - einzahlt. Sozusagen als Gegenleistung nimmt man Anteil an der Entwicklung des Kindes, bekommt Briefe, zunächst von einem Projektarbeiter und später vom Kind selbst. Wenn man will, kann man seinem Schützling irgendwann auch einen Besuch abstatten, allerdings nur einmal – es soll keine persönliche Bindung entstehen, das ist nicht Sinn der Sache.
Insgesamt gesehen erfüllten diese Patenschaften ihren Zweck recht gut. Sie brachten regelmäßiges Geld für jene, die es dringend benötigten, und der Pate hatte ein Gesicht, dem er seine Spenden zuordnen konnte. Das Geld verlor sich nicht in einem anonymen Topf, der einem das Gefühl gab, das meiste versickere irgendwo in der Verwaltung. Wer möchte schon die Beschaffung von Klopapier für die Büros irgend einer riesigen Organisation finanzieren. Nein, jeder möchte sehen, wie aus dem Geld, das er sich Monat für Monat abspart und überweist, das Pflänzchen eines kleinen, aber beständigen Glücks heranwächst, für das man sich zumindest mitverantwortlich fühlen kann. Diese Sehnsucht ist es, die mit einer solchen Patenschaft gestillt wird.
Heute fand eine Veranstaltung jener Organisation statt, über die Bernhard zu seiner Patenschaft gekommen war. Sie hieß „D.C.“. Es sollte über die Verwendung der Spendengelder berichtet werden. Daneben gehörte es immer auch zum Zweck dieser Veranstaltungen, neue Paten für Kinder zu werben. Das vor allem war auch das Ziel, das Bernhard mit dem Vorschlag, dorthin zu gehen, verfolgte. Er wollte Philipp ebenfalls als Paten für D.C. gewinnen, da er von der Idee, die den Patenschaften zu Grunde lag, begeistert war. Philipp hatte sich zunächst nicht besonders angetan gezeigt, willigte dann aber ein, mitzugehen, da er ein gewisses Interesse an diesen Dingen nicht ganz verleugnen konnte. Von Babsi hatte er seit dem Treffen in der Pizzeria nichts mehr gehört und auch er selbst hatte kein Bedürfnis gespürt, sie anzurufen. Solche Phasen einer ungeklärten kurzzeitigen Entzweiung hatte er mit ihr schon zwei- oder dreimal mitgemacht. Die letzten paar Male hatte es sich dann immer wieder dadurch eingerenkt, dass Babsi wegen irgend etwas Nebensächlichem angerufen hatte, mit dem unvermeidlichen Ergebnis einer bald darauf folgenden Verabredung. Diesmal dauerte diese Situation allerdings schon recht lange. Was Philipp dabei am meisten zu denken gab, war, dass ihm das Ganze vollkommen gleichgültig war. Erst vor Kurzem war ihm zu Bewusstsein gekommen, dass er volle zwei Tage so gut wie gar nicht an Babsi gedacht hatte. Sonst hatte er sich während solcher Phasen der Trennung immer irgendwie schuldig gefühlt und hin- und herüberlegt, ob er nicht etwas Falsches gesagt oder getan hatte. Diesmal fehlten solche Selbstzweifel gänzlich.
Sie waren inzwischen am Schottentor angekommen und gingen noch ein paar hundert Meter bis zur Universität, wo das Treffen stattfinden sollte. Am Haupteingang leuchtete ihnen ein Schild entgegen, das den Weg zum Veranstaltungssaal wies. Beim Betreten des Gebäudes aus dem späten neunzehnten Jahrhundert trat Philipp ein Geruch nach Holztüren und alten Büchern in die Nase. Er fühlte sich unwillkürlich in seine Schulzeit zurückversetzt und dachte an Hefte, frisch gespitzte Bleistifte und seine Lehrer von damals, die ihm das Leben schwer gemacht hatten.
Nach ein paar weiteren Hinweisen erreichten sie schließlich den Saal. Obwohl sie eine Viertelstunde zu früh eingetroffen waren, war schon alles vorbereitet. An der hinteren Wand hingen mehrere Bilder, die das Leben in einem afrikanischen Land zeigten, Menschen bei der Arbeit, Schulkinder, Vieh, Getreidefelder und weitere sehr beredte Motive. Ebenfalls an der Wand, gleich neben dem Eingang, stand ein Tischchen mit Salzgebäck, einem Krug Wasser und irgendwelchen ziemlich exotisch aussehenden Süßspeisen.
Sie brauchten nicht lange zu warten und ein freundlich lächelnder Schwarzafrikaner kam federnden Schrittes auf sie zu. Er mochte ungefähr 45 Jahre alt sein, hatte ausgesprochen ebenmäßig geschnittene Gesichtszüge und einen gepflegten Bart. Er erinnerte Philipp an den ehemaligen UNO-Generalsekretär. Der Afrikaner begrüßte die beiden sehr freundlich in stark akzentbehaftetem, aber sonst einwandfreiem Englisch und stellte sich ausführlich vor. Er hieß Moses und kam aus Swasiland. Ungefragt begann er zu erzählen, dass er dort zehn Jahre als Lehrer gearbeitet hatte. Als ein groß angelegtes Projekt der Organisation in Swasiland gestartet wurde, hatte er den Lehrerberuf aufgegeben und begonnen, in diesem Projekt mitzuarbeiten. Jetzt stellte er sozusagen den Kontaktmann von D.C. in Swasiland dar, der die Projekte auch mit der Regierung abzustimmen hatte, was, wie er sagte, nicht immer leicht war.
Danach wandte er sich direkt an Philipp, fragte, woher er komme und aus welchen Beweggründen er hier sei. Philipp, dadurch etwas überrumpelt, wusste im ersten Moment nicht, was er sagen sollte, da er im Grunde ja nur als Begleiter von Bernhard da war. Aber er musste schließlich antworten.
„I am from Vienna and I am very interested about your project.“
Noch während er sprach, kam ihm sein Englisch wesentlich schlechter als jenes des Afrikaners vor und der Satz, den er von sich gegeben hatte, schien ihm so banal, dass er am liebsten in den Boden versunken wäre. Sein Gegenüber zeigte sich dennoch sehr erfreut über die Aussage und gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass es hier in Österreich so viele wohlgesinnte Leute gebe, die an den Problemen der afrikanischen Staaten Anteil nahmen und die Bemühungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen unterstützten.
Während die Worte an sein Ohr drangen, dachte Philipp an etwas ganz anderes. Ihn wunderte die Diskrepanz zwischen Aussprache und Wortschatz, die gerade bei Afrikanern bestand, wenn sie Englisch sprachen. Oft hörte sich die Aussprache so schlecht an, dass man an einen Sprachanfänger dachte, während sich beim Zuhören herausstellte, dass der Sprecher die Regeln des Englischen ziemlich perfekt beherrschte.
„Have you already heard anything about our project?“, fragte der Afrikaner mit unverändert starkem Akzent schließlich weiter.
Durch seine abgeschweiften Gedanken war Philipp etwas verwirrt.
„No, I don’t know your country, but I hope to hear something today.“
Wieder kam er sich etwas einfältig vor, aber Moses war außerordentlich erfreut über sein Interesse. Er wandte sich daraufhin an Bernhard, der kaum erwarten konnte, ihm über seine vor kurzem übernommene Patenschaft zu erzählen und zu betonen, wie sehr er die Arbeit von D.C. bewunderte und schätzte. Aus Sicht von Philipp trug er etwas zu dick auf.
Schließlich entschuldigte sich Moses, da er weiter musste, um auch mit den anderen, mittlerweile hinzu gekommenen Gästen ein paar Worte zu wechseln.
In den zehn Minuten, seit Bernhard und Philipp herein gekommen waren, hatte sich der Saal zusehends gefüllt. Die Leute standen in kleinen Gruppen umher und unterhielten sich, betrachteten die an den Wänden befestigten Bilder oder lasen die Prospekte, die sie in die Hand gedrückt bekamen.
Ein paar Minuten nach der geplanten Beginnzeit stellte sich einer der österreichischen D.C.-Mitarbeiter auf das Podium und bat die Anwesenden, sich hinzusetzen. Er begann sehr blumig über die große Freude, dass eine Abordnung aus dem Projektgebiet in Swasiland nach Österreich gekommen sei, um hier aus erster Hand über die Fortschritte und Probleme des Projektes zu berichten. Er stellte die beiden Referenten des Abends kurz vor: Der eine war Moses, der Leiter von D.C. in Swasiland, der über die Mittelverwendung und den Fortschritt des Projektes berichten sollte. Die zweite, eine schlanke, sehnige Afrikanerin in einem farbenfrohen Kleid, die aussah, als könnte sie, wenn notwendig, auch kräftig zupacken, sollte die konkrete Arbeit im Projekt erläutern.
Moses ging ans Pult und malte in seinem akzentbehafteten, perfekten Englisch, das von einem österreichischen D.C.-Mitarbeiter summarisch übersetzt wurde, ein lebendiges Bild vom Land und seinen Problemen.
„Swasiland ist im Vergleich zu den umliegenden Staaten sehr klein“, begann er auf Englisch, „unsere Hauptstadt, Mbabane, hat nur etwa sechzigtausend Einwohner, und wir haben vielfältige Probleme, allen voran natürlich Aids, die Seuche, die den gesamten afrikanischen Kontinent zu entvölkern droht. Neben dieser Katastrophe scheinen alle anderen Probleme so unbedeutend und klein, dass sie leicht vergessen werden könnten. Aber gerade das wäre falsch. Mit Aids müssen wir leben, und es wird so bald nicht heilbar sein, jedenfalls nicht für die Menschen in Afrika. Aber das soll und kann uns nicht daran hindern, es mit den anderen Herausforderungen, wie unzureichender Schulbildung, Missernten, mangelndem Know How in so vielen Bereichen und vielem mehr, unter dem die Menschen unseres Landes leiden, aufzunehmen.“
Nach der sehr blumigen Einleitung, in der einiges an Pathos mitschwang, kam ein etwas sachlicherer Teil, in dem Moses genauer auf die Projekte einging und auch von seinen Verbindungen zur Regierung des Landes erzählte, das eine konstitutionelle Monarchie mit einem weitgehend uneingeschränkt herrschenden König war. Dem entsprechend gestalteten sich sehr viele Vorhaben schwierig, da sie letztendlich immer vom guten Willen des Monarchen abhängig waren. Der Data-Projektor war zur Unterstützung der Worte bereitgestellt. Es wurden vor allem Statistiken gezeigt, aus denen man die positiven Wirkungen des Projektes ablesen konnte. Eine Statistik gab Philipp zu denken: die durchschnittliche Lebenserwartung betrug dort unten weniger als 36 Jahre. ‚Bei uns war das vielleicht irgendwann im Mittelalter so, wenn die Pest durchs Land zog’, ging ihm durch den Kopf.
Nach Moses erzählte die Afrikanerin – sie hieß Dafina – von ihrer Arbeit. Was sie sagte, war interessant, teilweise aber – gelinde gesagt – erschütternd. Sie erzählte über die Verwendung von Patenschaftsgeldern, für viele Kinder die Grundlage ihrer Entwicklung, über den Bau von Schulen, aber auch über die Betreuung junger Aidskranker, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben und nur noch kurz für ihre Kinder, oft kaum dem Säuglingsalter entwachsen, sorgen können. Die Bilder zu ihrem Vortrag waren noch anschaulicher als bei Moses, da hier Menschen und nicht nur Statistiken zu sehen waren. Dementsprechend war auch die Reaktion des Publikums. Nachdem sie geendet hatte, herrschte eine Zeit lang Schweigen.
Nach einer kurzen Pause ergriff der österreichische Mitarbeiter, der Organisation, der eine Art Moderatorenfunktion wahrnahm, wieder das Wort und dankte für die Referate, worauf er sich an das Publikum wandte mit der Bitte, Fragen zu stellen.
Philipp war durch das Gehörte und Gesehene etwas verwirrt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Veranstaltung hier wirklich Eindruck auf ihn machen würde. Er war aber seltsam betroffen, ja, mehr noch, das alles hatte ihn unmittelbar berührt. Deshalb war er bei den ersten Fragen aus dem Zuhörerkreis, die irgendwelche Details zu den Patenschaften betrafen, geistig abwesend. Erst als eine junge Frau fragte, ob auch Österreicher bei Projekten im Ausland vor Ort als Mitarbeiter der Organisation mitmachen könnten, wurde seine Aufmerksamkeit wieder geweckt. Die Antwort war sehr ausführlich. Demnach war die Organisation interessiert an neuen Mitarbeitern, da man ohnehin unterbesetzt sei. Es sei allerdings eine Arbeit, die sehr viel Idealismus verlange. Der Verdienst sei angemessen, reich werden könne man damit aber nicht. Als die Information beendet schien, war das Interesse von Philipp noch nicht gestillt.
„Welche Anforderungen müssen Ihre Mitarbeiter erfüllen?“ fragte er.
„Nun, idealer Weise sollte Erfahrung in bestimmten Spezialbereichen vorhanden sein, zum Beispiel Medizin, Wirtschaft, Kranken- und Altenpflege oder Bodenkultur. Wenn jemand mit einer derartigen Ausbildung oder Berufspraxis zu uns kommt und wir uns dafür entscheiden, ihn aufzunehmen, wird er ausführlich über das Land, in das er entsandt werden soll, und über das Projekt geschult. Wie sie sich denken können, ist der Anreiz, den wir bieten können, nicht unbedingt dazu angetan, allzu viele erfahrene Leute zu uns ins Boot zu holen. Deshalb kommen auch viele unserer Mitarbeiter vor Ort aus dem Land selbst. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist eine Frage des Idealismus. Wenn jemand sich für die Arbeit in einem unserer Projekte entscheidet, tut er es, weil er es aus innerer Überzeugung möchte und nicht wegen finanzieller oder sonstiger Anreize. Wir freuen uns über jeden, der für uns arbeiten will. Sollten Sie Interesse haben oder jemanden kennen, der sich so etwas vorstellen kann, ersuche ich Sie, uns telefonisch zu kontaktieren. Die Telefonnummer ist im Prospekt abgedruckt.“
Philipp war mit dieser Antwort sehr zufrieden, auch wenn ihm selbst noch nicht wirklich bewusst war, warum er das alles eigentlich wissen wollte. Er nahm auch an der weiteren Diskussion regen Anteil. Bernhard zeigte sich ganz überrascht, da Philipp vorher gar nicht den Eindruck gemacht hatte, sich für das Ganze besonders zu interessieren.
Zum Abschluss der Veranstaltung gab die afrikanische Sängergruppe noch ein Lied zum Besten, dazu wurde die Trommel geschlagen. Es stellte sich als die Wiederholung immer derselben Tonfolge dar, auf- und abschwellend, mit monotonem Rhythmus. Der Reiz des Vortrags lag in der Hingabe der afrikanischen Musiker, die mitklatschten, während sie ihren ganzen Körper im Rhythmus bewegten, und vor allem in der stetigen Steigerung der Spannung und Intensität des Gesangs, der die Zuhörer immer stärker mitriss. Es hielt sie nicht mehr auf ihren Stühlen, mehr und mehr standen auf und begannen mitzuklatschen und das, was sie hörten, mitzusingen, auch wenn sie kein Wort davon verstanden. Auch Philipp stand auf, sah aber dem Geschehen nur ruhig zu. Als er in die schwarzen Augen der Menschen blickte, die ihre Körper immer ekstatischer bewegten und zum monotonen Rhythmus sangen, spürte er ihre überwältigende Freude und Begeisterung. Im selben Moment fühlte er aber auch Hoffnungslosigkeit, Leid und Verzweiflung aus ihnen strömen. Es waren zwei Seiten einer Medaille, eine Form der Hingabe an das Leben, die uns Europäern fremd geworden ist. Ohne dass er etwas dagegen tun konnte, fühlte er plötzlich, wie Tränen seine Wangen hinunter liefen.
Bernhard und Philipp gingen nach der Veranstaltung noch ein Bier trinken. Es war zwar erst halb sieben, aber die Dämmerung war schon hereingebrochen und auf dem Weg in die Stadt war es dem entsprechend kalt. Der Übergangsmantel, den Philipp trug, war zu dünn, um ihn ausreichend zu wärmen und er zog ihn deshalb so fest zusammen, dass ihm fast die Luft wegblieb. Bernhard wollte unbedingt in ein ganz bestimmtes kleines Bierlokal in der Innenstadt, das ihm offenbar ein Bekannter wärmstens empfohlen hatte, es sollte so eine Art Geheimtipp sein. Als sie eintraten, war es – wohl wegen der frühen Stunde – noch so leer, dass man sich unwillkürlich fragte, warum die nicht eine Stunde später aufsperren. Es war eine Art Kellerlokal, eher karg mit alten Holztischen und –stühlen ausgestattet. An den Wänden hingen Poster mit alter Bierwerbung und darüber verlief ein durchgehendes Regal, auf dem alle Arten von Bierflaschen verschiedenster Länder standen, die sich samt und sonders in der Karte wiederfanden. Dem Angebot der Lokalität entsprechend roch es nach abgestandenem Bier und zusätzlich nach Frittierfett, ein Dampf, der auch durch noch so gründliches Lüften wohl nicht hinauszubekommen war.
Philipp war bei der Kälte zwar eher auf einen Tee eingestellt gewesen, ließ sich dann aber vom Ambiente anregen und entschied sich für ein irisches Kilkenny.
Es entspann sich das gleiche Gesprächsthema, wie schon auf dem Weg hierher.
„Der Afrikaner vom Projekt in Swasiland war wirklich charismatisch“, sagte Bernhard, “das ist mir schon am Anfang aufgefallen, als er mit uns gesprochen hat. Na, wirst du jetzt auch eine Patenschaft übernehmen oder willst du vielleicht gleich nach Afrika gehen? Wenn ich denke, was du alles gefragt hast, scheint das ja gar nicht so unmöglich.“
„Ehrlich gesagt, sind in letzter Zeit einige Dinge passiert, die mich ernsthaft darüber nachdenken lassen, ob ich nicht eine vollkommen neue Richtung einschlagen sollte. Ich hab? dir ja schon erzählt, dass bei uns in der Bank derzeit alles auf den Kopf gestellt wird. Seit zwei Wochen ist unsere Abteilung dran.“ Philipp berichtete Bernhard von seinem Gespräch mit Erich, seinem Chef und die Zukunft, die ihn in der Bank erwartete.
„Ich habe gehört, Kollegen aus anderen Abteilungen wurden bei einer einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses das doppelte der gesetzlichen Abfertigung angeboten. Das wären bei mir eineinhalb Jahresgehälter. Kündigen können sie uns ja Gott sei Dank nicht so ohne Weiteres. Falls sie mir so ein Angebot machen, würde ich wahrscheinlich nicht lange nachdenken. Nach der Veranstaltung heute frage ich mich wirklich, ob ich nicht die Chance ergreifen sollte, einmal etwas ganz anderes zu machen. Vielleicht war das heute ein Fingerzeig.“ Philipp machte eine Pause, als müsste er über das nachdenken, was er gerade gesagt hatte.
„Und, glaubst du, Babsi würde dabei mitmachen?“, fragte Bernhard.
„Ist das dein Ernst? Ich bin mir hundertprozentig sicher, Babsi würde nicht mitmachen. Um Babsi dazu zu kriegen, bei etwas mitzumachen, muss dabei was rausspringen. Ob das, was du tust, Sinn macht, oder nicht, ist vollkommen egal, und wenn sie die Wahl hätte zwischen einem Job als hauptberuflich beschäftigte Arschwischerin und einem, bei dem sie Kinder vor dem Hungertod rettet, würde sie garantiert den ersten nehmen, wenn dabei auch nur ein Cent mehr rausschaut.“
Philipp war überrascht, dass er beim Namen Babsi so heftig reagierte.
„Ich brauch? wohl nicht zu fragen, ob ihr euch gestritten habt“, bemerkte Bernhard vorsichtig.
Philipp erzählte ihm über sein Gespräch mit Babsi im italienischen Restaurant und dass sie seitdem keinen Kontakt mehr gehabt hatten.
„Es ist komisch, aber manchmal gehen die beruflichen und die privaten Krisen Hand in Hand und du bist gezwungen, dein Leben auf völlig neue Beine zu stellen. Ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt genau mittendrin“, sagte Philipp.
„Aber Ihr seid doch immerhin schon fast zwei Jahre zusammen. So etwas wirft man doch nicht einfach weg“, erwiderte Bernhard.
„Was heißt wegwerfen? Seit der Pizzeria weiß ich, dass sie bei der Sache in der Bank nicht zu mir hält, und wenn ich mit so etwas wie heute käme, also als Entwicklungshelfer nach Afrika oder so, dann würde sie mich entweder auslachen oder als verrückten Idioten bezeichnen, der nicht kapieren will, wie die Welt läuft. Wenn ich darüber nachdenke, was uns beide eigentlich verbindet, fällt mir überhaupt nichts mehr ein“, antwortete Philipp mit einem etwas verzweifelten Gesichtsausdruck.
„Also, wenn ich dir einen Rat geben darf, Philipp, ich meine, ich bin nicht in deiner Situation, aber, überstürzen würde ich nichts. Du bist nicht mehr fünfundzwanzig. Und in irgend einem fremden Land, in dem du keine Freunde hast und niemanden kennst, völlig neu anzufangen, das ist nicht so einfach, wie du dir das vielleicht vorstellst. Du musst natürlich selbst wissen, was du willst, aber denk genau darüber nach. Bevor du nicht ganz sicher bist, was dir wichtig ist und worauf es dir ankommt, triff keine Entscheidungen, die du nicht rückgängig machen kannst“, sagte Bernhard eindringlich.
„Keine Angst, bevor ich nicht ganz sicher bin, werde ich nichts entscheiden“, versprach Philipp, aber in seinem Inneren war die Entscheidung schon viel weiter herangereift, als er es selbst wusste.