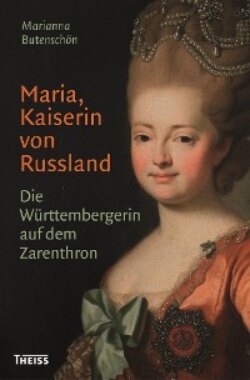Читать книгу Maria, Kaiserin von Russland - Marianna Butenschön - Страница 7
1
„Dortel“ Kindheit und Jugend
ОглавлениеStettin – Friedrich Eugen und Friederike Dorothea von Württemberg – Treptow an der Rega – Friedrich von Maucler – Johann Georg Schlosser – Katharina II. auf Brautschau – Achatz von der Asseburg – Mömpelgard – Henriette Louise de Waldner – Charakterisierung Dortels (1775) – Étupes – erste Ehe Pauls – Familienleben – Interesse an Russland – Verlobung mit Ludwig von Hessen-Darmstadt – Post von Friedrich II.
1759–1776
Sophie Dorothea Auguste Luise war die älteste Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Württemberg und der Prinzessin Friederike Sophie Dorothea von Brandenburg-Schwedt, einer Nichte Friedrichs des Großen. Sie wurde am 25. Oktober 1759, mitten im Siebenjährigen Krieg, in Stettin geboren – genau dreißig Jahre nachdem dort schon einmal eine Prinzessin Sophie zur Welt gekommen war, die nach Russland geheiratet hatte: Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, genannt „Fike“, die spätere Kaiserin Katharina II. und erste „Stettiner Zarin“.
Von Katharina persönlich wissen wir, dass sie „in Greifenheims Haus auf dem Marien-Kirchhof“ in der späteren Großen Domstraße geboren und im „linken Flügel des Schlosses“ erzogen wurde. Ihr Vater, Fürst Christian August, war preußischer Generalmajor und Stadtkommandant von Stettin, und das Schloss der pommerschen Herzöge, in dem die Prinzessin „drei gewölbte Stuben neben der Kirche innehatte“, war sein Amtssitz.1 Im Herbst 1742 war die fürstliche Familie nach Zerbst gezogen.
Hingegen stand die Wiege der zweiten „Stettiner Zarin“ ein paar hundert Meter weiter im Grumbkow’schen Palais am Rossmarkt, der zu den vornehmsten Adressen der alten Hansestadt zählte. Das Palais mit seiner prächtigen Fassade, das größte Gebäude am Platz, war nach Philipp Otto von Grumbkow benannt, dem ersten Oberpräsidenten der erst 1720 aus schwedischem in preußischen Besitz übergegangenen Provinz Pommern.
Doch wie kam die herzogliche Familie aus dem fernen Südwesten Deutschlands nach Hinterpommern? Wie Christian August von Anhalt-Zerbst, der in preußische Dienste getreten war, weil er ein Fürst ohne Land war, musste sich auch Friedrich Eugen, der dritte Sohn des Herzogs Karl Alexander von Württemberg, bei fremden Herren verdingen. Von seiner Apanage in Höhe von 10.000 Gulden konnte er in Württemberg jedenfalls nicht standesgemäß leben. Sein Vater hatte ihn zunächst für die geistliche Laufbahn vorgesehen, und als 18-Jähriger hatte er auch schon die Tonsur empfangen und ein Kanonikat zunächst in Salzburg, später in Konstanz erhalten.
Aber dann hatte sich der junge Mann doch für die Offizierslaufbahn entschieden und war im Sommer 1749 als Oberst der Reiterei in den Dienst Friedrichs II. getreten, an dessen Hof er und seine Brüder erzogen worden waren. Anfang 1750 ernannte der König ihn zum Chef des Dragonerregiments „Alt-Württemberg“, das seine Mutter, die Herzoginwitwe Maria Auguste, ein paar Jahre zuvor Preußen „überlassen“, d.h. an Preußen verkauft hatte. Das Regiment, das fortan den Namen „Herzog von Württemberg“ trug, stand seit 1749 in Hinterpommern, Stab und Leibschwadron waren in Treptow an der Rega, die anderen vier Schwadronen in der Umgebung stationiert. Am 1. Mai 1750 hatte Friedrich Eugen, ein Mann von „lebhaftem und ungeduldigem Naturell“, den Dienst in Treptow angetreten.2
Die Ehe mit der Nichte Friedrichs II. hatte seine Mutter betrieben, aber auch dem preußischen König lag an dieser Verbindung, weil er in der drohenden Auseinandersetzung mit Österreich ein ihm wohlgesonnenes Württemberg brauchte. Im April 1753 übertrug der König dem Herzog durch Kabinettsorder das Treptower Schloss zur Nutzung auf Lebenszeit. Die Hochzeit mit Friederike Sophie Dorothea, die in der Schwedter Kleinresidenz ihres Vaters und am Berliner Hof aufgewachsen war, fand am 29. November 1753 in Schwedt statt. Im Ehevertrag hatte Friedrich Eugen zugestanden, dass seine Kinder evangelisch-lutherisch erzogen wurden. Daraufhin hatten die württembergischen Landstände ihm eine zusätzliche jährliche Unterstützung bewilligt, so dass er nun über 43.500 Gulden Apanage verfügte, während das Wittum für seine Frau auf 18.000 Gulden erhöht wurde. Von der Apanage und den Zinsen aus der großzügigen Mitgift seiner Frau, die von ihrem Onkel 36.000 Reichstaler erhalten hatte, konnte Friedrich Eugen nun in Treptow standesgemäß Hof halten.3
Zum Zeitpunkt der Eheschließung war das Schloss zwar bewohnbar, jedoch für ein fürstliches Familienleben nicht geeignet, so dass Friedrich Eugen es unter beträchtlichen Kosten renovieren lassen musste. Um die Inneneinrichtung kümmerte sich die 17jährige Schlossherrin persönlich. Sie war eine gesellschaftlich anspruchsvolle, geistig interessierte junge Frau, besaß aber auch haushälterische Fähigkeiten und achtete streng auf Ordnung und Sparsamkeit.4 Schon 1753 begann Friedrich Eugen vor dem Kolberger Tor mit der Anlage eines Lustgartens „in der damals beliebten altfranzösischen, kunstreichen Manier, mit Taxus-Pyramiden, Lauben und bedeckten Gängen“.5 Im Sommer wurde zwischen den Pyramiden und in den Laubengängen gespeist und musiziert.
Im November 1754 kam der erste Sohn des Paares zur Welt: Friedrich Wilhelm, der künftige erste König von Württemberg, der seinen Namen zu Ehren Friedrich Wilhelms I., des „Soldatenkönigs“, erhielt. Ihm folgte Ludwig Friedrich, der Ende August 1756 – zu Beginn des Siebenjährigen Krieges – noch in Treptow geboren wurde. Doch nach der verlorenen Schlacht bei Groß-Jägersdorf in der Nähe von Insterburg im Juli 1757 fühlte sich Friederike Dorothea in Treptow nicht mehr sicher, weil mit einem weiteren Vordringen der Russen nach Pommern gerechnet werden musste, und zog mit den beiden Jungen und dem Hofstaat ins hundert Kilometer weiter westlich gelegene Stettin. Das schöne Barockpalais am Rossmarkt war für die junge Familie bestens geeignet. Allerdings kam Eugen Friedrich, der dritte Sohn, kurz nach der siegreichen Schlacht bei Zorndorf Ende 1758 im großelterlichen Schloss in Schwedt zur Welt. Nach der Geburt kehrte Friederike Dorothea mit den Söhnen nach Stettin zurück.
Dort erhielt sie die Nachricht, dass ihr Mann am 12. August 1759 bei Kunersdorf, wo Friedrich II. einer russisch-österreichischen Übermacht unterlag, am Rücken und am rechten Fuß schwer verwundet worden war. Er war 27 Jahre alt, längst Generalleutnant und ein Kriegsheld, als Sophie Dorothea, seine erste Tochter, während eines Erholungsurlaubs in Stettin geboren wurde. Kaum genesen, nahm Friedrich Eugen bereits wieder am Kampfgeschehen teil und wurde als Befehlshaber eines Entsatzheeres, das sich 1761 vier Monate lang vor dem belagerten Kolberg verschanzt hatte, aber aufgrund einer Hungersnot abziehen musste, noch berühmter. Der nächtliche Marsch über einen schmalen Dammweg ohne Verlust eines einzigen Mannes ist in die preußische Geschichte eingegangen.6 Am 16. Dezember 1761 ergab sich die Festung den überlegenen Russen unter General Pjotr A. Rumjanzew, der die Wege Sophie Dorotheas noch mehrfach kreuzen sollte. Danach übernahm Friedrich Eugen das Kommando über die preußischen Grenzbefestigungen in Pommern und Mecklenburg.
Am 27. Dezember 1761 wurde im Grumbkow’schen Palais noch ein kleiner Prinz geboren, der den Namen Wilhelm Friedrich erhielt. Wenige Tage später trat ein Ereignis von weltpolitischer Bedeutung ein, das auch für die Familie des Herzogs Folgen haben sollte. Am 5. Januar 1762 starb Kaiserin Elisabeth Petrowna, eine Tochter Peters des Großen, in Kolomenskoje bei Moskau, und ihr Neffe Peter Fjodorowitsch, geb. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf, trat als Peter III. die Nachfolge an. Damit war Friedrich II. gerettet. Denn der neue Kaiser, ein großer Bewunderer des Königs, rief umgehend sein Heer vom Kriegsschauplatz zurück, räumte die Provinzen Pommern und PreußenI, schloss im Mai einen Sonderfrieden und im Juni 1762 einen Bündnisvertrag mit Preußen. Drei Wochen später aber putschte sich seine Frau Katharina mit Hilfe zweier Garderegimenter an die Macht und ließ sich in der Kirche Unserer Lieben Frau von Kasan am Newskij Prospekt zur Kaiserin und Selbstherrscherin von ganz Russland und ihren Sohn Paul zum Thronfolger ausrufen. Kurz darauf wurde Peter III. vermutlich von Alexej G. Orlow, einem Bruder des Favoriten seiner Frau, in seinem Lustschloss Ropscha westlich von St. Petersburg ermordet. Die massive Kritik an der preußenfreundlichen Politik Peters III. hinderte Katharina II. jedoch nicht daran, die Annäherung an Preußen fortzusetzen und im April 1764 ein Verteidigungsbündnis mit Friedrich II. zu schließen.
Die Friedensverträge, die Preußen im Februar 1763 auf Schloss Hubertusburg im sächsischen Wermsdorf mit Österreich und Sachsen schloss, beendeten den Siebenjährigen Krieg. Preußen hatte sich – nach Österreich, Frankreich, Großbritannien und Russland – als eine der fünf europäischen Großmächte etabliert, und Friedrich II. war fortan der „Alte Fritz“. In der Folge sollte der österreichischpreußische Dualismus nicht nur die deutsche Politik bis ins 19. Jahrhundert prägen, sondern auch in die Lebensgeschichte der Prinzessin Sophie Dorothea hineinwirken.
Ende des Jahres 1763 kehrte die herzogliche Familie nach Treptow zurück, wo Friedrich Eugen und Friederike Dorothea alsbald ein Gesellschafts- und Kulturleben entfalteten, wie es die Stadt noch nicht gekannt hatte. Ihre Hofhaltung war glänzend, ihre Dienerschaft zahlreich. „Zur Unterhaltung der Herzoglichen Familie wechselten Vergnügungen des Hoflebens: Schauspiel, Musik, Ausfahrten und ländliche Feste“, heißt es in einer preußischen Quelle. „Erlaubte es irgend die Witterung, so ließ der Herzog seine Dragoner-Schwadron exerzieren; sie stellte sich auf dem Schlossplatze und machte hier einige Schwenkungen; die weiteren Uebungen, bei welchen die Herzogin mit den Kindern oftmals gegenwärtig war, wurden alsdann bald auf dem größeren Exerzierplatze, bald auf dem kleineren […] ausgeführt.“7 Bei den Ausfahrten über die Dörfer – die Herzogin fuhr gewöhnlich mit sechs Schimmeln, der Herzog mit sechs Braunen – waren die Kinder ebenfalls immer dabei. Das „Maibier“, das der Herzog seinen Soldaten auszugeben pflegte, war alle Jahre wieder eine öffentliche Lustbarkeit, an der die ganze Stadt und die umliegenden Dörfer teilnahmen.8
Es war ein ausgesprochen naturverbundenes und volksnahes Leben, das die spätere Kaiserin von Russland nie vergessen hat. Jenseits der beiden Rega-Arme hatte der Herzog ein großes Gelände von Gräben umziehen lassen, auf dem Hasen und Rebhühner gehegt und von der herzoglichen Familie auf ihren Spaziergängen gefüttert wurden. In einem eingezäunten Teil des Stadtwaldes hielt Friedrich Eugen Wildschweine, die im Winter gefüttert und dann zu großen Hetzjagden freigelassen wurden. Zum Vergnügen der Kinder spazierte auf dem Schlosshof ein Storch herum, und ein alter Hirsch gefiel sich darin, die jungen Obstbäume mit seinem Geweih so lange zu schütteln, bis das Obst fiel.9 Im Sommer wohnte die Herzogin in einem Chalet im Lustgarten und hörte den Nachtigallen zu. Oder sie besuchte die Meierei, die sie in der Nähe hatte einrichten lassen. Die Kinder sahen dann beim Melken und Käsen zu und tranken frische Milch. Die Mutter nahm sie auch gern mit in die Stadt. Die Dienerschaft hatte Anweisung, die herzoglichen Kinder mit dem Taufnamen und nicht mit dem Titel anzureden. Die älteste Tochter wurde „Dörtchen“ gerufen.10
Friedrich Eugen widmete sich nun ganz der Anlage seiner Gärten, und Friederike Dorothea teilte dieses Interesse ihres Mannes. Ihre Ehe war glücklich, ihr Familienleben vorbildlich. Beide legten Wert auf eine sorgfältige Erziehung ihrer Kinder, auch der Töchter, und beide folgten Jean-Jacques Rousseaus Devise „Zurück zur Natur“. Friederike Dorothea, der laut Ehevertrag die Erziehung der Kinder oblag, hielt Rousseaus (in Frankreich verbotenen) Bildungsroman Emile oder Über die Erziehung für die „vorzüglichste Lektüre“ und folgte damit Goethe, der darin das „Naturevangelium der Erziehung“ sah.11 Sie war und blieb eine fromme Frau, während ihr Mann sich zum Freidenker entwickelte.
Im April 1765 wurde Friedrich von Maucler, ein junger Offizier französischer Herkunft, der seit 1754 in verschiedenen Funktionen in den Diensten des Herzogs stand, zum Gouverneur der beiden ältesten Prinzen ernannt. Maucler, dessen Großeltern Frankreich wie so viele Protestanten (Hugenotten) aus Glaubensgründen verlassen hatten, stammte aus Stettin, wo sein Vater Konsistorialrat und Inspekteur aller französischen Kirchen Pommerns gewesen war. Wie Maucler in seinen Lebenserinnerungen berichtet, erfreute sich sein Vater auch der Wertschätzung des Fürsten von Anhalt-Zerbst und seiner Frau, die seine Eltern oft zu sich eingeladen hatten, während Fürstin Johanna und ihre Tochter Fike „einige Male meine Mutter mit ihrem Besuch beehrten“.12 Maucler konnte sich also rühmen, als Kind die künftige Kaiserin Katharina gekannt zu haben.
Ab 1766 diente der Frankfurter Jurist Johann Georg Schlosser, ein Freund Goethes und später dessen Schwager, dem Herzog als Geheimsekretär, sollte Goethe zufolge aber „auch der Erziehung seiner Kinder wo nicht vorstehen, doch mit Rat und That willig zu Handen sein“. Schließlich war Schlosser ein Mann, der „durch eine schöne und seltene litterarische Bildung jedermann anzog und das Leben mit ihm erleichterte“.13 Der Württemberger Mathematiker und Schriftsteller Georg Jonathan Holland war als Untererzieher für den wissenschaftlichen Teil der Erziehung zuständig. Gouvernante der Prinzessin (und ihrer Schwestern) war Frau von Borck, die Frau des Kommandeurs der Leibschwadron, die für den Grundschulunterricht zuständig war und Französisch unterrichtete.
Der Zeit entsprechend war Dörtchens Erziehung vom Geistesleben Frankreichs geprägt, und das Französische, die Salonsprache des 18. Jahrhunderts, erlernte sie schnell. Allerdings achtete die Herzogin streng darauf, dass den Töchtern „die Frivolität und der Leichtsinn“ der französischen Sitten und Gebräuche verborgen blieben.14 Dörtchen erhielt Unterricht in Konversation, Musik und Tanz, Zeichnen, Malen und Handarbeit, Geschichte, Geografie und Religion und lernte, wie man sich in der gehobenen Gesellschaft benimmt. Das war ihrer Mutter jedoch zu wenig. Friederike Dorothea ließ Dörtchen auch praktische Fertigkeiten und Kenntnisse in Hauswirtschaft erwerben, so dass sie später nicht nur in der Gesellschaft würde glänzen und repräsentieren können, sondern auch in der Lage wäre, Familien- und Hausfrauenpflichten zu erfüllen und ihre Kinder selbst zu erziehen.15 Diese Philosophie der Frauenerziehung hatte sie womöglich Molières Komödie Die gelehrten Frauen entnommen, die 1762 in Paris uraufgeführt worden war. Jedenfalls fand sich später im Archiv in Pawlowsk ein Heft, das Gedanken der Herzogin zu verschiedenen Themen und Auszüge von ihrer Hand aus bekannten Werken der Weltliteratur enthielt, u.a. folgende Stelle aus dem Zweiten Aufzug der Gelehrten Frauen:
„Es ist nicht recht und kann auch keinen Segen bringen,
Wenn sich die Frau befasst mit abstrakten Dingen.
Dass sie die Kinder lenkt in Sitte und Zucht,
Das Hausgesindel beherrscht und ökonomisch sucht,
Nicht übermäßig im Monat auszugeben,
Das ist die Philosophie in einer Hausfrau Leben.“
Nachdem sich am 21. Oktober 1763 ein weiterer Sohn eingestellt hatte, Ferdinand Friedrich, ein Friedenskind, folgten die Töchter Friederike Elisabeth (1765), Elisabeth Wilhelmine (1767) und Wilhelmine Friederike (1768). Den dritten Vornamen „Katharina“ erhielt diese kleine Prinzessin, die nur vier Monate alt wurde, mit gnädiger Erlaubnis der Kaiserin von Russland.16 Friedrich Eugen hatte darum ersucht. Doch wie kam er dazu? Schließlich konnte nicht jeder kleine deutsche Fürst die Kaiserin von Russland um die Erlaubnis bitten, eine neugeborene Tochter nach ihr zu nennen.
Indessen kam das kaiserliche Einverständnis nicht von ungefähr, denn Katharina II. pflegte vorauszudenken. Zweifellos war ihr der militärische Ruhm Friedrich Eugens bekannt, und möglicherweise hat sie sich für ihn interessiert, weil sie tapfere Offiziere immer brauchen konnte. Aber sie wusste auch, dass der Prinz eine Tochter hatte, die in ein paar Jahren ins heiratsfähige Alter kommen würde, und sie hatte angefangen, sich Gedanken über die Vermählung ihres Sohnes Paul Petrowitsch zu machen, der nun knapp 14 Jahre alt war. Also beauftragte sie den Freiherrn Achatz von der Asseburg, einen preußischen Diplomaten in dänischen Diensten, der sich mehr als zwei Jahre an ihrem Hofe aufgehalten hatte, Deutschland zu bereisen und an den deutschen Höfen nach einer geeigneten Braut für den Thronfolger Ausschau zu halten.
Auf der Liste der in Frage kommenden Häuser Hessen-Darmstadt, Mecklenburg-Schwerin, Nassau-Saarbrücken, Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Saalfeld stand das Haus Württemberg ganz oben. Und so war Treptow an der Rega das erste Reiseziel des kaiserlichen Abgesandten. Anfang 1768 hielt sich Asseburg einige Tage bei der herzoglichen Familie auf. Dörtchen war noch nicht einmal neun Jahre alt, „zog aber, wegen des Anscheins einer zukünftigen Schönheit und ihrer guten Erziehung“, bereits die Aufmerksamkeit des Diplomaten auf sich.17
Im weiteren Verlauf seiner Suche strich Asseburg eine ganze Reihe Kandidatinnen von seiner Liste. Die drei Prinzessinnen von Sachsen-Meinigen kamen nicht in Frage, weil „deren gänzlicher Mangel an physischen Vorzügen verhinderte, Rücksicht auf sie zu nehmen“. Eine Prinzessin von Sachsen-Coburg entfiel wegen der „Verwüstungen, welche die Blattern auf ihrem Antlitz verbreitet hatten“.18 Anfang Januar 1769 hielt sich Asseburg in Darmstadt auf und prüfte Friederike, Amalie, Wilhelmine und Luise, die jüngeren Töchter des Landgrafen Ludwig IX. und seiner Frau Karoline, der sog. Großen Landgräfin. Im September 1769 begutachtete er in Roda zwei Prinzessinnen von Sachsen-Gotha und befand Louise Friederike, die Jüngere, für „geeignet, um die Aufmerksamkeit der Kaiserin zu verdienen“.19 Ende des Jahres hatte er sich, inzwischen Gesandter des dänischen Königs in Stuttgart, aktuelle Porträts der Prinzessinnen Sophie Dorothea von Württemberg, Louise Friederike von Sachsen-Gotha und Wilhelmine Luise von Hessen-Darmstadt verschafft und sie nach St. Petersburg geschickt. Dann ruhte die Angelegenheit eine ganze Weile.
Mittlerweile hatte Friedrich Eugen den preußischen Militärdienst quittiert und betrieb seine „Etablierung“ in Mömpelgard. Er kränkelte nun, sein Fuß machte ihm immer noch schaffen. Im Juli 1768 war er mit seiner Frau über Berlin ins Land Württemberg gereist, das sie bereits von mehreren Besuchen und Kuren in Wildbad kannte. Die Kinder sollten alsbald nachkommen. Doch dann beschlossen die Eltern, die ältesten Söhne zur weiteren Ausbildung nach Lausanne zu schicken. Ostern 1769 reisten die Prinzen in Begleitung Mauclers und Hollands ab, während die drei Töchter und der kleine Ferdinand unter der Aufsicht der Frau von Borck noch eine Weile in Treptow bleiben sollten.20
Dörtchen, die ihre „teuren Brüder“ schmerzlich vermisste und traurig war, dass sie noch „in diesem traurigen Nest“ ausharren musste, erstattete ihren Eltern nun zweimal in der Woche in französischer Sprache akkurat Bericht über ihre Lernerfolge und ihre Alltagssorgen, denn sie war nun die „Hauswirtin“. Gelegentlich bat sie „um etwas Geld“, dann auch um Tassen, da „wieder alle zerbrochen sind“, oder sie fragte, ob sie dem Zimmermädchen einige von ihren Sachen zu Weihnachten schenken dürfe, da sie schon so abgenutzt seien, „dass ich sie nicht mehr gebrauchen kann“.21 Ihr schriftliches Französisch war jetzt schon besser als das ihrer Mutter, die es mit der Rechtschreibung nicht so genau nahm, doch ihre Kurzsichtigkeit hinderte sie daran, deutlich zu schreiben.
Ende Juni 1769 reisten Dörtchen, Friederike, Elisabeth und Ferdinand ihren Eltern in einem eigens entsandten Schlafwagen nach. Johann Georg Schlosser, der Geheimsekretär ihres Vaters, begleitete sie. In der Kutsche saß auch Anna Juliane („Johanna“) Schilling von Cannstatt, eine Hofdame der Herzogin, die von den Kindern „Tille“ gerufen wurde.II Sie stammte aus Thalheim bei Reutlingen und sollte in Dörtchens Leben noch eine große Rolle spielen. Am 7. Juli kam die Reisegesellschaft in Mömpelgard an, im August trafen dort auch der Herzog und die Herzogin ein.
Die linksrheinische Grafschaft Mömpelgard (Montbéliard) an der Burgundischen Pforte gehörte seit 1723 zum Herzogtum Württemberg und wurde von Stuttgart aus regiert. Im Laufe ihrer Geschichte war sie französischen und deutschen Einflüssen gleichermaßen ausgesetzt gewesen, die Bevölkerung war protestantisch und sprach Französisch.22 Mömpelgard, eine betriebsame kleine Handelsstadt mit Gymnasium und öffentlicher Bibliothek, besaß einen der ältesten botanischen Gärten Europas. Doch die Hoffnung Friedrich Eugens, von seinem Bruder Karl Eugen, dem regierenden Herzog, in Mömpelgard „etabliert“ zu werden, erfüllte sich nicht. Er blieb Privatmann, durfte mit seiner Familie jedoch das Stadtschloss beziehen.23 Der hochgelegene wuchtige Bau aus dem 13. Jahrhundert, der 1751 umgebaut worden war, bot zwar eine schöne Aussicht, wirkte im Vergleich zum Treptower Schloss jedoch kalt und düster.
Immerhin hatte die Württembergische Landschaft das Deputat Friedrich Eugens nach seinem Ausscheiden aus dem preußischen Militärdienst auf 68.000 Gulden im Jahr erhöht. Das war – im Vergleich zu den Einkünften seines Bruders, des regierenden Herzogs, der rund 1,5 Millionen Gulden jährlich bezog und mit vollen Händen ausgab – lächerlich wenig, und bald fiel es ihm schwer, damit auszukommen.24
Die Familie war gerade eingezogen, da stellte die Prinzessin-Mutter ihrer Ältesten auch schon eine junge Elsässerin „als Freundin“ vor, die sogleich in die Familie aufgenommen wurde: Gräfin Henriette-Louise de Waldner de Freundstein war auf Schloss Schweighausen westlich von Mülhausen groß geworden, hatte eine ausgezeichnete häusliche Erziehung genossen, war in beiden Kulturen zu Hause, sprach ebenso gut Deutsch wie Französisch, fühlte sich aber als Französin. Die Memoiren der späteren Baronin d’Oberkirch, die 1789 verfasst und 1853 erstmalig von ihrem Enkel veröffentlicht wurden, sind immer noch die wichtigste Quelle für die Mömpelgarder Jahre der späteren Kaiserin von Russland, müssen aber kritisch gesehen werden. Denn die Autorin war überaus stolz auf diese Freundschaft, die auch sie selbst erhöhte, und neigte dazu, die Herzogsfamilie zu idealisieren. Die Freundin hob sie geradezu in den Himmel.
Als die beiden sich kennenlernten, war Dörtchen zehn Jahre alt und fast so groß wie Henriette, die fünf Jahre älter und „sehr groß“ war. „Sie kündigte schon an, was sie gehalten hat, ein charmantes Naturell, ein gutes Herz und eine wunderbare Schönheit. Obwohl sie schlecht sah, waren ihre Augen prachtvoll, und ihr entzückender Ausdruck schien ein Abbild ihrer Seele zu sein.“25 Dörtchen mochte Henriette vom ersten Augenblick an und war ihr gegen alle Etikette gleich um den Hals gefallen. Sie muss gestaunt haben, als ihr die Ältere, die in der Familie alsbald „Lanele“ gerufen wurde, von einem Besuch in Straßburg erzählte, wo sie Erzherzogin Marie Antoinette vorgestellt worden war, der künftigen Königin von Frankreich, die am 7. Mai 1770 unter großem Jubel in die Stadt eingezogen war. Bei der Vorstellung hatte Marie Antoinette die ihr offiziell überreichten Blumensträuße an die anwesenden Damen weitergereicht, und Henriette hatte die schönste Blume ihres Straußes getrocknet. Nun schenkte sie die Blume ihrer neuen Freundin.26 „Diese liebe Prinzessin war für mich von einer Güte ohne Beispiel. Ich liebte sie leidenschaftlich; sie inspirierte dieses Gefühl allen, die sich ihr näherten, und niemand sonst verdiente es, so geliebt zu werden. Natürlich, intelligent ohne Dünkel, frei von jeglicher Koketterie, war sie vor allem von unbeschreiblicher Sanftmut.“27 Wenn Lanele nicht da war, schrieb die Freundin ihr ohne Unterlass lange Briefe und erklärte, nicht ohne sie auskommen zu können. Aber sie wurde nun nicht mehr „Dörtchen“ gerufen, sondern „Dortel“ oder „Dortele“, und so unterschrieb sie auch ihre Briefe.28
Schon Anfang 1770 hatte Friedrich Eugen sechs Kilometer südlich von Mömpelgard beim Dorf Étupes mit dem Bau einer Sommerresidenz begonnen, die aus der Mitgift seiner Frau finanziert wurde. Das dreiflügelige, zweistöckige Schloss mit Ehrenhof wurde im November 1770 fertig und war bald auch im Winter bewohnt. „Der Reichtum rivalisierte dort mit der Eleganz; seine Gärten erinnerten an lieblichste ländliche Gegenden“,29 hielt Lanele fest. Der botanische Garten von Mömpelgard mag Friedrich Eugen und Friederike Dorothea bei der Anlage ihrer Gärten inspiriert haben. Ihre Orangerie galt als eine der schönsten Deutschlands, die tempelförmige Rosenlaube der Herzogin als besonders gelungen. In dieser Umgebung wurde aus Dortel, die sich schon in Treptow für Pflanzen interessiert hatte, eine leidenschaftliche Botanikerin und Gärtnerin.
Die Meierei im Stil eines Schweizerhauses, in der die Herrschaften wieder beim Melken zusahen, enthielt eine Sammlung wunderbarer Fayencevasen und seltener Keramik aus dem 16. Jahrhundert. Die Grotten von Étupes waren voller Stalaktiten, die bei richtiger Beleuchtung aussahen wie Diamanten. Eines der bemerkenswertesten Objekte im Park war der Friedrich II. gewidmete Triumphbogen mit seinen korinthischen Säulenstellungen. Es gab auch eine Einsiedelei, in die man sich gern zurückzog. Für die Köhlerhütte im Wald, die Dortel und Lanele besonders liebten, waren Möbel „von eleganter Schlichtheit“ aus Paris angeschafft worden. Von hier aus brachten die beiden der Flora in ihrem Tempel Kränze, schmückten die Statue mit Girlanden aus Gänseblümchen, spielten zum Entsetzen der Gärtner Ball auf dem gepflegten Rasen und verbrachten viele Stunden bei den Vogelhäusern. Sie fütterten die Vögel und versuchten, den Papageien das Sprechen beizubringen. „Wir liebten dieses Schloss und seine Gärten über alles. Man genoss dort die gleiche Freiheit, die gleiche Bonhomie wie bei einem reichen Privatmann, der sein Haus froh und glücklich sehen möchte.“30 In Étupes war der Geist Rousseaus wohl noch präsenter als in Treptow. Das einfache und naturverbundene Leben galt als ausgesprochen fortschrittlich. Man spielte „Bauer und Bäuerin“ sowie „Schäfer und Milchmagd“, und auch „Blindekuh“ stand hoch im Kurs.
Auch in diesem Idyll blieb Dortel die große Schwester, die sich um die jüngeren Geschwister kümmerte. Deren Schar hatte sich am 3. Mai 1770 um Karl Friedrich vermehrt. Aus diesem Anlass wurde ganz Mömpelgard illuminiert, und Dortel aß eine Woche lang Dragées.31 Zu den Paten des Jungen zählte auf Bitten Friedrich Eugens auch die Kaiserin von Russland, die den Neugeborenen als „Zeichen meiner Zärtlichkeit“ und des Interesses, „das ich immer an seinem Wohlergehen haben werde“, sogleich zum Hauptmann ihres Leib-Kürassier-Regimentes ernannt hatte.32 Katharina hatte die Familie also im Blick behalten. In den beiden folgenden Jahren machten die Söhne Alexander Friedrich (1771) und Heinrich Friedrich (1772) das Kinderdutzend voll. Zu Alexanders Geburt war in Étupes ein Theater eingeweiht worden, in dem auch Ballettaufführungen stattfanden.
Doch nun hatte Friedrich Eugen wieder Geldsorgen. Der aufwendige Bau von Étupes hatte die Mitgift der Herzogin verschlungen, der Aufenthalt der älteren Söhne in Lausanne war nicht mehr finanzierbar. Sie mussten ihre Studien abbrechen und kamen Ende 1772 ebenfalls nach Mömpelgard.33 Dortel hatte die geliebten Brüder mehr als drei Jahre nicht gesehen und war überglücklich. Sie hatte nichts dagegen, dass die Entscheidung über das weitere Schicksal der Prinzen ein ganzes Jahr aufgeschoben wurde. Doch dann war es an der Zeit, einen Dienstherrn für sie zu finden. An eine Aussteuer für die Prinzessinnen war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken.
Unterdessen war Katharina II. weiter auf Brautsuche für ihren Sohn. Anfang 1771 hatte sie beschlossen, die Vermählung ihres Sohnes zu beschleunigen, weil sie die Zukunft der Dynastie gesichert sehen wollte. „Ich gestehe Ihnen, dass ich mit Mühen von der Wahl der Prinzessin von Württemberg absehe“, schreibt sie Asseburg, „aber die Vernunft siegt über die Leidenschaft; sie ist zu jung.“34 Im Frühjahr 1771 sagte die Mutter der Prinzessin Louise von Sachsen-Gotha ab, weil sie nicht wollte, dass ihre Tochter die Konfession wechselte, worauf Katharina die Erziehung der Prinzessin prompt „provinziell“ und ihren Bauch „gewaltig“ fand.35 Aber auch Wilhelmine von Hessen-Darmstadt, Tochter einer klugen Mutter und eines Vaters, der sich für den besten Trommler Deutschlands hielt, fand sie nicht überzeugend. Hinsichtlich ihrer Herzensgüte sei sie wohl ein „Meisterwerk der Natur“, aber sie neige zu Streit und habe zu viele Geschwister, die noch „etabliert“ werden müssten. Asseburg sollte sich aber „die Mühe geben, sie abermals zu prüfen“.36
Und so kam die Kaiserin wieder auf ihre „passion favorite“ zurück, die Prinzessin von Württemberg, die ihr als „gesund“ und „robust“ geschildert worden war. „Sie hat zwar auch den Mangel, elf Brüder und Schwestern zu haben, aber diese sind sehr jung. Suchen wir in diesem Mangel, wenn wir können, die Abhilfe, die uns passt. Prinz Friedrich Eugen von Württemberg, der Vater dieser Prinzessin, versäumt keine Gelegenheit, mir Aufmerksamkeiten zu erweisen und sogar Vertrauen zu bezeugen. Glauben Sie, dass er einige Kinder seiner zahlreichen Familie in meine Obhut geben könnte? […] Wenn er mir eines davon nach meiner Wahl anvertrauen würde, so wäre das seine älteste Tochter, die ich wählen würde; aber wenn ich, um diese zu bekommen, andere dazu nehmen müsste, dann wären das seine älteste Tochter und einer oder zwei seiner Söhne; einer von ihnen ist ja bereits in meinem Dienst.“37 Dabei erwartete Katharina allerdings, dass die Herzogin persönlich die Kinder nach St. Petersburg brächte. Friedrich Eugen hielt diese Bedingung wohl für unter seiner Würde und ging nicht auf das Angebot ein.38
Weitere Kandidatinnen lehnte Katharina ab, so dass Anfang 1772 nur zwei übrigblieben: Wilhelmine und Dorothea, von denen Asseburg inzwischen noch lebensgroße Porträts nach St. Petersburg geschickt hatte. Bei Wilhelmine vermisste Katharina nunmehr die frühere Heiterkeit im Gesicht, die gerade am russischen Hof unerlässlich sei, und blieb bei ihrer Vermutung, die Prinzessin sei streitsüchtig und vielleicht auch ehrgeizig. Dorothea fand sie lediglich „sehr weit für ihr Alter“. Mehr könne sie nicht sagen, „denn das ist ein Kind, dessen Beschreibung wir von Ihnen erwarten, aber mir scheint, nach ihren Zügen zu urteilen, dass die Herzensgüte ihr einziges Verdienst ist“. Asseburg, inzwischen russischer Geheimrat, sollte das „doppelte Examen“ aber noch bis März fortsetzen, bevor sie sich „für eine der beiden Bewerberinnen“ entschied.39
Doch nun trat Friedrich II. von Preußen auf den Plan, der seinen Neffen Friedrich Wilhelm, den Thronfolger, im Juli 1769 mit Friederike von Hessen-Darmstadt verheiratet hatte und eine Chance sah, ihre jüngere Schwester Wilhelmine mit dem Großfürsten von Russland zu vermählen. Im Oktober 1769 hatte er den Bündnisvertrag mit Katharina II. erneuert, und die Gelegenheit, mit der Kaiserin auch noch familiäre Bande zu knüpfen, konnte er sich nicht entgehen lassen. „Um Einfluss in Russland zu haben, musste man Personen dort hinbringen, die es mit Preußen hielten“, schreibt er in seiner Altersgeschichte. „Man durfte hoffen, dass dies dem Prinzen von Preußen nach seiner Thronbesteigung zu großem Vorteil gereichen würde.“40 Also ließ er Asseburg wissen, dass ihm die Prinzessin von Darmstadt die liebste sei. In Kenntnis dieser Überlegungen leistete der Diplomat, der nach wie vor preußischer Untertan war, „dem König so gute Dienste, dass die Prinzessin zur Gemahlin des Großfürsten auserkoren ward. Derartige für die Zukunft getroffene Maßregeln können trügen; trotzdem darf man sie nicht vernachlässigen“.41
Die „guten Dienste“ bestanden vermutlich darin, dass Asseburg der Kaiserin die herzogliche Familie nach einem Besuch in Mömpelgard im Mai 1772 so nachteilig schilderte, dass sie die potenzielle Verwandtschaft dann wohl doch zu provinziell fand. Aber hauptsächlich zählte in dieser Lage das Alter, und Wilhelmine war nun einmal vier Jahre älter als Dorothea. Darauf war es an Friedrich II., die Eltern in Darmstadt offiziell zu informieren. „Frau Kusine“, schreibt er im Mai 1772 der Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt, die er außerordentlich schätzte, „es bietet sich eine günstige Gelegenheit zu einer Lebensstellung für eine Ihrer Prinzessinnen. Ich habe für richtig gehalten, über diesen Punkt vor allem den Willen einer verehrungswürdigen Mutter zu erfahren. Es handelt sich um keine Kleinigkeit, Madame, sondern darum, ob eine Ihrer Töchter den Thron von Russland besteigt oder nicht. Die Sache ist durchführbar.“42 Karoline war begeistert.
Im Spätherbst entschied sich die Kaiserin, die Friedrichs Wunsch nicht übergehen konnte, für Wilhelmine, legte sich offiziell aber noch nicht fest, sodass die Landgräfin pro forma mit Amalie, Wilhelmine und Luise nach St. Petersburg eingeladen wurde. Die Reisekosten und Auslagen in Höhe von 80.000 Gulden übernahm Katharina, und es war abzusehen, dass die Heirat die zerrütteten Finanzverhältnisse des Darmstädter Hofes nachhaltig konsolidieren würde.
Im Mai 1773 machte sich Karoline samt Töchtern also auf die Reise und ging nach einem Zwischenaufenthalt in Potsdam in Travemünde an Bord der Fregatte St. Markus, die sie bequem nach Reval brachte. Auf dem Schiff soll einer der Marineoffiziere der Prinzessin Wilhelmine auffällig den Hof gemacht haben. Der gut aussehende junge Mann hieß Andrej K. Rasumowskij, war ein Freund Pauls aus Kindertagen und gehörte nach Studien in Straßburg und einer längeren Kavalierstour durch Europa wieder zur engeren Umgebung des Großfürsten.
Von Reval reisten die Hessen über Narva und Gattschina nach Zarskoje Selo, der Sommerresidenz Katharinas, in der sie am 26. Juni eintrafen. Drei Tage später hatte sich Paul Petrowitsch für Wilhelmine entschieden, die beim Übertritt zur russisch-orthodoxen Kirche den Namen Natalja Alexejewna erhielt. Die Trauung fand am 10. Oktober 1773 in der Kasaner Kirche statt. Ein pompöses Fest folgte dem anderen, und in den Journalen überboten die bekannten zeitgenössischen Dichter einander an Grußadressen und Oden. Die Wahl werde „allgemein gebilligt“, ließ die Kaiserin Asseburg wissen, verlieh ihm zum Dank für seine Mühen den Orden des Hl. Alexander Newskij und ernannte ihn zum Botschafter beim Reichstag in Regensburg.44
Zur Hochzeit war Ludwig, der ältere Bruder Nataljas, nach St. Petersburg gekommen. Der Erbprinz hatte in Leiden studiert und soeben seine Kavalierstour nach London und Paris absolviert. Unter den berühmten Enzyklopädisten, die er dort kennengelernt hatte, war auch der Literat und Diplomat Friedrich Melchior Baron von Grimm, der seit 1753 die Correspondance littéraire, philosophique et critique herausgab und auch mit Landgräfin Karoline korrespondierte. Als Grimm sich bereit erklärte, den Prinzen nach St. Petersburg zu begleiten, konnte er nicht ahnen, dass er Russland ein halbes Jahr später im Range eines Staatsrats verlassen und der wichtigste Korrespondent Katharinas II. in Westeuropa werden würde, der einzige, dem gegenüber sie kein Blatt vor den Mund nahm.
Eine Woche nach der Hochzeit seiner Schwester trat Ludwig, nunmehr Schwager des russischen Thronfolgers, in die Dienste der Kaiserin und nahm Anfang 1774 als General der Donau-Armee noch ein paar Wochen am laufenden russisch-türkischen Krieg teil, der Russland den nördlichen Kaukasus, die südliche Ukraine und das Protektorat über die Krim einbrachte. Angeblich fand der Prinz mehr Gefallen an starken Getränken als an heftigen Gefechten, und als er während eines längeren Aufenthalts der Kaiserin in Moskau auch noch in Streitigkeiten verwickelt wurde, schickte sie ihn im Herbst 1775 kurzerhand wieder nach Hause, wo er nichts Besseres zu tun hatte, als sich abfällig über sie und die Zustände an ihrem Hof zu äußern.45
Die großfürstliche Ehe aber nahm einen guten Verlauf, und Paul war glücklich. Er bete seine Frau an und lobe sie fortwährend, ließ Katharina die Landgräfin wissen, sie selbst liebe sie auch und sei „außerordentlich zufrieden“. Im neuen Jahr werde Natalja anfangen, Russisch zu sprechen.46 Die Kaiserin ließ ihren Sohn nun einmal wöchentlich eine oder zwei Stunden an „den Geschäften teilhaben“, was aber nur bedeutete, dass er ihr beim Regieren zusehen durfte. Er selbst entschied nichts, niemand wagte es, sich auch nur mit einer Bitte an ihn zu wenden. Gleichzeitig spürte Paul bei vielen Gelegenheiten, dass er besonders beim einfachen Volk beliebt war, beliebter als seine Mutter, und brüstete sich damit zum Ärger Katharinas auch in der Öffentlichkeit.
Doch schon ein Jahr nach der Hochzeit hatte sich das Verhältnis der Kaiserin zu ihrer Schwiegertochter gründlich verschlechtert. Natalja Alexejewna schien nichts richtig zu machen. „[Sie] ist ständig krank, aber wie soll sie es auch nicht sein?“ beschwert sich Katharina bei Grimm. „Alles treibt diese Dame im Übermaß: Wenn wir einen Spaziergang machen, sind es gleich zwanzig Werst; wenn wir tanzen, dann gleich zwanzig Kontertänze und ebenso viele Menuette, ohne die Allemandes zu zählen; damit es in den Zimmern nicht zu warm ist, heizen wir gar nicht; wenn die anderen sich das Gesicht mit Eis abreiben, wird bei uns der ganze Körper zum Gesicht: kurzum, die Mitte ist sehr weit weg von uns. Böse Menschen fürchtend, misstrauen wir der ganzen Welt und nehmen weder guten noch schlechten Rat an. Mit einem Wort, bis jetzt ist weder Liebenswürdigkeit noch Vorsicht noch Klugheit bei all dem zu beobachten, und Gott weiß, wozu das alles führen wird, weil wir auf niemanden hören und unseren eigenen kleinen Willen haben. Stellen Sie sich vor, dass wir nach anderthalb Jahren immer noch kein Wort Russisch sprechen. Wir fordern, dass man es uns beibringt, wollen der Sache aber nicht einmal einen Augenblick am Tage widmen; alles ist durcheinander, bald gefällt uns dies nicht, bald jenes; wir haben doppelt so viele Schulden wie Besitz, und doch besitzen wir, was kaum jemand in Europa besitzt. Aber kein Wort mehr; man darf an jungen Menschen niemals verzweifeln …“47
Was angeblich weiter geschah, geht aus vielen Quellen hervor, doch wollen wir den Berliner Heiratsvermittler zitieren: „Die neue Großfürstin betrug sich nicht so, wie man von einer Prinzessin ihres Geblüts erwarten durfte“, schreibt Friedrich II. in seiner Altersgeschichte. „Sie war in einer Zeit der Ränke und Kabalen nach Petersburg gekommen, wo der ganze Hof durch die Umtriebe der fremden Gesandten aufgewühlt war. Der spanische und der französische Vertreter setzten alles daran, um Hader zwischen Russland, Österreich und Preußen zu stiften. Fürchteten sie doch, dass ein allzu enges Bündnis zwischen diesen drei Mächten zustande kommen könnte. Um ihr Ziel zu erreichen, glaubten sie sich eine Partei bilden zu müssen, die ihnen zu Gebote stände. So kamen sie auf den Einfall, wenn sie die Großfürstin auf ihre Seite brächten, werde ihnen das übrige nicht schwer fallen. Zu diesem Zweck gewannen sie den Fürsten Rasumowski, der im persönlichen Dienste des Großfürsten stand. Als Werkzeug der Gesandten ging Rasumowski in seiner Dreistigkeit so weit, dass er zum Liebhaber der Großfürstin wurde, bei der er dank der Gunst ihres Gatten freien Zutritt hatte. Sie machte sich die Ansichten ihres Geliebten zu eigen und geriet völlig in seinen Bann. Auf diese Weise kam sie ganz in das Fahrwasser des spanischen Botschafters. Anderthalb Jahre nach der Hochzeit ward sie guter Hoffnung, aber wie man sich allgemein zuraunte, nicht von ihrem Gemahl. Der Berliner Hof bekam Wind von all diesen Umtrieben und gefährlichen Machenschaften.“48
Die Intrigen der Gesandten und ihres österreichischen Kollegen gegen das sog. „Nordische System“ (Russland, Preußen, Dänemark und England), das als Gegengewicht zu den „Südmächten“ Österreich, Frankreich und Spanien die Grundlage der Außenpolitik Katharinas II. bildete, waren nicht erfolgreich, brachten die Kaiserin aber noch mehr gegen Natalja auf. Das Verhältnis zwischen beiden Frauen kühlte weiter ab. Angeblich hat Katharina ihren Sohn vergeblich vor Rasumowskij gewarnt.
Von all dem wusste Dortel natürlich nichts. Sie war nun 15 Jahre alt und genoss einstweilen noch das ländliche Idyll von Étupes. „Ich kann die Geborgenheit, die Ruhe und den Frieden, den man auf diesem Fleckchen Erde genoss, gar nicht wiedergeben“, schreibt Madame d’Oberkirch. „Ein vertrauter Kreis, bestehend aus dem Hofstaat, einigen Einwohnern der Stadt, Nachbarn und ausländischen Besuchern, bildeten mit dem Prinzen und der Prinzessin eine reizende Gesellschaft. Wenn auch nicht alle gleich geistreich waren, so waren alle ihnen doch ergeben.“49 Abends unterhielt man sich und spielte Lotto, das Modespiel der Zeit. Die Kinder gruppierten sich um die Herzogin und ihre Damen, die Herren spielten Schach. Manchmal las Maucler alte Familienbriefe vor, die Dortel besonders liebte und deren Lektüre sie jedem Ball vorzog.50
Sie war zeitgemäß sentimental und exaltiert, wirkte aber auch ein bisschen prüde und affektiert, Eigenschaften, die sich im Laufe der Jahre verstärken sollten. Schon in Treptow hatte sie sich als geborene Hausfrau erwiesen, ihre Sparsamkeit grenzte an Geiz, ihr Ordnungssinn an Pedanterie. Der Baronin d’Oberkirch zufolge hatte sie sich als Zwölfjährige im Sommer 1772 „plötzlich“ für Russland interessiert. Die beiden hatten sich erkältet, weil sie unbedingt bei strömendem Regen durch den Garten laufen wollten. „Wir mussten im Zimmer bleiben, die Prinzessin und ich, denn wir teilten unser Schicksal, und ich weiß nicht, warum wir auf die Idee kamen, über öffentliche Ereignisse nachzudenken und uns mit der Vergrößerung Russlands infolge der Teilung Polens zu beschäftigen.III Ich habe schon erwähnt, dass die Prinzessin ein Vorgefühl ihrer künftigen Größe zu haben schien. Sie interessierte sich für diese Großmacht des Nordens mehr als für jede andere. Wir gaben uns Mutmaßungen hin und redeten recht vernünftig über das Thema dieser Teilung, wobei wir immerzu niesten und Lakritztee tranken.“51
Dass Dortels Interesse an Russland von einem „Vorgefühl ihrer künftigen Größe“ herrührte, muss jedoch bezweifelt werden, denn Mitte 1772 war die Zwölfjährige in St. Petersburg schon nicht mehr gefragt. Vielmehr wirkt ihr Interesse ganz natürlich, wenn man bedenkt, dass der Kontakt zum Petersburger Hof nun bereits vier Jahre währte, dass die Kaiserin die Patin ihres Bruders Karl war und dass Russland ständig Schlagzeilen machte, nicht nur, weil es zusammen mit Preußen und Österreich Polen geteilt hatte, sondern auch, weil es Krieg gegen die Türken führte. Zudem hatte sich Dortel im Geschichtsunterricht in Treptow ausführlich mit der Gestalt Peters des Großen beschäftigt.
In den „Memoiren“ der Baronin d’Oberkirch fehlen die Jahre 1773 und 1774. Wir können annehmen, dass in diesen Jahren in Étupes nichts Außergewöhnliches passiert ist, außer dass Friedrich Wilhelm, der älteste Sohn des Herzogs, im Frühjahr 1774 im Range eines Obersten in den Dienst Friedrichs II. trat. Seine Brüder Ludwig Friedrich und Eugen Friedrich sollten ihm folgen.52 Ansonsten ging das Leben in Étupes seinen gewohnten Gang. Dortel stand um 6 Uhr auf, erhielt Unterricht, widmete sich ihren Büchern und ihrem Cembalo, auf dem sie und Lanele manchmal vierhändig spielten. Der Unterricht in Geschichte war intensiver geworden, die Fächer Logik, Psychologie, Natur- und Wappenkunde waren dazugekommen. Den Zeichenunterricht erteilte Henri-François Violier, ein junger Miniaturmaler aus Genf, der in Paris studiert hatte, und Dortel machte enorme Fortschritte. Schon in Treptow hatte sie ein besonderes Interesse für Geometrie gezeigt, das nun stärker wurde. Kurzum, die Prinzessin erhielt eine für eine junge Frau ihrer Zeit ungewöhnlich gute, vielseitige Bildung. Sie wirkte älter, als sie war.
Sonntags ging man in die Kirche St. Martin, die evangelisch-lutherische Hauptkirche der Stadt. Dortel wurde nicht religiös erzogen, aber sie war doch ein frommes Mädchen. Ihre Mutter kümmerte sich auch in Mömpelgard um die Armenfürsorge und wurde darin früh von ihrer Ältesten unterstützt. Die Stadt hatte ein kleines Waisenhaus für zwölf arme Mädchen, das die beiden häufig besuchten. „Und so viele gute Werke! Wie oft habe ich gesehen“, schwärmt Madame d’Oberkirch, „dass die jungen Prinzessinnen sich einen Wunsch versagten, um armen Familien zu helfen!“53 Das war natürlich Verzicht auf hohem Niveau, doch die frühe Begegnung mit Armut, Not und Krankheit hat Dortel geprägt. Das Wissen davon hat sie nach Russland mitgenommen und bis zu ihrem Tod auch Mömpelgarder Bedürftige unterstützt.
Im Oktober 1775 wurde Dortel 16 Jahre alt. „Das liebenswerte Kind war eine schöne und charmante Prinzessin geworden“, schreibt Madame d’Oberkirch. „Ihr Verstand hatte sich entwickelt, ihr Herz war dasselbe geblieben, zärtlich und liebevoll. Der Altersunterschied, der uns trennte, wurde mit jedem Tag weniger spürbar; zu den ersten Sympathien des Herzens hatten sich die des Intellekts gesellt. Unsere Unterhaltungen nahmen oft eine ernste Wende; die Prinzessin Dorothea fühlte intuitiv, was gut war, und begeisterte sich für das Schöne; unsagbar glücklich sah ich, wie sich die Blätter dieser charmanten Rosenknospe öffneten […].“54
Zum Geburtstag hatte Lanele einen Korb voller Früchte, Weintrauben, Pfirsiche und Erdbeeren geschickt, die in Schweighausen reichlich gezüchtet wurden. Gelegentlich erhielt die Familie auf Bitten der Herzogin auch Fasane, Hühner und Enten „für die Wirtschaft“, Blumensamen, Rosenstöcke und Zwergbäume für den Garten und sogar Handschuhe aus dänischem Hundeleder, die gerade „in“ waren. Silvester 1775 ist Lanele in Erinnerung geblieben, weil Dortel ihr an diesem Tage vier Briefe schrieb, einen auf Deutsch, einen auf Französisch, einen auf Italienisch und einen auf Lateinisch.55 Da hatte sich bereits bis Schweighausen herumgesprochen, dass der Erbprinz von Hessen-Darmstadt sich um die Prinzessin bemühte, womit sie die Schwägerin der Großfürstin Natalja Alexejewna und des Großfürsten Paul Petrowitsch werden würde. Tatsächlich erschien Ludwig im März in Étupes und hielt um ihre Hand an. Dortel fand ihn eher mittelmäßig. „Sie hat ihn ziemlich gleichgültig behandelt“, notiert Lanele, „aber sie war gerührt von seinen Bemühungen, und nach langem Zögern willigte sie in diesen Bund ein.“56 Am 27. März 1776 fand die Verlobung statt. Wenig später teilte der Prinz seinem Schwager, dem Großfürsten, mit, dass er ohne finanzielle Unterstützung der Kaiserin nicht in der Lage sein werde, sich zu vermählen.57 Mit anderen Worten: Die hessische Heirat war alles andere als eine „gute Partie“.
Vier Tage nach Dortels Verlobung heiratete Lanele in Straßburg Baron Siegfried d’Oberkirch, einen älteren Offizier aus bester elsässischer Familie, die sich bis ins 12. Jahrhundert zurückführte. Sie war überzeugt, dass die Hochzeit der Prinzessin bald folgen werde. Doch Mitte Mai – Dortel sollte in acht Tagen konfirmiert werden – traf ein Kurier des Königs von Preußen mit einem Schreiben vom 7. Mai in Étupes ein. Von diesem Augenblick an nahm Dortels Schicksal eine Wende, an die sie nicht im Traum gedacht hätte.
I Seit 1772 Ostpreußen
II Als Tilles Geburtsjahr findet man die Jahre 1744, 1749 und 1759, so dass sie auch eine Kindheitsfreundin Dörtchens gewesen sein könnte.
III Der erste trilaterale Teilungsvertrag datiert vom 5. August 1772.