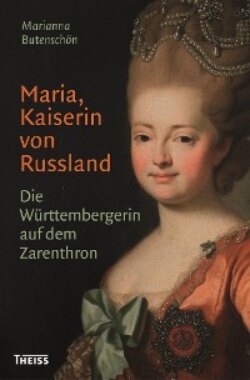Читать книгу Maria, Kaiserin von Russland - Marianna Butenschön - Страница 8
2
„Gute Harmonie mit Russland“ Eine unerwartete Ehe
ОглавлениеTod der Großfürstin Natalja Alexejewna – Prinz Heinrich in St. Petersburg – Wiederverheiratungspläne – Friedrich II. als Ehevermittler – Werben um Sophie Dorothea – Entlobung – Großfürst Paul Petrowitsch in Berlin – triumphaler Empfang – Abschied von Étupes – Reise nach Berlin – erste Begegnung mit Paul – gegenseitiges Gefallen – Charakterisierung Dortels (1776) – Verlobung in Berlin – Friedrich II. über Paul
1776
Am frühen Abend des 26. April 1776, einem Freitag, war in St. Petersburg die Großfürstin Natalja Alexejewna im Alter von nur 20 Jahren nach ihrer ersten Niederkunft gestorben, lange und qualvoll, aber ruhig und gefasst. Das Kind, ein Sohn, war am frühen Morgen des 25. April, vier Tage nach Beginn der Wehen, mit der Zange geholt worden. Es war eine Totgeburt.1 Erfahrenere Ärzte und Geburtshelfer wären vielleicht anders verfahren.2 Die Obduktion ergab, dass Natalja eine verkrümmte Wirbelsäule und ein deformiertes Becken hatte und außerstande war, ein lebendes Kind zur Welt zu bringen.3 Katharina II. fühlte sich getäuscht, denn Nataljas Familie wusste von der Missbildung und hatte sie ihr verschwiegen.
Wohl hatte die sterbende Großfürstin ihrer Umgebung durch ihre tapfere Haltung großen Respekt abgenötigt, doch die Kaiserin schien noch viel mehr gelitten zu haben und verlangte Mitgefühl. „Sie können sich nicht vorstellen, wie sie hat leiden müssen, und wir mit ihr: Meine Seele ist davon zerrissen; während dieser fünf Tage hatte ich keine ruhige Minute, ich war Tag und Nacht bei der Prinzessin, bis sie die Augen schloss“, schreibt sie Baron Grimm, ihrem neuen Brieffreund. „Ich gestehe Ihnen, dass ich nie in meinem Leben in einer so schwierigen, schrecklichen, bedrückenden Lage war: Ich vergaß zu trinken, zu essen und zu schlafen, und wie meine Kräfte das ausgehalten haben, weiß ich nicht. Ich fange an zu glauben, dass mein Nervensystem, wenn es durch dieses Ereignis nicht zerstört wird, unzerstörbar ist. […] Freitag bin ich versteinert, und bis jetzt fühle ich mich nicht gut; Stunden der Schwäche wechseln bei mir mit Stunden der Stärke; das kommt vom Wechselfieber, das aber eher moralisch als physisch bedingt ist. Wer das nicht gesehen oder gefühlt hat, kann sich das nicht vorstellen.“4 Da traf es sich gut, dass Heinrich von Preußen, der jüngere Bruder des Alten Fritz, seit Mitte April wieder in St. Petersburg weilte. Die Kaiserin und der Prinz kannten sich, seit sie als Kinder bei einem Besuch der fürstlichen Familie von Anhalt-Zerbst 1737 in Berlin so manchen Kontertanz zusammen getanzt hatten, und schätzten einander. Während seines ersten Aufenthaltes in Russland im Winter 1770/71 hatte Heinrich die Verhandlungen über die erste polnische Teilung in Gang gebracht. Nun war er nach St. Petersburg gekommen, um Details der polnisch-preußischen Grenzziehung und das Schicksal der Stadt Danzig zu besprechen und die Beziehungen zu Katharina zu festigen.
Denn den Erhalt der „guten Harmonie mit Russland“ betrachtete Friedrich II. als das „wichtigste Ziel“ seiner Politik. „Wir brauchen sie, und die Nachwelt kann sie noch mehr brauchen als wir“, hatte er den Bruder instruiert.5 Und dieser hatte seinerseits nach Berlin gemeldet, dass der Großfürst-Thronfolger dem König „mit Herz und Seele“ zugetan sei.6 Ansonsten war Heinrich mit seiner zweiten Reise nach St. Petersburg weniger zufrieden. „Die Faulheit der Minister, der Hang zu Leichtsinn und Vergnügen hat ein noch größeres Ausmaß als bei meinem ersten Aufenthalt“, schreibt er dem Bruder.7 Und so richtete er sich auf eine längere Verweildauer ein. Doch dann änderte der Tod der Großfürstin die Lage schlagartig, plötzlich war Heinrich nicht mehr als Diplomat, sondern als Freund und Seelentröster gefragt.
Wie Legationsrat Graf Solms dem König meldete, hatte Katharina den Prinzen am Nachmittag des 25. April gebeten, ihr zu helfen, ihren Sohn zu beruhigen. In seiner Gegenwart hatte Natalja ihrem Mann empfohlen, „zum Wohl des Reiches“ bald wieder zu heiraten, und ihn beschworen, „nie eine andere Gattin als aus seiner Verwandtschaft und aus dem königlichen Hause Preußen zu nehmen.“8 Und schon in der Nacht – Natalja lebte noch – hatten Katharina und Paul den Prinzen wissen lassen, dass sie sich, „falls das Unglück geschieht“, mit keinem anderen als dem Hause Preußen verbinden wollten und dass sie sich für eine Prinzessin von Württemberg entschieden hätten. Der König möge unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die Ehe des Erbprinzen von Hessen-Darmstadt und der Prinzessin Dorothea zu verhindern, „wenn noch Zeit ist“, und das Herzogspaar veranlassen, seine beiden ältesten Töchter nach St. Petersburg zu schicken, damit Paul eine Wahl hätte.9 Am nächsten Morgen um 8 Uhr war Heinrich erneut in den Winterpalast gerufen worden, um Paul beizustehen. Als gehörte er zur kaiserlichen Familie, war er sogar anwesend, als Natalja gegen 17 Uhr die Augen schloss.
Unterdessen hatte Katharina es sich anders überlegt und beschlossen, die Herzogin von Württemberg mit ihren beiden ältesten Töchtern nach Mitau, der Hauptstadt Kurlands, kommen zu lassen, wo Paul sie kennenlernen und seine Wahl treffen würde. „Das sind die ersten Ideen en gros, deren Ausführung Ihre Kaiserliche Majestät Ihnen, Sire, anvertraut“, schreibt Solms dem König am Abend des 26. April, während die Kaiserin und ihr Sohn auf dem Weg nach Zarskoje Selo waren.10 Heinrich folgte ihnen am nächsten Morgen. Er hatte die Chance einer weiteren für Preußen günstigen Ehevermittlung sofort erkannt und schaffte es durch sein mitfühlendes Auftreten, Mutter und Sohn vorläufig miteinander zu versöhnen, ein „Meisterwerk“, wie Friedrich fand.11 Noch am Samstag informierte auch er den König über die Absichten der Kaiserin und bat um strengste Geheimhaltung. Nun war allerdings nicht mehr von Mitau als Treffpunkt die Rede, sondern von Berlin. Dass Paul dorthin reisen würde, hatte Katharina bereits beschlossen, dass auch die Prinzessin von Württemberg in die preußische Hauptstadt käme, sollte der König veranlassen. Abschließend fügte Heinrich noch hinzu, dass der „Wechsel der Religion“ unerlässlich sei und seine Nichte davon in Kenntnis gesetzt werden müsse. Ihre Verlobung mit dem Erbprinzen hielt er offenbar für lösbar. Andernfalls solle der König ihm eine andere Prinzessin benennen.12
Paul aber war untröstlich, dachte an den Tod und beruhigte sich erst, als seine Mutter ihm Beweise für die Untreue seiner Frau vorlegte, ihre Korrespondenz mit Andrej K. Rasumowskij, der dienstlich immer in ihrer Nähe gewesen war. Hierbei konnte es sich aber auch um eine Intrige handeln, die Paul helfen sollte, seinen Schmerz zu überwinden.13 Indessen hielt Friedrich II. die Geschichte für wahr oder tat so. Graf Rasumowskij musste St. Petersburg jedenfalls umgehend verlassen, ging zunächst nach Reval und später auf ein Gut seines Vaters in der Ukraine. Die Tatsache, dass Katharina ihn schon 1777 als Gesandten nach Neapel, später nach Kopenhagen, Stockholm und Wien schickte, spricht eher gegen einen „Fehltritt“.I Doch die Schocktherapie verfehlte ihre Wirkung nicht. Erschüttert von dem vermeintlich doppelten Betrug seiner Frau und seines Freundes, ließ sich Paul bereitwillig auf die Idee einer schnellen Wiederverheiratung ein. Der Beisetzung Nataljas in der Mariä-Verkündigungs-Kirche des Alexander-Newskij-Klosters, in der auch Peter III., sein Vater, seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, blieb er fern.
Der Briefwechsel, der sich nun zwischen St. Petersburg, Berlin und Mömpelgard entspann, dokumentiert anschaulich, wie Dortel verheiratet wurde, wobei von ihr selbst nur selten die Rede ist. In dem erwähnten Brief Friedrichs II. vom 7. Mai, der wenige Tage vor ihrer Konfirmation in Mömpelgard eintraf, teilte der König ihrer Mutter, der Herzogin, eigenhändig mit, was geschehen war: „Meine liebe Nichte. Sie werden sicher sehr überrascht und erstaunt über das sein, was ich Ihnen schreiben werde; aber Sie wissen, welchen Wechselfällen die Angelegenheiten der Menschen unterliegen. Die Großfürstin von Russland ist gestorben, man hat die Augen auf Ihre Tochter geworfen, die dem Prinzen von Darmstadt versprochen worden ist, und man ersucht mich dringend, Sie um sie zu bitten. Da der Prinz von Darmstadt hier ist, hat man mich beauftragt, ihn zu veranlassen, von seinem Versprechen zurückzutreten. Sie verstehen, dass Ihre Tochter griechischII werden muss. Ich hoffe und schmeichle mir, dass Sie und Ihr Mann mit einer für die Familie so vorteilhaften Heirat einverstanden sein werden. Wenn das so ist, teilen Sie mir sofort mit, wann Sie mit Ihrer Tochter in Berlin eintreffen können. Der Großfürst wird selbst hierher kommen, und Sie werden sie bis Memel begleiten, wo sie von einem Hofstaat empfangen werden wird, der sie nach Petersburg bringt. Die Kaiserin wird Ihnen 60.000 Rubel für Ihre Reise geben, und das wird Anlass für gute Pensionen sein, die Sie, Ihr Mann und Ihre Kinder so dringend benötigen. Ich hoffe, auf diese Weise auch zu Ihrer aller Wohlbefinden beizutragen; etwas Glücklicheres konnte Ihnen nicht geschehen. Ich brauche sofort eine Antwort, denn in Petersburg ist man ungeduldig zu erfahren, woran man ist. Der Kurier, der Ihnen diesen Brief bringt, muss mir eine prompte Antwort zurückbringen. All das wird Ihnen keinerlei Ausgaben bereiten. Sie brauchen nur zwei Kleider für Ihre Tochter, und Sie werden von all dem hundertfache Zinsen erhalten. Ich gebe zu, dass dies alles Sie überraschen wird, aber ich hoffe zu gleicher Zeit, dass Sie, da Sie eine resolute Frau sind, den Entschluss fassen, den ich wünsche und der bedeutet, in die Vorteile einzuwilligen, die sich Ihnen bieten. Indem ich Ihre Antwort mit der größten Ungeduld erwarte, bitte ich Sie, mir mit aller möglichen Zärtlichkeit zu vertrauen, meine liebe Nichte, Ihr treuer Onkel Friedrich.“14
Wie wir sehen, hatten weder die Mutter noch gar ihre sechzehnjährige Tochter die Wahl. Sie hatten nicht einmal Zeit zum Nachdenken, und wahrscheinlich fanden sie das ganz normal. Was der König beschlossen hatte, wurde gemacht. Dabei hatte der „treue Onkel“ noch kurz zuvor zur „feierlichen Verlobung“ der Prinzessin Dorothea gratuliert und erklärt, wie „sehr passend“ er die Verbindung mit dem Erbprinzen finde.15 Am 9. Mai, als die Antwort aus Mömpelgard noch nicht eingetroffen war, ließ der erprobte Potsdamer Ehevermittler seinen Bruder in St. Petersburg denn auch schon wissen, dass es ihm gelungen sei, Ludwig, der ein paar Tage zuvor nichtsahnend in Potsdam eingetroffen war, zum Verzicht zu bewegen. „Ich gestehe Ihnen, dass er mich bis zu Tränen gerührt hat. Das Herz schwer vom unerwarteten Tod seiner Schwester, niedergeschmettert von diesem Verlust, hat er mir gesagt: ‚Ich verstehe, dass der Großfürst sich schnell wieder verheiraten muss, die Partie, die ihm am besten passt, ist meine Verlobte. Ich liebe sie, ich hatte mir viele glückliche Tage mit ihr versprochen; aber den Großfürsten liebe ich noch mehr, und ich bringe ihm meine Verlobte zum Opfer und würde ihm sogar mein Leben geben, wenn es ihm nützlich sein könnte.‘[…] Das ist ein Beispiel von Verbundenheit und Liebe, das unserem Jahrhundert Ehre macht.“16
Auch Heinrich, der noch nichts von dieser Unterredung wusste, hatte Ludwig aus dem fernen Zarskoje Selo aufgefordert, sein Wort zu lösen, und ihm dafür das Wohlwollen der Kaiserin in Aussicht gestellt, diese Aufforderung aber auch mit einer Drohung gewürzt. „Ich kann hinzufügen, dass Euer Hoheit hierdurch nicht nur den Eindruck auslöschen kann, den Ihr Verhalten bei Ihrer Kaiserlichen Majestät, der Kaiserin, hinterlassen haben muss, sondern auch die Hoffnung hegen darf, dass sie Ihnen weiterhin gut gesonnen sein wird, während Sie, sollten Sie in keiner Weise zu dieser so nützlichen und notwendigen guten Sache beitragen wollen, mit dem ganzen Groll des Kaiserlichen Hofes rechnen müssen.“17 In seiner Antwort betont Ludwig, dass er Russland niemals verleumdet, sondern im Gegenteil immer geliebt habe und selbst angeschwärzt worden sei. „Der beste Beweis, den ich habe liefern können, ist das schmerzhafte Opfer an sich, welches sich jedoch in große Freude verwandelt hat, als ich erfuhr, dass es für den Großfürsten geschieht, an welchen ich die mir versprochene Prinzessin von Württemberg nun abtrete und mit welchem ich in aller Hochachtung und auf das Innigste verbunden bin …“18 Es war klar, dass Ludwig den schlechten Eindruck, den er bei Katharina hinterlassen hatte, durch seinen Verzicht zu bessern suchte und auf finanzielle Entschädigung hoffte. Denn er war nicht nur mittellos, er hatte nun auch die 5.000 Rubel Pension, die seine verstorbene Schwester ihm ausgesetzt hatte, verloren. Katharina zahlte und schrieb Grimm, dass sein „dummer, langer Lulatsch Gänse hüten gegangen ist, mit einer Pension von 10.000 Rubel, aber unter der Bedingung, dass ich ihn weder noch einmal sehe noch je wieder von ihm höre.“19 Das ungebührliche Verhalten des entlassenen Freiers scheint der Grund dafür zu sein, dass Dorotheas Brüder in St. Petersburg vorerst nicht willkommen waren.
Nach Ludwigs Verzicht schickte Friedrich der „lieben Nichte“ in Mömpelgard einen zweiten Kurier. Ihm lag daran, die Heirat ohne Verzug zustande zu bringen, damit seine Gegner, insbesondere die Österreicher und Franzosen, keine Chance hätten, sie zu verhindern. „Um Himmelswillen, verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, die sich Ihnen bietet und die sich, wenn Sie sie sich entgehen lassen, nicht noch einmal bieten wird, und denken Sie daran, zu welchem Ruhm und zu welcher Größe Sie Ihre Tochter erheben, die mit der Zeit Ihrer ganzen Familie als Stütze dienen wird. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr man in dieser Angelegenheit drängt und wie sehr man mich anspornt, den Abschluss zu beschleunigen. Die Kaiserin und der Großfürst wünschen ihn dringend, und ich wette, dass Sie keine bessere Partie für Ihre Tochter in Europa finden. Antworten Sie mir also schnell, meine liebe Nichte, und möge diese Antwort zufriedenstellend sein.“20 Darauf erwiderte Friederike Dorothea, dass sich die herzogliche Familie „den väterlichen Absichten“ des Königs „mit dem demütigsten Vertrauen“ unterwerfe und verspreche, ihm in allem zu gehorchen und sich blind auf seine großzügige Fürsorge zu verlassen.
Indessen hatte die Herzogin kein Geld für die Reise nach Berlin und erbat einen Wechsel über 10.000 Écus, „was die Dinge beschleunigen wird.“21 Die Antwort des Königs datiert vom 20. Mai, woraus sich ergibt, dass der Kurier von Mömpelgard nach Berlin fünf Tage brauchte. „Ich werde Ihnen in kurzem den Wechsel schicken, und ich werde dafür sorgen, dass man in Russland nicht zögert, Ihnen einen viel größeren zu schicken; Ihre traurige Lage ist mir bekannt, und diese Heirat gibt mir sehr viele Möglichkeiten, um ein bisschen besser für Ihr Wohlergehen zu sorgen. Aber lassen Sie mich machen, und was ich nicht für Sie bekommen kann, müssen Sie als unerreichbar betrachten. […] Was die Pensionen und ähnliche Dinge betrifft, so werde ich mich bemühen, durch meinen Bruder Heinrich in Petersburg das Vorteilhafteste für Sie und Ihren Gatten zu verabreden. Ich sehe die Lage Ihrer Familie wie Sie selbst und werde versuchen, sie zu verbessern, soweit es mir möglich ist.“22 Abschließend empfahl der König seiner Nichte, „eine gescheite Kammerfrau“ zu finden, die ihre Tochter begleiten und ihr mit ihrem Rat dienen könne. „[…] Denn hinter Memel wird man ihr nur Russen, Kosaken, Georgier und Gott weiß was für Völkerschaften geben. Ich denke, Sie verstehen, wie wichtig dieser Rat ist und wie viel er in Zukunft zum Glück Ihrer Tochter beitragen kann.“23
Nun war mit der herzoglichen Familie nur noch die wichtige Frage der Konversion zu besprechen, die seinerzeit auch Katharinas Vater, den Fürsten von Anhalt-Zerbst, und Nataljas Vater, den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, umgetrieben hatte. Doch „von dieser Seite“ sah Friedrich keinerlei Schwierigkeiten, wie er Heinrich schreibt: „[…] da der Vater katholisch, die Mutter reformiert und die Kinder lutherisch sind, wird diese Familie mit einer GriechinIII die wichtigsten Sekten der Christenheit in Einklang bringen.“24 Heinrich aber empfahl seinem Bruder, „die Moral Heinrichs IV. zu predigen, dass Paris eine Messe wert ist.“25 Die Konfession sei doch nur die äußere Gestalt, argumentierten beide zusammen, der Kern der Religion überall der gleiche.
Ganz so einfach war es wohl nicht. Denn sicherheitshalber empfahl Heinrich seiner Nichte, „einen aufgeklärten lutherischen Geistlichen zu wählen, damit er nötigenfalls der jungen Prinzessin erkläre, wenn sie in den Stand gesetzt werde, das Glück ihrer Familie und ein Bündnis zwischen Preußen und Russland und damit die Wohlfahrt so vieler Völker zu begründen und den Wohlstand so vieler Privatpersonen zu fördern, so heiße es Gott dienen, wenn sie sich dazu einer Zeremonie unterziehe; die inneren Gefühle und Überzeugungen bleiben ihr ja.“26 Man sei in St. Petersburg „durchaus nicht streng“, fügte Heinrich hinzu und verwies auf Erzbischof Platon, den ehemaligen Religionslehrer Pauls, der „ein verständiger und gemäßigter Mann“ sei. Sophie Dorothea solle also „kein Vorurteil gegen die von ihr verlangte Änderung“ hegen.27 Auch hatte Heinrich in den Papieren der verstorbenen Großfürstin die seinerzeit für sie vereinfachte Abschwörungsformel gefunden, die Wilhelmine beim Übertritt hatte sprechen müssen und die er nun nach Mömpelgard schickte, weil auch Dortel sie würde sprechen müssen. Erzbischof Platon, ein hochgebildeter Mann und seiner Zeit voraus, hatte sie so redigiert, dass sie kein beschimpfendes oder beleidigendes Wort über die anderen Konfessionen mehr enthielt.
In ihrer Antwort an den Onkel teilt Friederike Dorothea mit, sie habe sich schon an einen lutherischen Theologen gewandt, „damit er die Zweifel meiner Tochter löse und meine Unruhe beschwichtige.“ Das ist dem Geistlichen offenbar gelungen, denn im gleichen Brief lässt die Herzogin wissen: „Meine Tochter beschäftigt sich bereits mit dem Auswendiglernen des Glaubensbekenntnisses, was, wie es mir scheint, auf jeden Fall notwendig sein wird.“28 Kurzum, in Mömpelgard hatte man verstanden, dass die russische Krone ohne Konversion nicht zu haben war, und die Tatsache, dass Dortel noch nicht konfirmiert war, dürfte der Prinzessin-Mutter das Gewissen erleichtert haben.
Und noch etwas war zu besprechen. Es galt zu verhindern, dass die Prinzessin am Petersburger Hof ähnlich aus dem Ruder lief wie ihre Vorgängerin, die politischen Ehrgeiz entwickelt hatte und der Ansicht gewesen war, dass Paul als rechtmäßiger Erbe Peters III. auf den Thron gehöre und nicht seine Mutter. Mehreren Zeitzeugen zufolge hatte sie ihren Mann nahezu despotisch beherrscht, so dass Paul nur noch ein Werkzeug in ihren Händen war.29 Das durfte nicht noch einmal passieren, die neue Großfürstin musste viel besser kontrolliert werden. Deshalb kam Friedrich in der Korrespondenz mit seinem Bruder mehrfach auf eine ältere Vertrauensperson zu sprechen, die Katharina der jungen Frau zur Seite stellen sollte. Schließlich schreibt er der Kaiserin: „[…] wir werden, Madame, diese junge Person als unsere Verwandte verleugnen, wenn sie Ihnen auch nur den geringsten Kummer bereitet. Sie ist jung und in größter Einfachheit erzogen worden, sie kennt weder die Intrigen der großen Welt noch die Winkelzüge, derer sich die Höflinge bedienen, um junge unerfahrene Menschen irrezuführen. Indem wir sie ganz unter den Schutz Eurer Kaiserlichen Majestät stellen, glauben wir, dass das sicherste Mittel, die Fehler zu vermeiden, die aus der Jugend und der mangelnden Erfahrung herrühren und die dieser jungen Prinzessin unterlaufen könnten, wäre, wenn Eure Kaiserliche Majestät die Güte hätte, ihr eine Vertrauensdame beizugeben, die ihr Benehmen überwacht, bis ihr der gereifte Verstand erlaubt, allein zu handeln. Ich bitte Eure Kaiserliche Majestät um Verzeihung, dass ich diese Details anspreche, aber ich glaube, dass es besser ist, unangenehme Dinge zu verhindern, als die Ereignisse dem Zufall zu überlassen.“30
Darauf erging eine offizielle Einladung an die Herzogin von Württemberg und ihre Älteste. Zur „Tarnung“ – die Angelegenheit war immer noch geheim – sollte auch die 11-jährige Friederike mitkommen. „Meine liebe Nichte“, schreibt der König aus Stargard nach Étupes, „ich schicke Ihnen anbei einen Wechsel über 10.000 Écus, um Ihre Tochter auszustatten; das wird reichen, denn sie wird in Russland viel mehr bekommen. In kurzem werde ich Ihnen einen Wechsel über 40.000 Rubel für Ihre Reise schicken; aber Sie brauchen nicht viel davon auszugeben, und im Übrigen wird man Ihren Töchtern eine Aussteuer geben und versuchen, sie zu etablieren.“31
Der folgende Brief des Königs enthielt nicht nur den angekündigten Wechsel, von der Kaiserin persönlich unterzeichnet, sondern noch eine weitere gute Nachricht für die „arme Familie“ seiner Nichte: „Alle Ihre Töchter werden von der Kaiserin eine Aussteuer erhalten, und Sie und der Prinz werden in jeder Hinsicht gewinnen. Vor allem werden Sie sich die Mitgift, die das Herzogtum Württemberg zahlen muss, in die Tasche stecken; dann wird es noch hundert gute Sachen geben, die Ihnen mehr denn je gerade recht kommen.“32 Am 8. Juni teilt der König mit, der Großfürst werde am 20. Juli in Berlin eintreffen, und bittet Friederike Dorothea und Friedrich Eugen, der darauf bestanden hatte mitzureisen, sich schon am 12. Juli in Potsdam einzufinden. Er habe „eine Menge Dinge“ mit ihnen zu besprechen.33 Und er würde genug Zeit haben, um die Prinzessin „ein bisschen auf die große Rolle vorzubereiten, die sie spielen wird.“34 Der Wunsch, die Heirat zum Abschluss zu bringen, hatte den König, der nun 64 Jahre alt war und sich eine Zeit lang müde und erschöpft gefühlt hatte, förmlich verjüngt. Als Kind hatte er Peter den Großen in Berlin gesehen und als junger Monarch die Fürstin von Anhalt-Zerbst und ihre Tochter auf dem Weg nach Russland in Potsdam begrüßt. Nun gedachte er, den russischen Thronfolger mit allem Pomp zu empfangen, dessen die preußische Monarchie fähig war. Schließlich war Paul nicht nur Staatsgast, er kam auch, um ihn, den König, seinen Patenonkel, zu besuchen, und Friedrich wusste von Heinrich, dass Paul seit Wochen nur noch von seiner Reise nach Berlin redete.35 Aus der Korrespondenz der königlichen Brüder geht hervor, dass Friedrich sich persönlich um alle Einzelheiten kümmerte. Jede Kleinigkeit war ihm wichtig. Schon am 1. Juni erhielten die Berliner Opernsänger Befehl, sich für den Besuch bereit zu halten. Der Alte Fritz, selbst ein Musiker von Rang, bestellte zwei Opern. Der junge Hofkapellmeister Johann Friedrich Reichardt erhielt den Auftrag, einen Prolog auf die Verlobungsfeier zu schreiben. Doch die Komposition gefiel dem König, der den Textentwurf selbst verfasst hatte, nicht. „Höchst komisch ist es nun zu sehen, wie R. unter den Augen Friedrich’s, der jede Note prüfte und geändert haben wollte, componiren musste, und welche sonstige Schwierigkeiten noch zu überwinden waren, bevor das Werk zur Aufführung gelangen konnte“, beobachtete ein Zeitgenosse.36
Wochenlang musste der Bruder in St. Petersburg nun Fragen über Fragen aus Berlin beantworten, weil er die Gepflogenheiten und Erwartungen der Russen besser kannte. In welchen Räumen des Berliner Schlosses sollte Friedrich den Großfürsten unterbringen, in welchen die Prinzessin? Wie sollte er den jungen Gast unterhalten, was ihm schenken? Wie viele Gänge sollten zu Mittag, wie viele zu Abend serviert werden? Wie viele Kammerdiener, Pagen und Lakaien sollten bestellt, mit wie vielen Pferden sollte Pauls Wagen bespannt werden? Waren 20 oder 40 Schuss Ehrensalut abzugeben? Welchen Wein trank der Großfürst, trank er morgens Kaffee, Tee oder Schokolade? Heinrich antwortete geduldig und detailliert. Die Braut spielte in diesem Frage- und Antwortspiel keine Rolle.
Ab Mitte Juni konnte der bevorstehende Besuch nicht mehr geheim gehalten werden. Denn nun mussten sich Köche, Pagen, Diener, Generäle und Offiziere, die den Großfürsten an der preußischen Grenze empfangen und nach Berlin begleiten sollten, auf den Weg nach Memel machen. In jeder größeren Stadt musste für Glockengeläut, Kanonendonner und Truppenspalier, manchmal auch für Claqueure gesorgt werden. Der König war nun doch merklich erschöpft, und am Ende freute er sich mehr auf Heinrichs Heimkehr als auf „den ganzen Rest“.37
Am 24. Juni brach Paul in Zarskoje Selo auf. Zu seinem wichtigsten Begleiter hatte Katharina II. – sicher nicht ohne Hintergedanken – Feldmarschall Pjotr A. Rumjanzew bestimmt, einen der Sieger von Kunersdorf und Eroberer von Kolberg (!), der durch seine Siege über die Türken und den von ihm ausgehandelten Frieden von Kütschük-Kainardsza (1774) noch berühmter geworden war und nun den Beinamen „Sadunaiskij“ („von jenseits der Donau“) trug. In der großfürstlichen Suite befand sich ferner der Dichter Ludwig Heinrich Nicolay, der durch seine Elegien und Briefe (Straßburg 1760) bekannt geworden war. Nicolay war nach dem Abschluss seiner Jurastudien in Straßburg zunächst Sekretär des russischen Gesandten in Wien gewesen und hatte den jungen Andrej K. Rasumowskij auf seiner Kavalierstour begleitet. Am Ende hatte er seinen Schützling wohlbehalten wieder in St. Petersburg abgeliefert und war als Lehrer für Paul engagiert worden – ein ruhiger, freundlicher Mann, der dem Großfürsten seit seiner ersten Verheiratung als Kabinettssekretär und Bibliothekar diente, aber auch seiner literarischen Tätigkeit weiter nachging.38
Prinz Heinrich folgte seinem Schützling auf dem Fuße. Die Kaiserin hatte ihn reich beschenkt und gebeten, vier Briefe zu besorgen. „Der erste ist für den König, Ihren Bruder, und die anderen für die Prinzen und die Prinzessinnen von Württemberg. Ich wage, Sie zu bitten (falls das Herz meines Sohnes sich für die Prinzessin Sophie Dorothée entscheidet, woran ich nicht zweifle), die drei letzteren gemäß ihrer Bestimmung zu verwenden und sie durch die überzeugende Beredsamkeit zu unterstützen, mit der Gott Sie ausgestattet hat. Die eindeutigen und wiederholten Beweise, die Sie mir von Ihrer Freundschaft gegeben haben, die hohe Wertschätzung, die ich für Ihre Tugenden entwickelt habe, und das Ausmaß des Vertrauens, das Sie mir eingeflößt haben, lassen mir keinerlei Zweifel an dem Erfolg einer Affäre, die mir so sehr am Herzen liegt. Hätte ich sie in bessere Hände legen können? Eure Königliche Hoheit ist ganz gewiss ein einzigartiger Unterhändler: mögen Sie meiner Freundschaft diesen Ausdruck verzeihen. Aber ich glaube nicht, dass es ein anderes Beispiel für eine Affäre dieser Art gibt, die verhandelt worden wäre wie diese. Das ist auch das Ergebnis der Freundschaft und des intimsten Vertrauens. Diese Prinzessin wird das Unterpfand dafür sein. Ich werde sie nicht sehen können, ohne mich daran zu erinnern, wie diese Affäre zwischen dem Königlichen Hause Preußens und demjenigen Russlands begonnen, weitergeführt und beendet wurde. Möge sie die Verbindungen, die uns einen, fortdauern lassen!“39
Heinrichs Aufenthalt am Hofe Katharinas war also doch noch ein voller Erfolg geworden, auch wenn er sich dort ordentlich gelangweilt hatte. In Riga holte der Prinz den Großfürsten ein. Die beiden verbrachten noch zwei Tage in der alten Hansestadt an der Düna und erreichten am 3. Juli Mitau, die Residenz der Herzöge von Kurland, wo Herzog Peter Biron sie großartig empfing. Dann reiste Heinrich allein voraus, um Paul standesgemäß an der preußisch-kurländischen Grenze begrüßen zu können. Am 7. Juli erwartete er ihn mit großer Suite in Memel. Die Fahrt der beiden durch das preußische Land nach Berlin dauerte zwei Wochen. Sie war, glaubt man dem König, „eine Kette von Festlichkeiten, bei denen sich Prunk und Geschmack um die Ehre stritten, den erlauchten Gast würdig zu feiern“.40
Binnen kurzem sprach ganz Europa von der Brautfahrt des russischen Thronfolgers. „Berlin wird es übrigens nicht an Publikum fehlen“, schreibt der König seinem Bruder. „Mecklenburg, Sachsen und die ganze Nachbarschaft wird herbeilaufen, um einen Großfürsten von Russland zu sehen.“41 Die Spannung in der Hauptstadt nahm täglich zu. „Die Aufregung, die dieser unerwartete Besuch an diesem Ort verursacht, entzieht sich jeder Beschreibung; der König persönlich liefert ein Beispiel an Prunk, von dem in diesem Land seit den Zeiten Friedrichs I. nichts gehört wurde. Seine loyalen Untertanen wetteifern miteinander, wer am prächtigsten aussieht“, meldet James Harris, der englische Gesandte, nach London.42 Zum ersten Mal in seinem Leben hatte der König nicht an Ausgaben gespart, galt es doch, die Kaiserin von Russland zu beeindrucken!
Während Paul auf dem Weg nach Berlin war, nahm Dortel Abschied von ihrer Familie. Als die Baronin d’Oberkirch Anfang Juli noch einmal kurz nach Étupes kam, weil ihre Freundin nach Berlin reisen musste und sich „für lange Zeit“ von ihr verabschieden wollte, ahnte sie schon, dass die Prinzessin nicht den Erbprinzen von Hessen-Darmstadt heiraten würde. „Aber wen dann?“, fragte sie sich.43 Die kleine Gesellschaft in Étupes fand Lanele in heller Aufregung vor, „denn es handelte sich um eine unverhoffte Heirat, sicher die höchste Stellung in Europa gleich nach der Königin von Frankreich“.44 Dortel aber warf sich ihr mit den Worten „Lanele, ich bin so traurig, dass ich euch alle verlassen muss, aber ich bin die glücklichste Prinzessin der Welt. Ihr werdet mich besuchen kommen“ in die Arme.45 Die beiden weinten. Auch Friederike Dorothea weinte. „Die Größe des Ehebundes verbarg ihr nicht, wie weit entfernt er war“, schreibt Madame d’Oberkirch und zitiert die Prinzessin-Mutter mit den Worten: „Und dann passieren den Zaren ja auch häufig Missgeschicke, und wer kennt das Schicksal, das der Himmel für meine arme Tochter bereit hält!“46 Doch die Freude über die Heirat war größer als die Angst vor einem Unglück.
Die letzten Tage in Étupes vergingen wie im Fluge. Die beiden Freundinnen stellten Vermutungen an, machten Pläne, träumten und schliefen überhaupt nicht mehr. „Die Prinzessin Dorothea übte den Empfang bei Hofe, was uns unwillkürlich zum Lachen zwang. Sie grüßte alle leeren Sessel, um sich beizubringen, wie man sich graziös bewegt, achtete aber darauf, dass sie nicht mehr gab, als sie musste. Ab und zu unterbrach sie sich mitten in ihrem Spiel und wandte sich mir zu: ‚Ich habe Angst vor Katharina, sie wird mich einschüchtern, dessen bin ich mir sicher, und sie wird mich für ein richtiges Dummchen halten. Wenn es mir nur gelingt, ihr und dem Großfürsten zu gefallen!‘“47 Darüber machte sich Lanele jedoch keine Sorgen. „Die Prinzessin Dorothea […] war für die Krone geboren; sie freute sich wie ein Kind auf ihre Ehe.“48
Anfang Juli brachen Friedrich Eugen und Friederike Dorothea mit ihren Töchtern auf. Der Abschied war tränenreich, Dortel konnte sich einfach nicht von den kleinen Geschwistern und den Erziehern, von der Freundin und von Étupes trennen. Schließlich musste sie ohnmächtig in die Karosse getragen werden.
Am 12. Juli kamen die Württembergs in Potsdam an. Wir wissen nicht, was Friedrich II. mit ihnen besprochen hat. Wahrscheinlich hat er ihnen gesagt, wie sie sich dem Großfürsten gegenüber zu benehmen hätten. Sicher hat er Sophie Dorothea nahe gelegt, sich der Kaiserin in allem zu fügen und ihre Pflicht zu erfüllen. Und die unerfahrene, naive Sechzehnjährige wird es ihm gern versprochen haben. „Sie ist sehr viel besser erzogen, als Prinzessinnen von Deutschland es gewöhnlich sind“, schreibt er Heinrich anderntags. „Sie hat Kenntnisse und scheint ein ganz sanftes Naturell zu haben. Soweit ich das beurteilen kann, da ich sie ja nur kurze Momente gesehen habe, würde ich glauben, dass sie sein wird, wie man sie sich in St. Petersburg wünscht.“49 Ein paar Tage später fügt er hinzu: „Die junge Württemberg ist sehr gut erzogen; ich glaube, dass, wenn sie dort nicht gefällt, man Mühe haben wird, eine bessere zu finden. Ihre Eltern hungern nach Pensionen, sie sind in einer sehr beengten Lage; ich bitte Sie, mir zu sagen, was man für sie tun kann, damit ich sie mit einer angenehmen Perspektive tröste.“50
Dann war der große Tag endlich gekommen, Sonntag, der 21. Juli 1776. „Vormittags besieht der König die zu Ehren des erwarteten Großfürsten Paul Petrowitsch von Russland am Bernauer Thore, an der Königs- und an der langen Brücke errichteten Ehrenpforten, desgleichen die neu erbauten Häuser in der Königsstraße“, hält Karl Heinrich Rödenbeck in seinem „Geschichtskalender“ fest. „Abends empfängt er mit der Königin und dem ganzen Hof auf dem Schlosse den um 7 Uhr in Begleitung des Prinzen Heinrich ankommenden Großfürsten von Russland, welcher seinen Einzug in die Stadt unter Paradirung des Militärs, der Schützengilde, der Kaufmannschaft, der Gewerke etc. und einer großen Menge Volks gehalten hatte.“51
Paul und Heinrich hatten in einem silberverzierten, achtspännigen Galawagen gesessen, Kanonen und Glockengeläut aller Kirchen hatten den Zug begleitet. In der Königsstraße kostete ein Fensterplatz 20 Écus, und selbst Ausländer waren in Scharen nach Berlin gekommen, um mit eigenen Augen zu sehen, ob es wirklich der Großfürst war, der Berlin besuchte. Der König kam seinem Gast bis vor seine Räume entgegen, und Heinrich stellte ihm den Großfürsten vor. „Sire“, sagte Paul, „die Beweggründe, welche mich von dem äußersten Norden bis in diese glücklichen Gegenden führen, sind das Verlangen, Sie der Freundschaft zu versichern, welche für immer Russland und Preußen vereinigen soll, und die Sehnsucht, eine Prinzessin zu sehen, welche auf den Thron der Moskowiter zu steigen bestimmt ist. Indem ich sie aus Ihren Händen empfange, wage ich es, Ihnen zu versprechen, dass diese Fürstin mir und der Nation, über welche sie regieren wird, um so teurer ist. Endlich erlange ich, was ich so lange gewünscht habe: ich kann den größten Helden, die Bewunderung unseres Jahrhunderts und das Staunen der Nachwelt, betrachten.“52 Darauf erwiderte Friedrich: „Ich verdiene so große Lobeserhebungen nicht, mein Prinz; Sie sehen in mir nur einen alten kränklichen Mann mit weißen Haaren; aber glauben Sie, dass ich mich schon glücklich schätze, in diesen Mauern den würdigen Erben eines mächtigen Reiches, den einzigen Sohn meiner besten Freundin, der großen Katharina, zu empfangen.“53 Der Alte Fritz fand eben immer die passenden Worte. Paul war hingerissen.
Noch am selben Abend sahen sich der Großfürst und die Prinzessin bei einem Abendessen der Königin Elisabeth Christine zum ersten Mal. Sie waren ein auffälliges Kontrastpaar. Mit ihren 1.70 Meter war Dorothea für ihre Zeit ungewöhnlich groß und deutlich größer als Paul. Das ungezwungene Leben an der frischen Luft in Treptow und Étupes, das Spiel mit den Geschwistern im Freien, die Spaziergänge und Ausfahrten mit den Eltern – all das hatte sie zu einer kräftigen, gesunden, jungen Frau heranwachsen lassen, die dem Schönheitsideal der Zeit entsprach. Und sie ruhte in sich.
Hingegen war Paul sehr schlank, eher mager und von zarter Natur. Seit frühester Kindheit von Ammen und Kinderfrauen verhätschelt und behütet, hätte er sich nie im Leben selbst Kirschen pflücken dürfen, wie Dortel es so gern getan hatte.54 Er kränkelte leicht und wirkte unsicher und gehemmt. Chevalier de Corberon, der französische Geschäftsträger in St. Petersburg, fand sogar, der Großfürst habe etwas Infantiles an sich und benehme sich „wie ein junger Mann, der gern dem Rat seines Tanzlehrers folgt“.55 Doch er war außerordentlich höflich, galant und zuvorkommend und hatte gute Manieren. Von seinen negativen Zügen, seiner nervösen Empfindlichkeit, seiner Reizbarkeit und Heftigkeit war in Berlin (noch) nichts zu merken.
Sie gefielen einander sofort. „Ich fand meine Braut genauso, wie ich sie mir in Gedanken nur wünschen konnte: hübsch, groß, gut gebaut und natürlich. Sie antwortet klug und geschickt“, schreibt Paul seiner Mutter gleich nach der ersten Begegnung. „Und ich weiß schon, dass sie – da sie in meinem Herzen gewirkt hat – ihrerseits auch etwas gefühlt hat. Ich bin so glücklich […] Der Vater und die Mutter sind gar nicht so, wie man sie geschildert hat; ersterer hinkt nicht, und letztere zeigt noch Spuren von Anmut und sogar von Schönheit.“56 Aber sie wirkten arm, und schnell bat Paul seine Mutter um Erlaubnis, ihren Söhnen finanziell helfen zu dürfen.
Montag trafen sich die beiden zum zweiten Mal, wiederum während eines Diners bei der Königin. Dienstag verteilte Heinrich die mitgebrachten Briefe, bat als Bevollmächtigter der Kaiserin von Russland in aller Form um die Hand der Prinzessin von Württemberg und erlangte das Jawort der Eltern. Dazu heißt es in Rödenbecks „Geschichtskalender“ unter dem 23. Juli 1776: „Auf dem Königl. Schlosse geschieht in Gegenwart des Königs, der Königin und des ganzen Hofes etc. die feierliche Verlobung des Großfürsten mit der Prinzessin Sophie Dorothee Louise, der Tochter des Herzogs Friedrich Eugen von Würtemberg. Alsdann große Cour, beim König Tafel, wo vom goldenen Service gespeis’t wird. Abends Ball paré.“57 An diesem Dienstag erhielt Friedrich Eugen den russischen St. Andreas-Orden mit Brillanten, während seine Frau und Dorothea den St. Katharinen-Orden bekamen. „Frau Kusine, indem Sie die Insignien des Ordens der Hl. Katharina erhalten, die ich Eurer Durchlaucht schicke, werden Sie, Madame, die Zeichen der Liebe und des Vaterlandes tragen“, schreibt Katharina II. ihrer künftigen Schwiegertochter protokollgerecht. „Das sagt Ihnen, Durchlaucht, durch mich Russland, das Ihnen seine Arme reicht. Von Ihrer schönen Seele und Ihrer Herzensgüte erwartet es, dass Sie, indem Sie das Vaterland wechseln, dem neuen Vaterland, das Sie adoptiert, nachdem es Sie bevorzugt ausgewählt hat, die Gefühle lebendiger und tiefer Anhänglichkeit entgegenbringen. Frau Kusine, Eurer Durchlaucht gute Kusine Katharina. Zarskoje Selo, 11. Juni 1776.“58 Sie könne den Augenblick nicht erwarten, antwortet Dorothea überwältigt, in dem sie sich Ihrer Majestät zu Füßen werfen und das Glück haben werde, ihre unendliche Dankbarkeit auch mündlich zum Ausdruck zu bringen.
Am 24. Juli war Ruhetag, und Paul schreibt seiner Mutter: „Sie haben mir eine Frau gewünscht, die uns Freude bereitet und häusliche Ruhe und ein glückliches Leben garantiert. Ich habe meine Wahl getroffen. […] Was ihr Äußeres angeht, so kann ich sagen, dass ich mich meiner Wahl vor Ihnen nicht schäme. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, weil ich vielleicht voreingenommen bin, aber die Meinung ist allgemein. Was ihr Herz angeht, so hat sie ein ganz und gar empfindsames und zärtliches Herz, was ich bei verschiedenen Szenen zwischen ihr und ihrer Verwandtschaft gesehen habe. Ihren soliden Verstand hat auch der König selbst bemerkt, weil er ein Gespräch mit ihr über ihre Pflichten hatte, über das er mich informiert hat. Sie lässt keine Gelegenheit aus, um von ihren Pflichten Eurer Majestät gegenüber zu sprechen. Sie ist voller Kenntnisse, und was mich gestern sehr erstaunt hat, war ein Gespräch mit mir über Geometrie, in dem sie sagte, dass diese Wissenschaft nötig sei, um zu lernen, grundsätzlich zu urteilen. Sie ist ganz einfach im Umgang, mag gern zu Hause sein und sich im Lesen oder im Musizieren üben, und sie brennt darauf, Russisch zu lernen, weil sie weiß, wie notwendig das ist, und weil sie sich an das Beispiel ihrer Vorgängerin erinnert.“59 Die Verlobungsfeiern dauerten zwei Wochen, die Berliner Zeitungen waren voller Details, und auch die europäische Presse berichtete ausführlich. Für jeden Tag hatte der König sich etwas Neues ausgedacht: Illuminiertes Potsdam mit den Namenszügen „Katharina“ und „Paul“ zur Begrüßung, Bälle, Konzerte, Theateraufführungen, Ausfahrten während des gesamten Aufenthalts der hohen Gäste. Doch auf Wunsch der Kaiserin durfte Paul wegen seiner überspannten Leidenschaft fürs Militär weder einer Parade noch einem Manöver beiwohnen, obwohl sie ihn schon als Achtjährigen zum General-Admiral ihrer Flotte ernannt hatte.
„Der Prinz Ferdinand giebt dem Großfürsten im Thiergarten, an dem Ufer der Spree, im Freien, zwischen Bellevue und den Zelten, ein Dejeuné, wobei sich der ganze Hof und die fremden Herrschaften befanden“, hält Rödenbeck unter dem 25. Juli fest.60 Der Platz, auf dem das Frühstück stattfand, erhielt den Namen „Großfürstenplatz“, und so heißt die kleine halbkreisförmige Anlage auch heute noch. Die Braut war also sehr beschäftigt, fand aber doch Zeit für einen BriefIV an Lanele:
„Berlin, den 26. Juli 1776
Meine allerliebste Freundin, ich bin zufrieden, sogar mehr als zufrieden. Meine liebe Freundin, nie hätte ich es mehr sein können; der Großfürst ist so liebenswürdig wie nur möglich, er vereinigt alle guten Eigenschaften in sich; er ist am 21. angekommen, und am 23. hat Prinz Heinrich den Antrag gemacht. Ich habe den Vortritt vor allen Prinzessinnen und Kaiserlichen Hoheiten gehabt. Ich wage mir zu schmeicheln, von meinem lieben Versprochenen sehr geliebt zu werden, was mich sehr, sehr glücklich macht. Mehr kann ich Ihnen darüber nicht sagen; der Kurier, den mein verehrungswürdiger Papá nach Stuttgart schickt, geht in diesem Augenblick ab, und ich gebe ihm diesen Brief mit, damit er ihn in Kassel auf die Post gibt. Adieu, liebe Freundin; ich bin mit Herz und Seele Ihre treue und zärtliche Freundin Dorothée.“61
Am 27. Juli war große Gratulationscour bei den Verlobten. Eine Woche später meldet James Harris nach London: „Der Großfürst scheint leidenschaftlich in seine zukünftige Großfürstin verliebt zu sein. Ihre Person ist, obwohl eher üppig, weit davon entfernt, nicht zu gefallen, und große Mühen sind auf ihre Bildung verwendet worden. Nichts kommt ihrer und des ganzen Hauses Württemberg Freude über dieses Ereignis gleich.“62 Am 4. August war großes Abschiedsdiner bei der Königin, zum Abschiedsempfang des Großfürsten kamen der Generalstab, die Minister und das diplomatische Corps.
Paul verließ Berlin am 5. August. Dieser liebenswürdige Fürst habe die Erwartungen aller übertroffen, die das Glück hatten, sich ihm zu nähern, berichtet Friedrich der Kaiserin „ohne Übertreibung“.63 Der Großfürst habe alle Herzen gewonnen, schreibt er der Kurfürstin Maria-Antonia von Sachsen.64 Paul sei der würdige Sohn seiner erhabenen Mutter, teilt er Voltaire mit.65 „Nicht verhehlen aber dürfen wir, wie die Menschenkenner über den Charakter des jungen Großfürsten urteilten“, schreibt er jedoch in seiner Altersgeschichte: „Er zeigte sich stolz, hochmütig und heftig, und so fürchteten alle, die die russischen Verhältnisse kennen, er werde Mühe haben, sich auf dem Thron zu behaupten oder als Herrscher eines harten und wilden Volkes, das durch die milde Regierung mehrerer Kaiserinnen verwöhnt war, ein ähnliches Schicksal erleiden wie sein Vater.“66
Prophetische Worte. Der Alte Fritz war eben ein guter Menschenkenner. Aber er war zufrieden. Katharina II. war ihm zu Dank verpflichtet, das „Nordische System“ war gestärkt, und Wien und Paris ärgerten sich. „Es ist ganz sicher, Madame, dass die Feinde des Friedens in Europa die gefährlichsten Ränke geschmiedet hatten“, erklärt er der Königinwitwe Juliane Marie von Dänemark, das zum „Nordischen System“ gehörte. „Ich schulde nur den wachsamen Bemühungen meines Bruders, ihre abscheulichen Pläne vereitelt zu haben. Der Bund, der soeben geschlossen wurde, ist eine Folge davon, und ich hoffe, dass diese neue Ehe besser gelingt als die vorherige. Ich habe natürlich mit dieser jungen Person gesprochen, ich habe es sogar in Gegenwart des Großfürsten getan, Madame, damit er Augenzeuge meiner Ratschläge wäre und sich daran erinnern könnte. Aber es war nicht möglich, jemanden in die Nähe dieser jungen Person zu platzieren, der ihr mit seinem Rat beistehen könnte. Sie wird sehr geschätzt, sie ist ziemlich vorsichtig; aber ihr zartes Alter lässt mich um sie zittern; denn als Neuling in der Manege der Höfe kennt sie deren Arglist und Tücke nicht. Wenn die ersten Jahre geschafft sind, glaube ich, dass es nichts mehr zu befürchten gibt.“67 Natürlich war mit diesem „Berater“ nicht die „Vertrauensdame“ für die Prinzessin gemeint, um die der König die Kaiserin gebeten hatte, sondern jemand, über den er politischen Einfluss auf sie nehmen konnte.
Mit seiner Großnichte selbst hatte er vorsichtshalber eine Geheimkorrespondenz vereinbart, die über Graf Solms laufen würde, falls sie am russischen Hof Schwierigkeiten bekäme. Im September schreibt er Heinrich „unter Brüdern“ nach Rheinsberg, Katharinas neue Schwiegertochter sei „doppelt so viel wert wie die vorherige“.68 Und Paul war wieder glücklich. Für ihn war namentlich Friedrich II., nicht etwa seine Mutter, das „Modell eines Souveräns“ schlechthin, und die Heirat mit einer Großnichte des Preußenkönigs hatte ihn nun auch noch zum Verwandten seines Idols gemacht! Mehr noch: Die Ehren und die Aufmerksamkeiten, die ihm in Berlin erwiesen worden waren, hatten ihn einmal mehr in seiner Überzeugung bestärkt, dass er der rechtmäßige Erbe des russischen Thrones und eigentliche Imperator war. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er die Anerkennung und die Achtung erfahren, die ihm gebührten und die ihm zu Hause vorenthalten wurden.69 In Russland war er noch nie so behandelt worden. Seine Sympathie für Preußen und dessen Militär sowie für die „Ordnung, Pünktlichkeit und Genauigkeit“, die er dort „überall“ bewundert hatte, war noch gewachsen, und das sprach sich in St. Petersburg schnell herum.70 Den Alten Fritz ahmte er nun sogar in Kleidung, Gang und Haltung zu Pferde nach.
Doch taugte das Modell für Russland? Katharina missbilligte die preußischen Neigungen ihres Sohnes und nahm ihm seine Verehrung für den König übel.
I In Wien lernte Rasumowskij, der selbst gut Geige spielte und ein bedeutender Musikmäzen und Kunstsammler wurde, Haydn und Mozart kennen. Letzteren lud er vergeblich nach St. Petersburg ein. Er war auch mit Beethoven befreundet, der für ihn drei Streichquartette (Rasumowsky-Quartette) komponierte und ihm die 5. und 7. Sinfonie widmete.
II Gemeint ist russisch-orthodox.
III Gemeint ist: mit einer Russisch-Orthodoxen.
IV Im Laufe der Jahre hat Henriette d’Oberkirch Hunderte Briefe von der Freundin erhalten, aber nur solche in ihre „Memoiren“ aufgenommen, in denen Marias Leben in St. Petersburg glänzend und problemlos erscheint. Ihre Nachkommen haben die Briefe 1913 dem russischen Kaiserhaus übergeben. Sie gelten als verschollen.