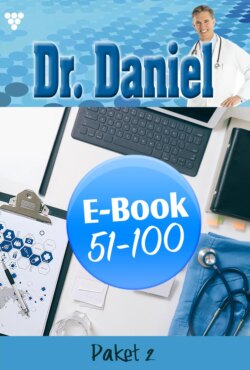Читать книгу Dr. Daniel Paket 2 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSophie Wieland stand wie versteinert. Sie hatte das Gefühl zu träumen, doch es war kein angenehmer Traum – ganz im Gegenteil. Es war ein Alptraum, wie sie noch keinen schlimmeren erlebt hatte. Überdeutlich war sie sich des Rings bewußt, den Peter ihr gestern geschenkt hatte. Ein sündhaft teures, diamantenbesetztesSchmuckstück, über das sie sich riesig gefreut hatte und das ihr jetzt den Finger abzuschnüren schien.
Wie in Trance überquerte Sophie die Straße und ging dann direkt auf Peter zu. Im selben Moment drehte er sich um, und seine Augen weiteten sich vor Schreck. Mit einem flehenden Blick bedeutete er ihr weiterzugehen… ihn nicht anzusprechen, doch Sophie ließ sich von dem eingeschlagenen Weg nicht abbringen. Dann blieb sie stehen. Ihre Kehle schien wie zugeschnürt zu sein.
»Hallo, Peter«, grüßte sie und fragte sich, wie ihre Stimme so normal klingen konnte.
Unwillkürlich ließ Peter den Arm, den er so vertraut um die Schultern seiner Begleiterin gelegt hatte, sinken.
»Sophie«, erwiderte er nur, und seine Stimme klang gepreßt, dann brachte er ein schiefes Lächeln zustande, das seine Unsicherheit vertuschen sollte. »Ich glaube, ihr kennt euch noch nicht. Monika, das ist Sophie Wieland… eine der tüchtigsten Krankenschwestern, die wir an der Klinik haben.« Er zögerte, dann fuhr er leise fort: »Sophie – meine Frau Monika.«
Sophie schwankte wie unter einem Schlag. Sie hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, daß Peter verheiratet wäre. Irgendwie schaffte sie es, die Hand auszustrecken.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Sternberg«, zwang sie sich zu sagen, dann bedachte sie Peter mit einem Blick, der ihn zurückweichen ließ, bevor sie sich Monika wieder zuwandte. »Peter hat mir schon viel von Ihnen vorgeschwärmt.«
Das freundliche Lächeln der sympathischen Frau verwandelte sich in ein glückliches Strahlen.
»Das freut mich zu hören«, meinte sie. »Peter ist normalerweise sehr zurückhaltend, wenn es um sein Privatleben geht. Gerade mich und unsere beiden Kinder hütet er wie ein kostbares Kleinod.«
Peter wollte diesem für ihn äußerst unangenehmen Gespräch entkommen.
»Liebling, ich glaube, wir müssen weiter«, erklärte er mit einem Blick auf die Uhr, dann sah er Sophie mit gespieltem Bedauern an. »Du entschuldigst uns«, er schwieg einen Mo-ment, ehe er hinzufügte: »Wir sehen uns ja morgen in der Klinik.«
»Ja, wahrscheinlich«, meinte Sophie, verabschiedete sich von Monika und drehte sich um. Mit stockenden, unsicheren Schritten ging sie ein paar Meter, dann blieb sie stehen, streifte den wertvollen Ring ab und ließ ihn achtlos zu Boden fallen. Doch das genügte nicht, um ih-re Sicherheit wiederzugewinnen. Wie unter einem Zwang drehte sie sich um und fing Peters Blick auf, der in diesem Moment ebenfalls zurückblickte.
Rasch senkte Sophie den Kopf, dann setzte sie ihren Weg fort. Dabei hatte sie das Gefühl, in Stücke zu zerbrechen.
*
Als Dr. Peter Sternberg am nächsten Morgen seinen Dienst antrat, führte ihn sein erster Weg zum Schwesternzimmer. Suchend blickte er sich um, doch Sophie konnte er nirgends entdecken.
»Corinna, schicken Sie Schwester Sophie in den Röntgenraum«, bat er die Oberschwester. »Ich brauche jemanden, der mir assistiert.«
»In Ordnung, Herr Doktor«, erklärte Corinna, dann sah sie dem davoneilenden Arzt spöttisch nach. »Für wie dumm hält der uns eigentlich?« Sie ahmte die Stimme des Arztes nach. »Ich brauche jemanden, der mir assistiert.« Dann schüttelte sie den Kopf. »Ich kann mir schon vorstellen, wobei Sophie ihm assistieren soll.«
Schwester Marianne zuckte die Schultern. »Wir sind doch alle auf ihn hereingefallen. Er sieht blendend aus, ist charmant und überaus diskret…«
»Solange es ihm zugute kommt«, vollendete Corinna voller Bitterkeit. Sie hatte es noch immer nicht verkraftet, daß Peter sie damals eiskalt hatte sitzenlassen, als Marianne eingestellt worden war. Doch der war es ein paar Monate später nicht besser ergangen.
»So einer dürfte überhaupt nicht frei herumlaufen«, knurrte sie ärgerlich.
Wieder zuckte Marianne die Schultern. »Liebe ist kein Verbrechen. Und verliebt haben wir uns in ihn.«
»Ja, und er hat uns der Reihe nach drangenommen – ich könnte mich noch heute…« Corinna stockte, als Sophie ins Zimmer trat.
»Dr. Sternberg erwartet dich im Röntgenraum. Du sollst ihm assistieren«, erklärte Marianne und konnte sich einen anzüglichen Ton nicht verkneifen.
Sophie zögerte, dann drehte sie sich ohne ein Wort um und verließ das Schwesternzimmer. Ihr Herz klopfte heftig, als sie dem Röntgenraum näherkam. Noch nie war sie sich ihrer Liebe zu Peter so bewußt gewesen wie in diesem Moment, doch
ihr Entschluß stand fest: Ein zweites Mal würde sie seinem Charme nicht erliegen.
Bei ihrem Eintreten fuhr Peter herum und funkelte sie wütend an.
»Was sollte das gestern?« brauste er auf.
Mit gespielter Gelassenheit hielt Sophie seinem Blick stand. »Du niederträchtiger Schuft.«
Für einen Augenblick war Peter sichtlich verwirrt. Noch niemals hatte es eine Frau gewagt, so mit ihm zu sprechen.
»Hör zu, meine Kleine«, begann er, und seine Stimme klang dabei leise und drohend.
»Ich bin nicht deine Kleine«, erwiderte Sophie und reckte den Kopf, um eine Sicherheit zu zeigen, die sie gar nicht besaß.
»Ich werde veranlassen, daß dir gekündigt wird – fristlos«, erklärte Peter kalt.
Lange sah Sophie ihn an und fragte sich, wo der zärtliche, liebevolle Mann war, den sie vor wenigen Wochen kennen und lieben gelernt hatte.
Jetzt zuckte sie die Schultern. »Wenn du glaubst, daß dein Einfluß so groß ist – bitte.« Dabei war sie nicht halb so gefaßt, wie sie sich gab. Die Aussicht, auf diese Art und Weise ihre Stellung zu verlieren, war alles andere als verlockend.
»Du legst es wirklich darauf an«, stellte Peter fast erstaunt fest. Er trat zu ihr und griff nach ihrer Hand. »Ich will gar nicht, daß dir gekündigt wird. Wir können den gestrigen Vorfall vergessen und…«
»Nein«, fiel sie ihm mit fester Stimme ins Wort. »Wenn ich auch nur geahnt hätte, daß du verheiratet bist, wäre zwischen uns nie etwas vorgefallen.«
Sehr von oben herab lächelte Peter sie an. »Das glaubst du doch selbst nicht, Sophie. Du warst ja ganz verrückt nach mir.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Ich habe dich geliebt, Peter. Das ist ein großer Unterschied, aber den wirst du nicht erkennen, weil du gar nicht weißt, was Liebe ist.«
Theatralisch verdrehte Peter die Augen. »Meine Güte, mach doch kein Drama aus der ganzen Sache. Du gefällst mir, wir beide können noch eine schöne Zeit haben, wenn du dich nicht wieder so unmöglich benimmst wie gestern. Mich einfach anzusprechen, wenn ich in Begleitung einer anderen Frau bin.« Er schüttelte den Kopf, als hätte Sophie etwas ganz Törichtes getan. »So etwas darfst du nicht wieder machen.«
Sie fühlte sich wie ein kleines Mädchen, das ausgeschimpft wird, und wäre nicht erstaunt gewesen, wenn Peter ihr einen strafenden Klaps gegeben hätte. Doch das tat er nicht – ganz im Gegenteil. Er streichelte ihre Hand so zärtlich wie nie zuvor, und Sophie fühlte, wie ihr Herz heftiger zu klopfen begann.
Plötzlich hielt Peter mitten in der Bewegung inne, runzelte die Stirn und warf einen Blick auf ihre Hand.
»Wo ist der Ring, den ich dir geschenkt habe?«
Mit unbewegtem Gesicht sah Sophie ihn an.
»Ich habe ihn verloren«, antwortete sie ohne Bedauern.
Aus weit aufgerissenen Augen starrte Peter sie an. »Wie bitte?! Der Ring hat fast fünftausend Mark gekostet!«
Sophie zuckte die Schultern. »Ich habe kein so kostbares Geschenk verlangt. Ich habe überhaupt nichts von dir verlangt. Ich habe dich geliebt und wünschte mir nur, von dir auch geliebt zu werden, doch dazu bist du nicht fähig.«
»Fängst du schon wieder damit an«, entgegnete Peter genervt, dann seufzte er. »Hast du ein Glück, daß ich nicht nachtragend bin. Wir werden einfach vergessen, was gestern geschehen ist…«
»Nein, Peter.« Zum zweiten Mal fiel sie ihm ins Wort, und natürlich bemerkte sie seinen Zorn. Er haßte es, wenn man ihn unterbrach. »Es ist aus.«
Peters Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Du willst mit mir Schluß machen? Du wagst es tatsächlich…« Er schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was er gerade gehört hatte. »Ich kann dich vernichten, Kleine.«
»Ich habe es dir vorhin schon gesagt – ich bin nicht deine Kleine«, erklärte Sophie, dann drehte sie sich um. »Du kannst tun, was du willst. Umstimmen wirst du mich jedenfalls nicht, denn ich habe meine Prinzipien. Ein verheirateter Mann ist für mich tabu.«
Damit verließ sie den Röntgenraum und schloß sehr nachdrücklich die Tür hinter sich. Peter kochte vor Wut. Er riß die Tür auf und lief Sophie nach, dann hielt er sie mit eisernem Griff fest.
»Das wird dich teuer zu stehen kommen«, prophezeite er. »Mit einem Peter Sternberg springt man nicht so herum. Auf Knien wirst du zu mir zurückkommen, das schwöre ich dir.«
*
Noch am selben Tag wurde Sophie zum Chefarzt gerufen, der gleichzeitig Direktor dieser kleinen, sehr exklusiven Privatklinik war.
»Schwester Sophie, mir sind da schlimme Sachen zu Ohren gekommen«, eröffnete er das Gespräch.
Offen sah Sophie ihn an. »Ich bin mir keiner Schuld bewußt, Herr Chefarzt.«
Der Chefarzt zögerte, als würde es ihm schwerfallen, die Anschuldigungen vorzubringen, die Peter ihm gegenüber geäu-ßert hatte.
»Es geht um die eine Woche, in der Sie angeblich krank waren«, fuhr er fort. »Dr. Sternberg behauptet, er hätte Sie während dieser Zeit in einem Tanzlokal gesehen, und zwar mehrmals.« Er senkte für einen Moment den Kopf, und wieder schien es, als würde es ihn Überwindung kosten weiterzusprechen. »Darüber hinaus behauptet Dr. Sternberg, Sie würden seine Autorität untergraben. Er sagt, Sie würden seine Anordnungen in Frage stellen – in Anwesenheit der Patienten.« Dr. Wegmann schwieg und sah sie erwartungsvoll an.
»Was soll ich darauf erwidern, Herr Chefarzt?« fragte Sophie so ruhig, wie es ihr in dieser Situation möglich war. »Wenn ich sage, daß das alles nicht stimmt, dann würde das bedeuten, daß Dr. Sternberg lügt. Damit stünde mein Wort gegen seines. Wem würden Sie in diesem Fall glauben?«
Dr. Wegmann seufzte.
»Ihnen. Wissen Sie, Schwester Sophie, ich bin nicht blind. Ich weiß recht gut, weshalb Dr. Sternberg Sie in Mißkredit bringen will, aber mir sind leider auch die Hände gebunden. Dr. Sternberg ist ein brillanter Arzt, und ich kann es mir nicht leisten, ihn zu verlieren. Genau das hat er aber angedeutet. Darüber hinaus lebt die Klinik mehr oder weniger von der Stiftung des alten Dr. Sternberg. Würde ich mich für Sie einsetzen und damit riskieren, daß Dr. Sternberg geht, dann würde ich damit der Klinik das Wasser abdrehen.«
Sophie nickte. »Ich verstehe.« Traurig senkte sie den Kopf. »Ich werde also meine Sachen zusammenpacken und gehen.«
Da schüttelte der Chefarzt den Kopf. »Das ist nicht nötig, Schwester Sophie. Ich werde Sie nicht fristlos entlassen, wie Dr. Sternberg es gefordert hat. Suchen Sie sich in Ruhe eine neue Stellung, auch ich muß mich nach einem möglichst gleichwertigen Ersatz für Sie umsehen, was nicht leicht sein wird.«
Ein kaum sichtbares Lächeln huschte bei diesem Lob über Sophies Gesicht.
»Danke, Herr Chefarzt«, erwiderte sie leise, dann blickte sie auf. »Ich bleibe noch so lange, bis Sie eine neue Krankenschwester gefunden haben.« Sie schwieg kurz, dann entschied sie sich für die Wahrheit. »Ich will mit Dr. Sternberg nicht länger zusammenarbeiten als unbedingt nötig.«
Dr. Wegmann nickte. »Dafür habe ich Verständnis.« Er reichte Sophie die Hand. »Ich war mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden, und ich würde Sie nicht gehen lassen, wenn ich eine andere Wahl hätte. Ihre Beurteilung durch mich wird dementsprechend ausfallen. Sie werden keine Schwierigkeiten haben, eine neue Stellung zu finden.«
*
Horst Wieland war entsetzt, als er hörte, daß man seiner Tochter gekündigt hatte.
»Das lassen wir uns nicht gefallen!« wetterte er. »Dieser Sternberg wird mit seinen Verleumdungen nicht weit kommen! Wenn du…«
»Papa, das hat doch keinen Sinn«, fiel Sophie ihm niedergeschlagen ins Wort. »Dr. Wegmann ist auf Peter angewiesen – finanziell und medizinisch. Wenn Peter mit mir nicht mehr arbeiten will, dann verzichtet der Chefarzt natürlich lieber auf mich als auf ihn. Er würde die Zukunft der Klinik riskieren, das kann ihm keine Krankenschwester wert sein.« Sie senkte den Kopf. »Außerdem will ich mit Peter gar nicht mehr zusammenarbeiten.«
Horst Wieland seufzte und schüttelte mißbilligend den Kopf. »Sophie, du bist im Recht! Und ich als Anwalt kann dir dabei helfen, dieses Recht durchzusetzen. Wegmann kann dir nicht kündigen!«
»Papa, bitte«, wehrte Sophie ab. »Ich möchte nicht, daß du etwas in dieser Richtung unternimmst. Dr. Wegmann wird mir ein gutes Zeugnis schreiben. Damit komme ich schnell wieder irgendwo unter.«
»Aber nicht in einer Privatklinik, die auf dem Standard der Wegmann-Klinik steht.« Horst schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Du bist genauso verbohrt wie Erika! Sie hat damals auch eine beispielhafte Karriere in Amerika sausen lassen, nur weil sie sich in diesen Wolfgang Metzler verliebt hatte und er ihre Gefühle nicht erwiderte.«
Sophie lächelte. »Es hat sich für sie aber gelohnt. Immerhin ist Tante Erika jetzt mit Onkel Wolfgang verheiratet, und sie haben einen ganz süßen kleinen Jungen.«
Horst winkte ab. »Meine Schwester könnte an einer namhaften Klinik arbeiten, statt dessen spielt sie Hausfrau und Mutter und arbeitet stundenweise an dieser Wald- und Wiesenklinik in Steinhausen.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Steinhausen! Das sprichwörtliche Ende der Welt.«
Sinnend blickte Sophie vor sich hin. »Dort würde ich jetzt gern sein.«
»Kommt überhaupt nicht in Frage«, wehrte ihr Vater entschieden ab. »Wir werden uns sofort um eine gleichwertige Stellung für dich umsehen.« Nachdenklich runzelte er die Stirn. »Es muß ja nicht unbedingt hier in Würzburg sein. Soviel ich weiß, gibt es in Düsseldorf eine Privatklinik, die der Wegmann-Klinik in nichts nachsteht.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht unbedingt an eine Privatklinik. Wichtig ist doch nur, kranken Menschen zu helfen, das kann ich an jeder anderen Klinik auch.« Dabei hatte sich in ihrem Kopf schon ein ganz konkreter Plan festgesetzt, doch davon durfte sie ihrem Vater jetzt noch nichts sagen. Er würde sich sonst zu sehr erregen.
Allerdings kannte Horst Wieland seine Tochter gut genug, um ihre Gedankengänge nachzuvollziehen.
»Wenn du daran denkst, in dieses Steinhausen zu gehen, dann schlag dir das sofort aus dem Kopf«, erklärte er mit Nachdruck. »Ich lasse nicht zu, daß sich meine Tochter auch noch in der Einöde vergräbt.« Er überlegte kurz. »Ich werde sofort mit der Klinik in Düsseldorf telefonieren. Es wäre doch gelacht, wenn wir dich da nicht unterbringen würden.«
»Papa, ich bin fünfundzwanzig!« meldete Sophie Protest an. »Ich kann ganz gut meine eigenen Entscheidungen treffen.« Sie zögerte einen Moment, dann fuhr sie fort: »Ich werde nach Steinhausen zu Tante Erika gehen – vielleicht nicht für immer, aber zumindest so lange, bis ich die Sache mit Peter einigermaßen verwunden habe.«
*
Es war ein ungewöhnlich ruhiger Vormittag in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Robert Daniel und seiner Frau Manon, aber sie waren beide froh dar-über. Auf diese Weise konnten sie Sachen aufarbeiten, die in den stressigen Tagen zuvor liegengeblieben waren.
»Hast du noch viel zu tun, Robert?« wollte Manon wissen, als sie kurz in sein Sprechzimmer herüberkam.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin fast fertig. Allerdings erwarte ich noch eine Patientin, und ich schätze, das Gespräch mit ihr wird ein bißchen länger dauern.«
»Schade«, meinte Manon. »Sonst hätten wir Tessa gemeinsam vom Kindergarten abholen können.«
Bei dem Gedanken an sein temperamentvolles, fünfjähriges Adoptivtöchterchen huschte ein zärtliches Lächeln über Dr. Daniels Gesicht.
»Sie wird überglücklich sein, wenn sie einmal von ihrer Mama abgeholt wird, anstatt immer nur von Tante Irene«, vermutete er.
»Tessa liebt deine Schwester heiß und innig«, entgegnete Manon. »Und im übrigen bist ohnehin du ihr absoluter Favorit.« Sie küßte ihren Mann. »Aber wenn du arbeiten mußt, dann wird Tessa wohl auch mit mir vorliebnehmen.«
»Ganz bestimmt.« Dr. Daniel warf einen Blick auf die Uhr. »So wie es bis jetzt aussieht, werde ich sicher pünktlich zum Mittagessen oben sein, und wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, kann ich mit Tessa sogar noch für eine Stunde zum Spielplatz gehen, bevor die Nachmittagssprechstunde beginnt.«
Manon lächelte. »Damit wird ihre kleine Welt wieder in Ordnung sein.« Sie küßte Dr. Daniel noch einmal. »Also, dann gehe ich jetzt. In einer Viertelstunde bin ich wieder im Haus – für den Fall, daß sich doch noch Patienten einfinden sollten. Fräulein Sarina und Fräulein Meindl wissen aber Bescheid.«
Dr. Daniel sah seiner Frau nach, dann stand er auf und trat zum Fenster. Von hier aus konnte er Manon noch sehen, bis sie um die erste Wegbiegung verschwand. Dabei wurde ihm wieder einmal bewußt, wie glücklich er war, seit er mit Manon verheiratet war. Er hatte so lange unter dem Tod seiner ersten Frau gelitten, doch mit Manon war das Glück wieder bei ihm eingekehrt, und die kleine Tessa war die Krönung dieses Glücks, wobei Dr. Daniel froh war, daß auch Stefan und Karina, seine beiden Kinder aus erster Ehe, das kleine Mädchen richtig liebgewonnen hatten. Nun ja, im Grunde gingen die beiden schon ihre eigenen Wege, wenn sie auch weiterhin hier in der Villa wohnten. Karina studierte in München Medizin, Stefan absolvierte in der Steinhausener Waldsee-Klinik gerade seine Assistenzzeit. Dr. Daniel war sehr stolz auf seine Kinder.
»Frau Rauh ist gerade gekommen.«
Die Stimme seiner Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau riß ihn aus seinen Gedanken.
»Schicken Sie sie bitte herein, Fräulein Sarina«, meinte er, während er zu seinem Schreibtisch zurückkehrte.
Als die hübsche junge Frau eintrat, ging er ihr mit einem freundlichen Lächeln entgegen und reichte ihr die Hand.
»Guten Tag, Frau Rauh«, grüßte er. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
Gerda kam seiner Aufforderung nach, dann spielte sie ein wenig nervös mit dem Riemen ihrer Handtasche.
»Sie können sich bestimmt denken, weshalb ich hier bin«, begann sie schließlich.
Dr. Daniel nickte. »Sie haben sich für diesen Termin einen gu-ten Tag ausgesucht. Normalerweise geht es bei mir in der Praxis sehr viel hektischer zu.«
»Ich weiß«, meinte Gerda und wurde dabei merklich ruhiger. »Ich war schon ganz erstaunt, weil ich nicht warten mußte.«
»Ich war von diesem ruhigen Vormittag selbst überrascht«, gab Dr. Daniel zu. »Allerdings bin ich ganz froh darüber, denn nun können wir uns für das Gespräch viel Zeit lassen.«
Gerda nickte.
»Sie kennen meinen Fall ja am allerbesten«, erklärte sie. »Immerhin haben Sie die Operation bei mir vorgenommen. Und auch das Untersuchungsergebnis meines Mannes ist Ihnen bekannt.«
»Ja, Frau Rauh. Sie und Ihr Mann wünschen sich Kinder, aber es wird für Sie nicht ganz einfach sein, schwanger zu werden. Unglücklicherweise verfügt Ihr Mann nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen nur über einen sehr geringen Anteil an Samenfäden. Überdies war ich gezwungen, bei Ihnen aufgrund der geplatzten Eierstockzyste den linken Eileiter zu entfernen. Wie ich Ihnen bereits vor einem halben Jahr gesagt habe, war dieser Eingriff dringend nötig, um Ihr Leben zu retten.«
Niedergeschlagen blickte Gerda auf ihre Hände, die noch immer ein wenig zitterten. Sie hatte Angst, Dr. Daniel könnte nun doch sagen, daß sie niemals schwanger werden würde.
»Seien Sie ehrlich, Herr Doktor, werden Ferdinand und ich ein eigenes Kind haben?« fragte Gerda, obwohl sie nicht sicher war, ob sie die Antwort überhaupt hören wollte.
»Ja, ich denke schon, daß es möglich sein wird«, meinte Dr. Daniel, dann stand er auf und kam um seinen Schreibtisch herum. Tröstend legte er eine Hand auf ihren Arm. »Ich weiß, wie belastend es für eine Ehe ist, wenn man eine Kinderwunschbehandlung über sich ergehen lassen muß. Während meiner langjährigen Tätigkeit als Gynäkologe habe ich schon ziemlich viel mitbekommen, und auch in meinem engsten Freundeskreis kam es in diesem Zusammenhang zu sehr schweren Ehekrisen.« Dabei dachte er besonders an seinen besten Freund Dr. Georg Sommer und dessen Frau Margit, die sich jahrelang vergeblich um ein eigenes Kind bemüht hatten. Mittlerweile hatten sie durch Dr. Daniels Vermittlung zwar ein kleines Mädchen adoptiert, und sie liebten Birgit auch wie ihr eigenes Kind, doch Dr. Daniel wurde den Verdacht nicht los, daß gerade Margit das Gefühl, schwanger zu sein und ein Baby zur Welt zu bringen, sehr vermiß-
te.
»Heißt das, wir sollen es lieber gar nicht erst versuchen?« wollte Gerda wissen und riß Dr. Daniel damit aus seinen Gedanken.
»Nein, das wollte ich keinesfalls sagen«, verwahrte sich der Arzt. »Sie sollten sich nur beide einig sein, wie weit Sie gehen wollen und wie lange Ihre Ehe der Belastung standhalten wird.« Er schwieg kurz. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Rauh. ich will Sie mit meinen Worten keineswegs entmutigen – ganz im Gegenteil. Sie müssen nur wissen, was auf Sie zukommen kann, damit es für sie kein Sprung ins kalte Wasser wird. Die Medizin hat mittlerweile viele Wege für ein Wunschkind gefunden, aber nicht alles, was möglich ist, wird das betroffene Ehepaar akzeptieren. Heutzutage kann ein Kind im Reagenzglas gezeugt werden, aber nur Sie allein können entscheiden, wo genau der medizinische Fortschritt Ihnen zu weit geht.«
Gerda nickte. »Ich verstehe schon, was Sie meinen, Herr Doktor. Ferdinand und ich haben uns in den vergangenen Monaten auch eingehend dar-über unterhalten, und wenn die nötigen Untersuchungen bei mir abgeschlossen sind, werden wir gemeinsam beschließen, was wir auf uns nehmen wollen und was nicht.« Sie zögerte, dann meinte sie: »Nur eines weiß ich jetzt schon ganz sicher: Ich möchte dieses Kind von meinem Mann.«
Dr. Daniel verstand. Eine künstliche Befruchtung mit einem Spendersamen kam für Gerda offensichtlich nicht in Frage.
»Gut, Frau Rauh«, meinte er, dann blätterte er in den Akten. »Einige der nötigen Untersuchungen haben wir im Laufe der vergangenen Monate ja schon durchgeführt. Ich werde heute mit Ultraschall überprüfen, ob Ihr verbliebener rechter Eileiter durchlässig ist, doch davon gehe ich eigentlich aus. Die Operation liegt mittlerweile zwar schon mehr als ein halbes Jahr zurück, aber damals waren keine Verwachsungen oder Verklebungen auszumachen, und ich denke auch nicht, daß sich das inzwischen geändert hat. Sollte sich auf Ultraschall ein zweifelhaf-ter Befund ergeben, müßte ich auf eine Hysterosalpingografie zurückgreifen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit dieser Untersuchung so lange gewartet habe. Immerhin hatten Sie damals eine Operation hinter sich, da hätte ich einen derartigen Eingriff nicht veranworten können.« Er stand auf. »Gehen wir mal nach nebenan.«
Gerda erhob sich ebenfalls. Sie war inzwischen schon einige Male in der Praxis gewesen und kannte sich hier aus. Ein wenig zögernd folgte sie Dr. Daniel in das Untersuchungszimmer und trat dann hinter den dezent gemusterten Wandschirm, um sich freizumachen. Doch als sie sich auf den gynäkologischen Stuhl legen wollte, hielt Dr. Daniel sie zurück.
»Ich muß den Ultraschall von unten machen«, erklärte er. »Für diese Art der Untersuchung ist es besser, wenn Sie sich auf die Liege legen. Die Untersuchung verursacht ein etwas unangenehmes Gefühl. aber wenn Sie sich dabei entspannen können, ist es gleich vorbei.«
Dr. Daniel schaltete den Bildschirm ein und griff nach dem speziellen Ultraschallkopf, der für die transvaginale Sonografie verwendet wurde.
»Nicht erschrecken, Frau Rauh«, meinte er. »Im ersten Moment fühlt sich das ein bißchen kalt an, aber es wird nicht weh tun.«
Gerda versuchte das unbehagliche Gefühl, das die Ultraschalluntersuchung verursachte, zu vergessen und verfolgte die grauen Schatten auf dem Bildschirm, doch da sie das, was sie sah, nicht deuten konnte, bekam sie nun erst recht Angst.
Dr. Daniel schien zu spüren, was in ihr vorging, denn er lä-chelte sie beruhigend an.
»Es ist alles in Ordnung«, erklärte er, während er den Schallkopf wieder entfernte, dann reichte er ihr ein paar Papiertücher. »Damit können Sie sich abwischen. Anschließend kleiden Sie sich bitte an und kommen wieder zu mir ins Sprechzimmer.«
Nur zu gern kam Gerda dieser Aufforderung nach.
»Wie ich schon vermutet habe, ist der Eileiter durchlässig«, erklärte Dr. Daniel, als Gerda ihm wieder gegenübersaß. »Die Probleme liegen tatsächlich an Ihrem unregelmäßigen Eisprung und dem sehr geringen Anteil an Samenfäden, über die Ihr Mann verfügt.«
»Und was werden Sie jetzt tun?« wollte Gerda wissen.
»Fürs erste werde ich Ihnen ein Medikament verschreiben, das sicher einen Eisprung auslöst«, meinte Dr. Daniel. »Sie und Ihr Mann können es dann auf die herkömmliche Art versuchen. Ansonsten haben wir die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung. Auch dabei würde bei Ihnen mit Hilfe entsprechender Medikamente ein Eisprung ausgelöst, der Samen würde dann aber mit Hilfe einer speziellen Spritze in die Gebärmutter eingebracht.«
Gerda fühlte, wie ihr ein Schauer über den Rücken rann. »Das klingt aber ziemlich unangenehm.«
»Ich will ganz offen sein, Frau Rauh – es ist wirklich nicht angenehmen, und in Ihrem Fall ist es vielleicht auch nicht zwingend nötig. Sie sind noch sehr jung, haben also Zeit. Versuchen Sie erst mal, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Durch die Medikamente wird der Eisprung für Sie möglicherweise mit Bauchschmerzen verbunden sein, die den normalen Regelbeschwerden ähnlich sein werden.« Er schwieg einen Moment. »Während dieser Zeit, möglichst sogar schon ein paar Tage vorher, sollten Sie mit Ihrem Mann möglichst oft intim sein.« Er lächelte entschuldigend. »Ich weiß schon, wie sich das anhört.«
Auch Gerda mußte lächeln. »Mit Lust und Liebe hat das nun nicht mehr viel zu tun, aber darauf haben Ferdinand und ich uns schon eingestellt. Immerhin habe ich in den vergangenen Monaten über meinen Eisprung bereits genauestens Buch geführt. Auch da war unser Zusammensein eigentlich eher zweckdienlich ausgerichtet.«
Dr. Daniel nickte. »Ich kenne Paare, die das über Jahre hinweg praktiziert haben. Es ist wohl die stärkste Prüfung für eine Ehe.«
»Da haben Sie recht«, murmelte Gerda leise, dann sah sie Dr. Daniel an. »Wird es bei uns auch so lange dauern?«
»Das kann niemand vorhersagen«, entgegnete Dr. Daniel. »Vielleicht sind Sie in einem Monat schon schwanger, vielleicht müssen Sie noch ein Jahr warten. Gleichgültig, wie es sich verhalten wird und unter welchen Umständen Sie mit Ihrem Mann intim sind – versuchen Sie jeglichen Streß zu vermeiden.« Wieder lächelte er. »Das ist leichter gesagt als getan, aber je lockerer Sie sein können, desto größer sind die Chancen für Sie, schwanger zu werden.« Er überlegte kurz und fügte dann hinzu: »Bleiben Sie nach dem Zusammensein mit Ihrem Mann nach Möglichkeit immer eine halbe Stunde liegen.«
Gerda nickte. »Wir werden Ihre Ratschläge befolgen, Herr Doktor.« Sie reichte ihm die Hand. »Danke, daß Sie sich für mich so viel Zeit genommen haben.«
»Das ist doch selbstverständlich«, entgegnete Dr. Daniel schlicht. »Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann kommen Sie bitte zu mir – gleichgültig, ob es sich um körperliche oder psychische Probleme handelt. Ich werde immer für Sie da sein. Scheuen Sie sich auch nicht, mich privat anzurufen, wenn Sie mich brauchen. Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient ist gerade in einem solchen Fall au-ßerordentlich wichtig.«
»Wie sollte man zu Ihnen kein Vertrauen haben?« fragte Gerda und war froh, daß sie damals, als sie wegen der geplatzten Eierstockzyste am Steinhausener Bahnhof zusammengebrochen war, in der Waldsee-Klinik und bei Dr. Daniel gelandet war. Besser hätte sie es gar nicht treffen können.
*
Mit Argusaugen überwachte Horst Wieland jeden Schritt seiner Tochter. Natürlich wußte er, daß er Sophie zu nichts zwingen konnte – schließlich war sie ja längst erwachsen, aber er konnte einfach nicht tatenlos zusehen, wie sie ihre Karriere aufs Spiel setzte.
Aber konnte man in Sophies Fall überhaupt von einer Karriere sprechen? Sie war ja nur Krankenschwester. Horst Wieland seufzte tief auf. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte Sophie unbedingt studiert. Das war es, was er immer gewollt hatte. Sie hätte Anwältin werden sollen, und in seiner Kanzlei hätten sie dann gemeinsam Karriere gemacht, doch Sophie hatte das Studium abgelehnt, und ihre Mutter hatte sie darin noch unterstützt.
»Du mußt das Mädchen selbst entscheiden lassen«, war Marlenes Meinung gewesen.
Und was hatte diese Entscheidung gebracht? Wenn Sophie doch wenigstens Ärztin geworden wäre. Das hätte Horst akzeptieren können. Aber Krankenschwester! Nur die Tatsache, daß sie mit viel Glück und natürlich mit der Hilfe der Beziehungen, über die ihr Vater verfügte, in die Wegmann-Klinik gekommen war, hatte Horst einigermaßen versöhnt. Eine Privatklinik war nicht irgendein Krankenhaus. Und auch die Beziehung zu diesem Dr. Sternberg hatte Horst mit Wohlwollen beurteilt. Arztfrau – das wäre schon etwas gewesen!
»Und dann ist dieser Kerl verheiratet«, knurrte er jetzt wütend.
Wenn sich Sophie seinetwegen in diesem Steinhausen vergraben würde… dem Einfluß ihrer Tante ausgesetzt, die auch so impulsiv handelte. Mißmutig schüttelte Horst den Kopf. Warum hatte Sophie nicht etwas mehr von seinem Ehrgeiz und seiner Kaltschnäuzigkeit abbekommen? Ihn hätte eine unglückliche Liebe nicht gleich aus der Bahn geworfen. Er an Sophies Stelle würde diesem Sternberg…
Horst kam nicht dazu, den Gedanken zu Ende zu führen, denn Sophie trat ins Wohnzimmer. Ihr Gesicht war blaß, und die dunklen Ringe unter den Augen zeugten von vielen schlaflosen Nächten.
»Ich habe mich entschieden, Papa«, erklärte sie leise, aber mit einer Sicherheit, die nicht zu ihrem desolaten Zustand paßte. »Morgen früh fahre ich nach Steinhausen. Tante Erika und Onkel Wolfgang wissen Bescheid. Sie freuen sich auf meinen Besuch.«
»Besuch?« wiederholte Horst argwöhnisch. »Wird es wirklich nur ein Besuch, oder denkst du an einen längeren Aufenthalt?«
Sophie zuckte die Schultern. »Wenn Onkel Wolfgang in der Klinik Arbeit für mich hat, dann könnte es durchaus sein, daß ich länger dort bleibe.«
Ich werde schon dafür sorgen, daß Wolfgang keine Arbeit für dich hat, dachte Horst grimmig. Und wenn er sich meinen Wünschen widersetzt, dann soll er was erleben!
*
Sophie hatte das Haus am nächsten Morgen noch nicht richtig verlassen, da griff ihr Vater schon nach dem Telefonhörer.
»Horst, ich weiß nicht, ob es richtig ist, was du da tust«, wandte seine Frau Marlene ein. Natürlich hatte sie in den vergangen beiden Wochen die Diskussionen zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter mitbekommen, wollte sich aber nicht offen gegen Horst stellen und hatte sich daher herausgehalten.
»Du hast Sophie schon immer zu sehr verwöhnt«, hielt Horst ihr vor.
»Ich glaube nicht, daß ihr jetziger Liebeskummer damit etwas zu tun hat«, wandte Marlene ein. »Sophie ist unglücklich, verletzt und enttäuscht. Sie hat diesen Peter von ganzem Herzen geliebt, und es ist nur natürlich, daß sie jetzt Abstand gewinnen will. Sie kann nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts geschehen. Warum soll sie nicht bei Erika und Wolfgang ein bißchen Ruhe finden?«
Unwillig schüttelte Horst den Kopf. »Sie will keine Ruhe finden, sondern in diesem Kaffe ebenso versauern, wie Erika das tut. Meine Güte, was hatte meine Schwester für eine Karriere vor sich…«
»Bis diese noble Privatklinik, die du nach ihrer Rückkehr aus Amerika für sie ausgewählt hattest, pleite ging und schließen mußte«, entgegnete Marlene ruhig und ohne Vorwurf in der Stimme. Sie wußte, daß ihr Mann nur das Beste wollte, aber leider hatte er ganz bestimmte Vorstellungen davon, was für andere das Beste war, und die unterschieden sich nicht selten von dem, was die anderen wollten.
Ärgerlich winkte Horst ab. »Tatsache ist, daß Erika ihre Fähigkeiten in dieser Waldsee-Klinik vergeudet. Und ich werde dafür sorgen, daß es Sophie nicht ebenso ergeht.« Er hob den Hörer nun doch ab und wählte die Nummer seiner Schwester. Dabei hoffte er, daß nicht sie, sondern sein Schwager am Telefon sein würde. Nur ungern hätte er sich mit Erika über diese Sache unterhalten. Bei Wolfgang hoffte er auf mehr Verständnis.
In diesem Moment erklang am anderen Ende der Leitung auch schon Dr. Metzlers tiefe Stimme.
»Grüß dich, Wolfgang, hier ist Horst«, gab sich sein Schwager zu erkennen, dann kam er gleich zur Sache. »Ich rufe wegen Sophie an.«
»Was ist mit ihr?« wollte Wolfgang wissen. »Kann sie nun doch nicht kommen? Das wäre schade. Erika und ich freuen uns auf ihren Besucht.«
»Genau darum geht es«, hakte Horst sofort ein. »Ich fürchte, es wird nicht nur ein reiner Besuch. Mein Gefühl sagt mir, daß Sophie in Steinhausen bleiben will – vorausgesetzt, sie findet dort eine Stellung. Hör zu, Wolfgang, du bist Chefarzt in der Waldsee-Klinik, und du entscheidest über die Einstellung des Personals. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du Sophie keine Arbeit geben würdest.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen.
»Ich verstehe nicht ganz«, entgegnete Dr. Metzler dann. »Wieso sollte Sophie bei uns eine Stellung suchen? Soweit ich weiß, arbeitet sie doch in dieser exklusiven Privatklinik in Würzburg.«
»Soso, dann hat sie davon also noch gar nichts gesagt«, murmelte Horst. »Eigentlich seltsam…«
»Komm schon, hör endlich auf, in Rätseln zu sprechen«, fiel Dr. Metzler ihm ins Wort. »Sophie hat vor zwei Tagen angerufen und gesagt, daß sie uns besuchen möchte. Also, wozu machst du einen solchen Aufstand?«
»Ich mache überhaupt keinen Aufstand«, verwahrte sich Horst. »Ich will nur, daß Sophie nach diesem Besuch wieder zurückkommt und eine Stellung annimmt, die ihrer würdig ist.«
Mit dieser Bemerkung ging Horst entschieden zu weit. Wolfgang verband ohnehin keine besondere Freundschaft mit seinem Schwager, weil er dessen beherrschendes Wesen nicht akzeptieren konnte. Er behauptete zwar immer, es nur gut zu meinen, dabei bevormundete er Marlene und Sophie jedoch in einer Art und Weise, die Wolfgang überhaupt nicht gefiel.
»Du glaubst also, eine Stellung als Krankenschwester in der Waldsee-Klinik wäre unter Sophies Würde«, wiederholte Dr. Metzler und hatte dabei Mühe, seinen Zorn zu unterdrücken. »Jetzt hör mir mal gut zu, Horst. Die Waldsee-Klinik hat einen erstklassigen Ruf, und den verdankt sie dem ausgezeichneten Team, das hier arbeitet. Damit meine ich nicht nur die Ärzte, sondern auch die Schwestern. Ohne die würden wir Ärzte nämlich oft ziemlich alt aussehen.«
»So habe ich das doch gar nicht gemeint«, erwiderte Horst, doch seinem Tonfall war zu entnehmen, daß Dr. Metzler ganz richtig verstanden hatte. »Ich gehe jedenfalls davon aus, daß du dich nach meinen Wünschen richten wirst.«
»Darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen«, meinte Dr. Metzler ungerührt. »Sophie hat am Telefon von einem Besuch gesprochen, und sie ist uns jederzeit herzlich willkommen. Wenn sie hier aber wirklich eine Stellung sucht, dann werde ich mit Sicherheit der Letzte sein, der sie abweist. Eine tüchtige Krankenschwester wird in der Waldsee-Klinik dringend gebraucht.«
»Das wagst du nicht!« brauste Horst auf.
»Wie gesagt – darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen.«
Mit diesen Worten legte Dr. Metzler auf, denn er wußte genau, daß eine Fortsetzung der Diskussion unweigerlich zur Verschärfung des Streits geführt hätte.
»War das mein Bruder?« wollte seine Frau wissen, die einen Teil des unerfreulichen Gesprächs mitbekommen hatte.
»Ja«, knurrte Dr. Metzler. »Er war nicht gerade angenehm.«
»Ach komm, Wolfi, du kennst doch Horst und seine verschrobenen Ansicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Manchmal frage ich mich, wie unsere Eltern zwei so grundverschiedene Kinder bekommen konnten. Horst und ich haben wirklich nicht viel gemeinsam.«
»Glücklicherwese«, meinte Dr. Metzler und konnte dabei schon wieder lächeln. »Sonst hätte ich dich nämlich bestimmt nicht geheiratet.« Er wurde wieder ernst. »Ich verstehe nicht, warum sich Marlene so viel von ihm gefallen läßt. Und auch Sophie… sie ist ja immerhin schon fünfundzwanzig. Warum läßt sie ihren Vater noch immer so sehr über ihr Leben bestimmen?«
»Es ist nicht leicht, gegen Horst anzukommen«, entgegnete Erika. »Ich habe es auch nie wirklich geschafft.« Sie seufzte. »Er hat es mir nie ganz verziehen, daß ich meine Stellung in Amerika habe sausen lassen, weil ich so unglücklich verliebt war.« Sie stupste ihren Mann zärtlich an der Nase. »In dich.«
»Deshalb kann er mich auch noch immer nicht ausstehen«, vermutete Dr. Metzler, dann zuckte er die Schultern »Was soll’s? Mir ist es im Grunde herzlich egal, ob er mich mag oder nicht.« Ärgerlich schüttelte er den Kopf. »Er hat doch allen Ernstes behauptet, eine Stellung an der Waldsee-Klinik wäre unter Sophies Würde. Kannst du dir das vorstellen?«
Erika nickte ohne zu zögern. »Leider ja. Was glaubst du, wie oft er das zu mir schon gesagt hat? Ich habe es dir nur verschwiegen, weil ich nicht wollte, daß du zornig wirst.«
»Danke«, grummelte Wolfgang, dann lächelte er plötzlich. »Hoffentlich will Sophie eine Stellung an der Waldsee-Klinik. Ich weiß ja, daß sie eine ausgezeichnete Krankenschwester ist. Wir könnten sie wirklich gut gebrauchen.«
Erika war in diesem Punkt nicht zuversichtlich. »Warum sollte Sophie hier arbeiten wollen? Sie hat doch eine gute Stellung. Wahrscheinlich sind das alles nur Hirngespinste von Horst. Wenn er das Wort ›Steinhausen‹ nur hört, sieht er schon rot. Sophie wird das alles sicher aufklären.«
*
Sophie war todmüde, als sie am späten Vormittag am Steinhausener Bahnhof den Zug verließ. Schon seit Wochen hatte sie nachts kaum noch Schlaf gefunden, und die anstrengende Zugfahrt von Würzburg über München bis hierher hatte ihr den Rest gegeben. Mit einem tiefen Seufzer stellte sie den Koffer ab, dann blickte sie sich suchend um.
»Sophie!«
Das junge Mädchen drehte sich um, dann huschte ein Lä-cheln über das zarte, jetzt jedoch von Kummer überschattete Gesicht.
»Tante Erika.«
Impulsiv schlang Sophie ihre Arme um Erikas Nacken und lehnte die Stirn einen Augenblick an die Schulter der Tante. Obwohl Erika nur zwölf Jahre älter war als sie, nannte sie sie liebevoll »Tante«.
»Was ist denn los, Mäd-chen?« fragte Erika sanft.
Ein heftiges Schluchzen entrang sich Sophies Brust. »Ich bin so unglücklich, Tante Erika.«
Die junge Ärztin nickte verständnisvoll, dann legte sie einen Arm um die Schultern ihrer Nichte und begleitete sie zu ihrem Auto.
»Jetzt fahren wir erst mal heim«, meinte sie, dann lächelte sie Sophie an. »Mal sehen, was Wolfgang in der Zwischenzeit für uns zusammengebrutzelt hat.«
Auch über Sophies Gesicht huschte ein Lächeln, was um so rührender wirkte, als ihr immer noch Tränen über die Wangen liefen.
»Onkel Wolfgang kann kochen?« fragte sie, dann schüttelte sie den Kopf. »Am Herd kann ich ihn mir gar nicht vorstellen.«
»In meinem Göttergatten stecken ungeahnte Talente«, scherzte Erika, um Sophie ein bißchen abzulenken und aufzumuntern. »Nein, im Ernst, wenn ihm die Arbeit in der Klinik Zeit läßt, dann kocht er sehr gern, und meistens kommt auch etwas Eßbares dabei heraus.«
»Nur meistens? Ich glaube, das hätte er jetzt nicht hören dürfen.«
»Ganz sicher nicht«, bestätigte Erika. »Aber du wirst mich doch hoffentlich nicht verpetzen.«
»Natürlich nicht«, versicherte Sophie, dann blickte sie aus dem Fenster. Sie liebte diesen idyllischen Vorgebirgsort, in dem jetzt die übliche sonntägliche Mittagsruhe herrschte. Stolz und majestätisch reckte sich der stattliche Kreuzberg empor und vermittelte ganz den Anschein, als wäre hinter ihm die Welt zu Ende.
»Papa war ziemlich sauer, weil ich hierhergefahren bin«, erzählte Sophie leise.
»Ich weiß.« Erika zögerte, entschloß sich dann aber für die Wahrheit. »Er hat heute früh schon angerufen.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, erwiderte Sophie, und aus ihrer Stimme klang dabei offene Bitterkeit. »Er behandelt mich wie ein unmündiges kleines Mädchen.« Sie wandte ihr Gesicht Erika zu. »Ich will ganz ehrlich sein. Ich bin nicht nur gekommen, um dich und Onkel Wolfgang zu besuchen, sondern… ich möchte hierbleiben – vielleicht für immer, ganz sicher aber für die nächsten Jahre.«
»Dann hatte dein Vater mit seiner Vermutung also doch recht.«
»Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht«, stellte Sophie richtig. »Ich habe gesagt, daß ich eine Weile bleiben würde, wenn Onkel Wolfgang eine Arbeit für mich hat.«
»Die hat er ganz sicher«, meinte Erika, dann warf sie ihrer Nichte einen kurzen Blick zu, bevor sie sich wieder auf die gewundenen Gassen Steinhausens konzentrierte. »Aber fürs erste solltest du dich erholen, Sophie. Du siehst ja schrecklich aus, wenn ich dir das in aller Offenheit sagen darf.«
Traurig senkte Sophie den Kopf. »Das hat auch einen Grund, Tante Erika.« Sie schwieg kurz. »Auch deshalb bin ich hierhergekommen. Mit dir und Onkel Wolfgang kann ich darüber sprechen. Papa hat dafür kein Verständnis, und Mama…« Sie zuckte die Schultern. »Du kennst sie ja. Einen wirklichen Rat oder gar Hilfe bekomme ich von ihr nicht. Sie hat sich ein Leben lang wohl immer nur so durchgeschlängelt.«
»Das mußte sie an der Seite deines Vaters wohl auch«, erwiderte Erika. »Mein Bruder ist äußerst dominierend. Gegen ihn hatte deine Mutter nie eine Chance, also ist sie einfach immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen, und aus diesem eingefahrenen Gleis kommt sie anscheinend nun nicht mehr heraus.«
Sophie nickte, dann hob sie den Kopf wieder. »Ich möchte nicht so leben, und ich will mich auch nicht mehr länger bevormunden lassen.« Wieder schwieg sie kurz. »Du hast recht – ich brauche ein bißchen Erholung, aber dann will ich arbeiten, und Onkel Wolfgang wird es bestimmt nicht bereuen, wenn er mir eine Stellung gibt.«
*
Was Dr. Wolfgang Metzler in der Zwischenzeit am heimischen Herd zusammengebrutzelt hatte, war nicht nur eßbar, sondern schmeckte sogar ganz ausgezeichnet. Trotzdem brachte Sophie nur mit großer Mühe einige Bissen hinunter.
Dr. Metzler beobachtete sie eine Weile, dann legte er sehr behutsam eine Hand auf ihren Arm.
»Akuter Herzschmerz, nicht wahr?« fragte er leise.
Ein ansatzweises Lächeln huschte über Sophies Gesicht.
»Aus dir spricht der Arzt, Onkel Wolfgang.« Dann bedeckte sie mit beiden Händen ihre Augen und schluchzte hilflos auf. »Es tut so weh!«
Fürsorglich legte er einen Arm um ihre Schultern und führte sie ins Wohnzimmer. Hierher kam auch Erika, nachdem sie den kleinen Andi zum Mittagsschlaf hingelegt hatte.
»Sprich dir nur alles von der Seele, Mädchen«, riet sie, wäh-rend sie auf der anderen Seite neben Sophie Platz nahm und nun beinahe mütterlich nach ihrer Hand griff.
»Er ist Arzt an der Privatklinik von Dr. Wegmann«, brach-
te Sophie unter Schluchzen
hervor. »Ein Mann wie aus
dem Bilderbuch – gutaussehend, zärtlich… genau das, was sich ein Mädchen wünscht. Ich dachte…« Vor lauter Weinen konnte sie nicht mehr weitersprechen, doch Wolfgang und Erika drängten sie auch nicht.
Schließlich ließ sich Sophie erschöpft gegen ihre Tante sinken. »Er versprach mir den Himmel auf Erden, doch was ich dann durchlebte, war die Hölle. Ich sah ihn auf der Straße… mit einer anderen… seiner Frau. Zwei Kinder haben sie auch.« Mit einer fahrigen Handbewegung strich sie ihr langes blondes Haar zurück. »Es ist für ihn nichts anderes als eine Art Sport. Er versucht es bei jeder neuen Schwester, die eingestellt wird, und ich denke, er hat immer Erfolg. Wer könnte ihm auch widerstehen?«
Wütend ballte Dr. Metzler eine Faust. »Den möchte ich gern mal zwischen die Finger bekommen.«
»Das ist aber wohl noch nicht das Ende der Geschichte«, vermutete Erika.
Sophie atmete tief durch. »Als ich von seiner Ehe wußte, beendete ich das Verhältnis. Daraufhin hat er dafür gesorgt, daß mir gekündigt wurde.« Sie erzählte, was Dr. Wegmann gesagt hatte, dann senkte sie niedergeschlagen den Kopf. »Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie Papa darauf reagiert hat.« Mit einer Hand fuhr sie sich über die Augen. »Ich habe es in Würzburg einfach nicht mehr ausgehalten. Papas Drängen, daß ich an eine andere namhafte Klinik gehen solle, setzte mir zu. Der Gedanke an Peter, der immer noch so schrecklich weh tut, obwohl ich ihn eigentlich hassen sollte. Es ist furchtbar.«
»Das glaube ich dir«, meinte Erika. »Das Herz nimmt keine Befehle an, und die Wunde, die dieser Peter gerissen hat, kann nur die Zeit heilen.«
Die mitfühlenden Worte und die Gewißheit, verstanden zu werden, taten Sophie gut. Sie wußte, daß ihre Entscheidung hierherzukommen, richtig gewesen war.
»Ich bin froh, daß ich bei euch sein kann«, erklärte sie.
*
In regelmäßigen Abständen kam Gerda Rauh in die Praxis von Dr. Daniel, um sich untersuchen zu lassen. Dabei bemerkte der Arzt mit wachsender Besorgnis die zunehmenden Depressionen seiner Patientin.
»Ich glaube, wir sollten uns doch einmal zu einem eingehenden Gespräch zusammensetzen«, schlug Dr. Daniel schließlich vor. »Und es wäre von großem Vorteil, wenn auch Ihr Mann dabei sein könnte.«
Gerda nickte, und dabei sah man ihr etwas wie Erleichterung an. Offensichtlich hatte sie genau darauf gewartet.
»Das wäre bestimmt gut«, stimmte sie zu. »Ferdinand und ich… wir sind an einem Punkt angekommen…« Hilflos zuckte sie die Schultern.
Doch Dr. Daniel verstand auch so. Immerhin hatte er schon genügend Paare betreut, die Probleme hatten, ein Kind zu bekommen. Krisen blieben dabei fast nie aus. Wichtig war vor allem, die Patientin und auch ihren Ehepartner in dieser Situation nicht im Stich zu lassen.
Dr. Daniel griff nach seinem Terminkalender. »Wann könnten Sie und Ihr Mann zu mir kommen?«
Gerda seufzte. »Ferdinand kommt zur Zeit immer so spät von der Arbeit.« Sie senkte den Kopf. »Manchmal denke ich, er will gar nicht mehr daheim sein.«
Dr. Daniel brauchte nur wenige Augenblicke, um zu einem Entschluß zu gelangen.
»Ich werde Sie beide heute abend besuchen, wenn es Ihnen recht ist«, bot er an.
Überrascht sah Gerda ihn an. »Das wollen Sie tun?« Sie errötete ein wenig. »Ich meine… Sie wollen doch auch Feierabend haben…«
Dr. Daniel lächelte. »Sie sind erst seit recht kurzer Zeit bei mir in Behandlung, sonst wüßten Sie, daß mir das Wohl meiner Patienten sehr am Herzen liegt. Dafür opfere ich auch gern mal meine Freizeit. Also, Frau Rauh, wäre Ihnen acht Uhr recht?«
»Ja… ja, natürlich«, stammelte Gerda. So etwas hatte sie tatsächlich noch nie erlebt.
Er begleitete Gerda noch hinaus, dann wandte er sich seiner Sprechstundenhilfe zu. »War Frau Rauh die letzte Patientin für heute?«
Sarina von Gehrau schüttelte den Kopf. »Eine Frau Wieland ist vor fünf Minuten noch gekommen. Sie hat keinen Termin, sieht aber sehr unglücklich aus.«
»Na, dann kümmern wir uns mal um die junge Dame«, meinte Dr. Daniel und betrat gleich selbst das Wartezimmer. »Frau Wieland?«
Die junge Frau erhob sich hastig, und Dr. Daniel bemerkte sofort, daß sie völlig durcheinander zu sein schien. Sie kam ihm irgendwie bekannt vor, doch er hätte nicht sagen können, wo er sie schon einmal gesehen hatte.
»Was führt Sie zu mir, Frau Wieland?« wollte er wissen, als sie sich im Sprechzimmer gegenübersaßen.
Die junge Frau hatte die zitternden Hände im Schoß verkrampft und wagte fast nicht, Dr. Daniel anzusehen.
»Ich… ich glaube, ich bin schwanger«, flüsterte sie, dann hob sie den Blick, und in diesem Moment erkannte Dr. Daniel, woher er sie kannte. »Sie sind Erika Metzlers Nichte, nicht wahr? Wir haben uns bei der Hochzeit von Erika und Wolfgang gesehen.«
Die junge Frau nickte. »Ich bin Sophie. Sophie Wieland.« Ihre Hände bebten, als sie ihr langes blondes Haar zurückstrich. »Ich bin zu Besuch hier… das heißt, eigentlich wollte ich in der Waldsee-Klinik als Krankenschwester arbeiten, aber jetzt… meine Tage sind ausgeblieben, und ich habe zugenommen. Morgens ist mir übel, und…« Sie brach in Tränen aus. »Ich darf einfach nicht schwanger sein!«
»Nun beruhigen Sie sich erst einmal, Sophie«, bat Dr. Daniel, und seine tiefe, warme Stimme zeigte wieder einmal ihre Wirkung. Sophie wurde spürbar ruhiger, wenn auch immer noch Tränen über ihre Wangen liefen.
»In einem Punkt können Sie völlig beruhigt sein«, fuhr Dr. Daniel fort. »Ihre Tante wird vom Gespräch und auch vom Untersuchungsergebnis nichts erfahren. Sie als Krankenschwester werden ja wissen, daß ich der Schweigepflicht unterliege.«
»Ja, natürlich«, murmelte Sophie, dann fuhr sie sich mit einer Hand über die Stirn. »Ich weiß auch nicht… ich bin völlig durcheinander…«
»Das sehe ich«, meinte Dr. Daniel. »Seit wann sind Sie denn hier in Steinhausen?«
»Seit knapp drei Wochen. Ich wollte auch schon längst anfangen zu arbeiten, aber Onkel Wolfgang hat gesagt, er müsse zuerst mit Ihnen sprechen, weil Sie doch der Direktor der Klinik sind.«
»Das hätte er auch bestimmt schon längst getan, aber in letzter Zeit war es wohl hier in meiner Praxis als auch drüben in der Klinik wieder ziemlich stressig.» Aufmerksam sah Dr. Daniel die junge Frau an. Sophie machte einen völlig aufgelösten Eindruck. »Aber ich denke, im Moment geht es wohl in erster Linie um Ihre Schwangerschaft – sofern sich Ihr Verdacht bestätigen sollte.«
»Ich kenne meinen Körper. Ich bin ganz bestimmt schwanger.« Wieder brach sie in Tränen aus.
Spontan stand Dr. Daniel auf und kam um seinen Schreibtisch herum, dann legte er einen Arm tröstend um Sophies Schultern. »Wir werden jetzt erst mal ins Labor hinübergehen. Dort wird meine Sprechstundenhilfe einen Schwangerschaftstest vornehmen, und dann sehen wir weiter.«
Sophie nickte, doch ihre Hände zitterten wie Espenlaub, als sie von Sarina den Becher entgegennahm, der für die Urinprobe bestimmt war. Die Auswertung des Tests dauerte dann auch nur wenige Minuten.
»Negativ«, erklärte Sarina und legte den Teststreifen vor Dr. Daniel auf den Schreibtisch.
»Aber… das ist unmöglich!« entgegnete Sophie. »Ich weiß, daß ich schwanger bin… ich fühle es.«
»Der Test ist aber eindeutig negativ«, wandte Dr. Daniel ein, dann bat er Sophie in den Nebenraum. »Machen Sie sich bitte hinter dem Wandschirm frei. Wann hatten Sie das letzte Mal Ihre Tage?«
»Vor sieben Wochen«, antwortete Sophie ohne zu überlegen, dann trat sie hinter dem Wandschirm hervor und legte sich auf den gynäkologischen Stuhl. Dabei zitterten ihre Beine so heftig, daß sie Mühe hatte, sich zu entspannen.
Sehr gewissenhaft führt Dr. Daniel die Untersuchung durch. Das Ergebnis beunruhigte ihn ein wenig. Die Gebärmutter hatte sich bereits vergrößert – ein Zeichen, daß tatsächlich eine Schwangerschaft vorlag.
»Kleiden Sie sich bitte wieder an, Sophie«, erklärte Dr. Daniel. »Wir müssen den Schwangerschaftstest wiederholen. Fräulein Sarina ist in dieser Hinsicht zwar noch nie ein Fehler unterlaufen, aber…« Er zuckte die Schultern. »Die Untersuchung weist tatsächlich auf eine bestehende Schwangerschaft hin.« Er überlegte einen Moment. »Ich werde auch eine Blutabnahme veranlassen.«
Sarina von Gehrau war sehr erstaunt, als Dr. Daniel ihr sagte, es müsse ein zweiter Schwangerschaftstest vorgenommen werden.
»Ich habe alles so gemacht wie immer«, versicherte sie.
»Daran habe ich auch nicht gezweifelt«, meinte Dr. Daniel. »Tatsache ist aber, daß meine Untersuchung eine bestehende Schwangerschaft ergeben hat. Nehmen Sie Frau Wieland auch Blut für ein großes Blutbild ab.«
»In Ordnung, Herr Doktor.«
Rasch und geschickt führte Sarina die Blutabnahme durch, die Dr. Daniel von seiner jungen Empfangsdame Gabi Meindl gleich in die Waldsee-Klinik bringen ließ. Währenddessen telefonierte er schon mit dem dortigen Oberarzt Dr. Gerrit Scheibler, der in dringenden Fällen persönlich die Auswertung von Blutproben vornahm.
»Gerrit, es tut mir leid, daß ich Sie so kurz vor Dienstschluß noch mit Arbeit überhäufen muß«, entschuldigte sich Dr. Daniel. »Meine Empfangsdame ist gerade mit einer Blutprobe auf dem Weg zu Ihnen, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Auswertung sofort vor-
nehmen könnten. Ein großes Blutbild und vor allen Dingen die Bestimmung des HCG-Werts.«
»Geht in Ordnung, Robert«, erklärte Dr. Scheibler. »Ich bringe Ihnen das Ergebnis, bevor ich nach Hause fahre. Ihre Praxis liegt ohnehin auf dem Weg.«
»Danke, Gerrit, dafür haben Sie bei mir etwas gut.«
»Darauf werde ich bestimmt zurückkommen«, meinte der Oberarzt, und an seiner Stimme hörte Dr. Daniel, daß er lächelte.
Die beiden Ärzte verabschiedeten sich, dann legte Dr. Daniel auf. Im nächsten Moment kam seine Sprechstundenhilfe herein.
»Auch der zweite Test war negativ«, erklärte sie und wirkte dabei ziemlich ratlos. »Ich verstehe das nicht. Unsere Schwangerschaftstests waren bisher doch immer zuverlässig.«
Dr. Daniel nickte nachdenklich. »Ich weiß, Fräulein Sarina. Die ganze Geschichte ist tat-sächlich irgendwie merkwürdig. Aber warten wir mal ab, was die Blutuntersuchung ergibt.«
Er kehrte zu Sophie zurück und nahm ihr gegenüber Platz.
»Und?« wollte sie sofort wissen. »Ist der Test positiv?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, er war auch diesmal negativ.« Er überlegte einen Moment. »Was ich Sie jetzt fragen werde, kommt Ihnen sicher sehr indiskret vor, aber seien Sie versichert, daß ich nicht aus Neugierde frage.« Er zögerte einen Moment, dann fuhr er fort: »Nach Ihrem Schrecken über eine mögliche Schwangerschaft zu urteilen, gehe ich davon aus, daß sie Ihnen nicht sehr gelegen käme.«
»Das ist richtig«, gab Sophie unumwunden zu. »Der Mann, mit dem ich zusammen war, ist verheiratet. Ich wußte das damals noch nicht, und als ich es erfahren habe, habe ich die Beziehung sofort beendet.«
Dr. Daniel nickte verständnisvoll. »So etwas ist eine bittere Erfahrung.«
Sophie fühlte, wie ihr Vertrauen zu dem sympathischen Arzt immer mehr wuchs. Von Erika und Wolfgang hatte sie ja durchweg Gutes über Dr. Daniel gehört, und nun konnte sie feststellen, daß kein Wort davon übertrieben gewesen war.
»Aus diesem Grund bin ich hier«, gestand sie. »Meine Eltern… nein, eigentlich nur mein Vater… er hat dafür kein Verständnis. Er ist der Meinung, daß man eine so schlechte Erfahrung einfach wegstecken sollte, aber das kann ich nun einmal nicht.« Traurig senkte sie den Kopf. »Dazu habe ich Peter zu sehr geliebt.«
»Und Sie haben Sehnsucht nach ihm«, stellte Dr. Daniel fest.
Sophie zögerte, dann nickte sie.
»Ja, Herr Doktor«, flüsterte sie. »Grenzenlose Sehnsucht sogar.«
In diesem Moment klingelte das Telefon auf Dr. Daniels Schreibtisch.
»Scheibler«, gab sich der Oberarzt zu erkennen, als Dr. Daniel sich gemeldet hatte. »Wir bekommen in Kürze noch einen Notfall, deshalb gebe ich Ihnen die Untersuchungsergebnisse jetzt noch rasch durch.«
Dr. Daniel notierte die Befunde.
»Der HCG-Wert ist nicht erhöht«, erklärte Dr. Scheibler zum Abschluß. »Meines Erachtens kann also keine Schwangerschaft vorliegen.«
Damit hatte Dr. Daniel schon fast gerechnet, weil auch die Blutsenkung nicht beschleunigt gewesen war. Das allein hätte zwar noch keine bestehende Schwangerschaft bewiesen, aber im Zusammenhang mit einem womöglich erhöhten HCG-Wert wäre es doch sehr aufschluß-reich für ihn gewesen. So aber blieb das Ganze weiterhin äu-ßerst rätselhaft.
Dr. Daniel bedankte sich noch, dann legte er auf und sah Sophie an.
»Auch die Blutuntersuchung hat keinen Hinweis auf eine Schwangerschaft ergeben«, erklärte er.
Verständnislos sah Sophie ihn an. »Wie ist so etwas möglich? Mir ist morgens übel, meine Brüste spannen, meine Tage sind längst überfällig, und auch Sie haben ja festgestellt, daß die Gebärmutter vergrößert ist. Also muß ich doch schwanger sein!«
»Ich werde mir das jetzt auf Ultraschall ansehen«, beschloß Dr. Daniel nachdenklich. »Machen Sie sich bitte noch mal frei, und legen Sie sich dann auf die Untersuchungsliege. Falls Sie tatsächlich schwanger sind, kann ich das nur durch eine transvaginale Sonografie feststellen. Anders sehe ich im Frühstadium noch nichts.« Er sah Sophie prüfend an. »Ich nehme an, Sie kennen dieses Verfahren.«
Sophie nickte. »Allerdings nur aus der Theorie. Gemacht wurde es bei mir noch nie.«
»Es ist ein bißchen unangenehm, aber nicht schmerzhaft«, meinte Dr. Daniel.
Die Ultraschalluntersuchung ergab allerdings genau den Befund, den Dr. Daniel fast schon erwartet hatte. Die Gebärmutter war leer. Wäre sie nicht vergrößert gewesen, hätte er jetzt an eine Eileiterschwangerschaft gedacht. So aber…
»Sophie, versuchen Sie bitte, mir eine ganz ehrliche Antwort zu geben«, meinte Dr. Daniel, als die junge Frau sich wieder angekleidet hatte. »Das wird nicht sehr einfach sein, weil sich Bewußtsein und Unterbewußtsein oftmals stark unterscheiden. Denken Sie also genau über meine Frage nach, ehe Sie antworten.« Er wartete einen Augenblick, dann fuhr er fort: »Glauben Sie… nein, wünschen Sie sich, daß Ihre Beziehung zu Peter fortbestehen würde?«
Sophie seufzte tief auf. »Da muß ich nicht überlegen, Herr Doktor. Natürlich wünsche ich mir das. Ich liebe ihn noch immer, aber was hat das mit der Schwangerschaft zu tun… wenn es überhaupt eine ist.«
»Ich denke, es ist keine«, meinte Dr. Daniel. »Haben
Sie schon einmal etwas über Scheinschwangerschaften ge- hört?«
Völlig fassungslos starrte Sophie ihn an. »Sie glauben… ich bilde mir das nur ein? Ja… bin ich denn schon verrückt?«
»Natürlich nicht, Sophie. Mit Verrücktsein hat das nichts zu tun. Das Ganze geht von Ihrem Unterbewußtsein aus. Sie sehnen sich so sehr nach Peter, daß Sie instinktiv nach einer Möglichkeit suchen, ihn zurückzugewinnen. Ein gemeinsames Kind wäre vielleicht eine solche Möglichkeit.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Er würde sich nicht von seiner Frau trennen, wenn ich ein Kind erwarten würde. Er würde bestimmt nur eine Abtreibung verlangen oder sich vielleicht bereit erklären, für das Kind Unterhalt zu zahlen. Wahrscheinlicher ist allerdings, daß er die Vaterschaft bestreiten würde.«
»Das wissen Sie, aber in Ihrem Unterbewußtsein geht etwas anderes vor.«
»Und was kann ich dagegen tun?«
»Ich will Ihnen jetzt nicht gleich mit Psychotherapie kommen«, meinte Dr. Daniel. »Es genügt vielleicht schon, wenn Sie nur deutlich wissen, was in Ihrem Innersten vorgeht. Vor allen Dingen sollten Sie aber auch darüber sprechen… mit dem Menschen, dem Sie am meisten vertrauen. Das kann Ihre Tante sein oder vielleicht auch ich, wenn Sie zu mir das nötige Vertrauen aufbringen können.«
Sophie nickte ohne zu zögern. »Ja, Herr Doktor, Ihnen würde ich vertrauen. Es ist nicht so, daß ich vor Tante Erika Hemmungen hätte, darüber zu sprechen, aber ich glaube… ich glaube, Sie wären in diesem Fall doch der geeignetere Ansprechpartner.«
»Gut, Sophie«, erklärte Dr. Daniel und lächelte die junge Frau freundlich an. »In diesem Fall können Sie zu mir kommen, wann immer Ihnen danach zumute ist. Sie können mich privat aufsuchen oder auch hier in der Praxis. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie nun einen Termin haben oder nicht, und ich werde natürlich auch meine Empfangsdame dahingehend informieren.« Er überlegte einen Moment. »Ganz gut wäre vielleicht auch die Stellung in der Waldsee-Klinik, die Sie vorhin angesprochen haben. Wenn Sie sich mit Wolfgang einig sind, dann können Sie jederzeit
dort anfangen. Das mit dem Arbeitsvertrag regeln wir noch, aber grundsätzlich haben Sie jetzt bereits mein Einverständnis.«
In diesem Moment konnte Sophie zum ersten Mal, seit sie die Praxis betreten hatte, lä-cheln. »Danke, Herr Doktor. Ich verspreche Ihnen, daß Sie es nicht bereuen werden.«
*
Als Dr. Daniel an diesem Abend aus der Praxis in seine Wohnung hinaufkam, war es bereits nach sieben Uhr. Er hatte die Tür noch nicht hinter sich geschlossen, als die kleine Tessa auch schon auf ihn zustürzte.
»Papa! Endlich!«
Im nächsten Moment hing sie an seinem Hals.
Liebevoll drückte Dr. Daniel sein Töchterchen an sich. »Ich weiß schon, Mäuschen, heute bin ich furchtbar spät dran.« Bedauernd sah er in Tessas strahlendes Gesicht. »Und ich muß leider in einer halben Stunde wieder weg.«
Schlagartig erlosch das glückliche Lächeln der Kleinen.
»Warum mußt du immer soviel arbeiten, Papa?« fragte sie traurig.
Dr. Daniel bekam bei diesen Worten direkt ein schlechtes Gewissen. »Ja, weißt du, Mäus-chen, heute waren zwei junge Frauen bei mir, die waren furchtbar traurig. Sie verlassen sich jetzt darauf, daß ich ihnen helfe.«
Tessa nickte zwar, doch so ganz einsehen konnte sie das nicht, was ihre nächsten Worte auch bewiesen. »Warum mußt immer du ihnen helfen?«
»Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Antwort«, erklärte Manon, die sich in diesem Augenblick zu ihnen gesellte. Lä-chelnd legte sie einen Arm um Dr. Daniels Hüfte und schmiegte sich einen Moment zärtlich an ihn.
»Ihr macht es mir ja heute ganz schön schwer«, urteilte Dr. Daniel. »Ich reiße mich schließlich auch nicht darum, die Abende woanders zu verbringen als im Kreis meiner Familie. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Und wenn eine Ehe in Gefahr ist, dann muß ich eben auch mal auf meinen Feierabend verzichten.«
Liebevoll streichelte Manon sein Gesicht. »Du weißt genau, daß ich dafür Verständnis habe.« Dann wandte sie sich Tessa zu. »Weißt du, Kleines, zu deinem Papa haben fast alle Menschen sehr viel Vertrauen, und deshalb muß er meistens mehr arbeiten als andere.«
Tessa dachte eine Weile dar-über nach, dann richtete sich der Blick ihrer großen Augen auf Dr. Daniel.
»Aber morgen abend mußt du daheim sein, Papa, sonst bin ich ganz traurig.« Und um ihrer Drohung noch mehr Gewicht zu verleihen, fügte sie hinzu. »Dann muß ich nämlich weinen.«
Dr. Daniel lächelte. »Das will ich natürlich nicht riskieren, mein Mäuschen. Morgen nehme ich mir ganz viel Zeit für dich, das verspreche ich dir.«
Das glückliche Strahlen kehrte auf Tessas Gesichtchen zu-rück. Zärtlich umarmte sie ihren Vater.
»Darauf freue ich mich schon.«
Dr. Daniel gab ihr einen liebevollen Kuß auf die Wange, dann stellte er sie wieder auf den Boden. Hastig aß er ein paar Happen, dann machte er sich auf den Weg zu Gerda und Ferdinand Rauh. Pünktlich um acht Uhr erreichte er die Wohnung des jungen Ehepaars und drückte auf den Klingelknopf.
Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Gerda ihm öffnete, und an ihrem Gesichtsausdruck konnte er unschwer erkennen, daß dieses Gespräch wirklich keinen längeren Aufschub mehr geduldet hätte.
»Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Doktor«, bot Gerda an, als sie das Wohnzimmer betreten hatten. In diesem Moment erhob sich auch Ferdinand und kam auf Dr. Daniel zu, um ihn zu begrüßen.
»Es ist mir schon ein bißchen unangenehm, daß Sie unseretwegen Ihren Feierabend opfern müssen«, erklärte Ferdinand.
»Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken«, entgegnete Dr. Daniel, während er sich auf das gemütliche Sofa setzte. »Wenn jemand meine Hilfe braucht, dann stelle ich mein Privatleben auch gern mal zu-rück.« Er betrachtete das junge Ehepaar. »Und ich glaube, Sie haben diese Hilfe dringend nötig.«
Ferdinand warf seiner Frau einen kurzen Blick zu, dann seufzte er. »Was wir seit Monaten führen, ist keine Ehe mehr. Wir haben uns in Zeugungsmaschinen verwandelt – und die funktionieren noch nicht einmal.«
»So sollten Sie das nicht sehen, Herr Rauh«, entgegnete Dr. Daniel. »Wir wußten von Anfang an, daß es schwierig werden würde. Ihre Frau verfügt nur noch über einen Eileiter, und das Problem, das bei Ihnen vorliegt, ist auch nicht zu unterschätzen. Schon bei zwei intakten Eileitern würde es aufgrund des geringen Anteils an Samenfäden für Sie nicht einfach sein, ein Kind zu zeugen.«
Niedergeschlagen senkte Ger-da den Kopf. »Es ist wohl besser, wir geben auf und finden uns eben damit ab, daß wir kein Kind haben können.« Ein wenig unsicher tastete sie nach der Hand ihres Mannes. »Bevor unsere Ehe kaputtgeht, verzichte ich lieber auf ein Baby.«
»Uns steht immer noch die Möglichkeit einer künstlichen Befruchtung offen«, erwiderte Dr. Daniel. »Ob Sie diesen Weg einschlagen wollen, ist natürlich Ihre Entscheidung, aber es wäre meiner Meinung nach durchaus eine reelle Chance für Sie.«
Ferdinand und Gerda tauschten einen langen Blick, dann nickten sie beide.
»Einverstanden«, faßte Gerda die Entscheidung, die sie und ihr Mann gerade in stummem Einvernehmen getroffen hatten, zusammen.
»Gut«, meinte Dr. Daniel, dann holte er einen Kalender hervor. Er erkundigte sich bei Gerda, wann sie zuletzt ihre Tage gehabt hatte, notierte das Datum und rechnete kurz.
»Ich würde vorschlagen,
daß Sie nächsten Mittwoch in die Waldsee-Klinik kommen«, meinte er. »Sie werden ein Medikament bekommen, das sicher einen Eisprung auslöst. Dann wird der Samen Ihres Mannes mit Hilfe einer speziellen Spritze in die Gebärmutter eingebracht, an drei bis vier aufeinanderfolgenden Tagen.« Er lächelte das junge Ehepaar an. »Danach heißt es abwarten.«
»Und… wenn es nicht klappen sollte?« fragte Gerda zögernd.
»Wir können dieses Verfahren fünfmal wiederholen«, erklärte Dr. Daniel
Wieder tauschten Gerda und Ferdinand einen langen Blick, doch keiner von ihnen wagte es, etwas darauf zu erwidern. Dr. Daniel war sicher, daß die Rauhs maximal drei Versuche durchstehen würden, aber mehr würden ja vielleicht auch gar nicht nötig sein.
»Haben Sie noch Fragen?« wollte der Arzt jetzt wissen.
Ferdinand seufzte. »Ja, vermutlich noch tausende, aber im Moment fällt mir keine einzige ein.«
»Mir geht’s genauso«, gestand Gerda mit einem verlegenen Lächeln.
»Überschlafen Sie das Ganze, und unterhalten Sie sich in den folgenden Tagen noch einmal darüber. Dabei werden sich die offenstehenden Fragen von ganz allein einstellen, und Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen können. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.«
»Danke, Herr Doktor«, entgegnete Gerda. »Ich weiß nicht, wie wir das alles ohne Sie schaffen würden.«
*
Mit sehr gemischten Gefüh-len ging Gerda Rauh in der folgenden Woche in die Waldsee-Klinik. Nach Dr. Daniels Besuch und dem ausführlichen Gespräch hatte sie noch dreimal in seiner Praxis angerufen, um dringende Fragen loszuwerden, und Dr. Daniel hatte sich jedesmal viel Zeit für sie genommen. Trotzdem hatte sie Angst vor dem, was jetzt auf sie zukommen würde.
Dr. Daniel nahm sie in der Gynäkologie gleich persönlich in Empfang und betrat mit ihr das Ärztezimmer.
»Soll ich mich gleich… freimachen?« fragte Gerda zögernd.
»Nein, Frau Rauh, immer mit der Ruhe«, entgegnete Dr. Daniel, und seine tiefe Stimme verfehlte auch diesmal nicht ihre Wirkung. Gerda entspannte sich, wenn sie die Angst auch nicht ganz unterdrücken konnte.
»Sie haben die Medikamente, die ich Ihnen gegeben habe, ja weiter eingenommen«, fuhr Dr. Daniel fort. »Damit stellen wir sicher, daß ein Eisprung erfolgt. Wie wir vereinbart haben, wird sich Ihr Mann heute nachmittag hier einfinden, und dann nehme ich die erste künstliche Befruchtung an Ihnen vor. Die zweite erfolgt morgen, die dritte übermorgen. Möglicherweise planen wir auch noch eine vierte ein, aber das wird sich dann ergeben. Danach können Sie nach Hause gehen, und in spätestens drei bis vier Wochen wissen wir, ob es geklappt hat oder nicht.«
Gerda zögerte, stellte die Frage, die ihr am Herzen lag, aber doch. »Was glauben Sie, Herr Doktor?«
»So etwas läßt sich schwer vorhersagen, aber der Ehrlichkeit halber muß ich gestehen, daß es nur selten gleich beim ersten Mal klappt.« Er lächelte Gerda aufmunternd an. »Allerdings hatte ich auch schon solche Fälle. Sie sollten nur versuchen, sich möglichst zu entspannen.«
*
Es dauerte nicht lange, bis sich Sophie Wieland in der Waldsee-Klinik eingearbeitet hatte. Ihre Kolleginnen machten ihr das allerdings auch sehr leicht, und so konnte sie den Wutausbruch ihres Vaters, zu dem er sich am Telefon hatte hinreißen lassen, besser wegstecken. Sie war überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Was ihr weiterhin zu schaffen machte, war ihre Scheinschwangerschaft. Nahezu jeden zweiten Tag suchte sie Dr. Daniel auf, um sich eingehend mit ihm zu unterhalten. Auch Erika und Wolfgang wußten mittlerweile Bescheid und taten alles, um Sophie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.
»Feierabend«, seufzte Alexandra Keller, die Stationsschwester der Chirurgie. »Puh, das war heute mal wieder ein stressiger Tag.« Sie sah ihre Kollegin an. »Dir scheint das alles ja gar nichts auszumachen.«
Sophie zuckte die Schultern. »Gegen ein bißchen weniger Streß hätte ich auch nichts einzuwenden. Andererseits bin ich ganz froh über die viele Arbeit. Dadurch gerate ich gar nicht erst ins Grübeln.«
Alexandra zögerte. Schon oft war sie nahe daran gewesen, Sophie zu fragen, warum sie eigentlich so still und traurig war, doch im letzten Moment hatte sie jedesmal davor zurückgeschreckt. Schließlich kannte sie die junge Krankenschwester erst seit wenigen Tagen, und da gehörte es sich ihrer Meinung nach nicht, bereits so tief ins Privatleben der anderen vorzustoßen.
Auch jetzt schwieg Alexan-dra. Sie zog ihren hellblauen Kittel aus und schlüpfte in ihren sandfarbenen Bläzer.
»Gehst du nicht nach Hause?« wandte sie sich dann an Sophie.
»Ich habe noch ein bißchen was zu tun«, entgegnete sie vage, weil sie nicht verraten wollte, daß sie auf Dr. Daniel war-ten wollte. Seine Sprechstunde mußte bereits zu Ende sein, und so konnte er praktisch jede Minute hier in der Klinik auftauchen.
»Okay«, erklärte Alexandra. »Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische.«
Sophie mußte lächeln. »Hoffentlich.«
Alexandra hatte das Schwesternzimmer gerade verlassen, als Dr. Daniel hereinschaute.
»Sophie, Sie sind immer noch hier«, stellte er erstaunt fest. »Eigentlich war ich auf der Suche nach der Nachtschwester.«
»Irmgard macht gerade ihre Runde durch die Klinik«, gab Sophie Auskunft. »Sie ist vor zehn Minuten losgegangen. Es wird also noch eine Weile dauern, bis sie wieder hier ist.«
Dr. Daniel überlegte kurz. »Na ja, vielleicht begegne ich ihr ja irgendwo im Haus.«
»Herr Doktor«, meldete sich Sophie zu Wort, als er sich schon verabschieden wollte, »ich habe auf Sie gewartet.«
Mit besorgtem Blick trat Dr. Daniel nun ganz ins Zimmer und schloß die Tür hinter sich.
»Gibt es irgendwelche Probleme?«
Sophie schüttelte den Kopf. »Ich glaube, die Gespräche mit Ihnen waren erfolgreich. Meine morgendliche Übelkeit läßt inzwischen nach, und ich habe auch das Gefühl, als würde sich mein Bauch nicht mehr so aufgebläht anfühlen.«
Dr. Daniel verstand ihre Worte richtig. »Möchten Sie, daß ich Sie noch mal untersuche?«
Sophie nickte. »Das würde mich schon sehr beruhigen. Ich meine… ich habe mir eine Schwangerschaft eingebildet, vielleicht bilde ich mir das andere jetzt ja auch nur ein.«
Lächelnd schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Das glaube ich zwar nicht, aber natürlich kann ich eine Untersuchung durchführen. Wenn Sie möchten, sogar noch heute.«
»Es ist schon so spät«, wandte Sophie ein wenig halbherzig ein.
»Ach was«, wehrte Dr. Daniel ab. »Es ist gerade mal halb sieben. Ich muß nur rasch noch etwas erledigen. Bis in einer Viertelstunde kann ich drüben in der Gynäkologie sein.«
Dankbar drückte Sophie seine Hand. »Ich bin so froh, daß ich hierhergekommen bin. Alle sind so nett zu mir – vor allem Sie, und dabei kennen Sie mich ja kaum.«
»Muß man den anderen denn unbedingt gut kennen, um nett zu ihm zu sein?« fragte Dr. Daniel zurück, dann tätschelte er Sophies Hand. »Gehen Sie inzwischen schon mal hinüber. Ich komme, so schnell es geht.«
»Danke, Herr Doktor«, erwiderte sie, dann räumte sie ihre Sachen zusammen, zog den hellblauen Kittel aus und eilte mit ihrem Mantel unter dem Arm in die Gynäkologie. Sie zögerte noch einen Moment, dann machte sie sich frei. Prüfend tastete sie ihren Bauch ab. Noch immer hatte sie das Gefühl, als würde etwas in ihr heranwachsen, doch es war nicht mehr so ausgeprägt wie noch vor wenigen Wochen.
»So, hier bin ich«, erklärte Dr. Daniel, während er in den Untersuchungsraum trat und die Tür hinter sich schloß.
Sophie legte sich auf den gy-näkologischen Stuhl, und Dr. Daniel streifte sich Plastikhandschuhe über, dann trat er zu ihr und nahm eine gründliche Untersuchung vor.
»Sie haben recht, Sophie«, stellte er fest. »Die Gebärmutter hat sich bereits auf ihre fast normale Größe zurückgebildet.« Er lächelte die junge Frau an. »Ich bin froh, daß das alles problemlos gelaufen ist. Eine solche Scheinschwangerschaft kann manchmal sehr große Probleme aufwerfen, vor allem bei Frauen, die sich ganz intensiv ein Baby wünschen. Eben das war bei Ihnen ja nicht der Fall, vermutlich ging es deshalb so schnell.«
Sophie schüttelte den Kopf, während sie von dem Stuhl herunterstieg. »Ich bin überzeugt davon, daß mir die Gespräche mit Ihnen am meisten geholfen haben.« Dann senkte sie den Blick. »Nur eines habe ich immer noch nicht geschafft: Ich kann Peter nicht vergessen.«
»Lassen Sie sich Zeit«, riet Dr. Daniel ihr. »So etwas geht nicht von heute auf morgen. Vorerst sollten Sie froh sein, daß Sie Ihre Scheinschwangerschaft ohne psychiatrische Behandlung in den Griff bekommen haben. Alles andere muß, wie gesagt, die Zeit heilen.« Oder eine neue Liebe, fügte er in Gedanken hinzu, äußerte das aber nicht. Für Sophie wäre es viel zu früh, an so etwas überhaupt zu denken.
*
Allerdings war Dr. Daniel nicht der einzige, der an ein neues Liebesglück für Sophie dachte. Schwester Alexandra hatte nach Dienstschluß nichts Eiligeres zu tun gehabt, als ihre Kolleginnen anzurufen. Nun saßen sie gemeinsam in dem gemütlichen Waldcafé und schmiedeten Pläne, in deren Mittelpunkt die ahnungslose Sophie stand.
»Ich wette, sie hat Liebeskummer«, schloß Alexandra ihren Vortrag über die neue Kollegin ab.
Bianca Behrens, die Stationsschwester der Gynäkologie, nickte zustimmend. »Dieser Meinung bin ich auch. Irgend so ein mieser Kerl hat sie bestimmt sitzenlassen.«
»Ich finde, wir sollten uns da besser nicht einmischen«, meldete sich die OP-Schwester Petra Dölling zu Wort. »Sophie ist schließlich erwachsen, und es scheint, als würde sie mit ihrem Leben auch ohne unsere Hilfe ganz gut zurechtkommen.«
»Sie ist ganz unglücklich«, hielt Alexandra dagegen. »Und sie tut mir leid.«
»Leid tut sie mir auch«, räumte Petra ein. »Aber was sollen wir dagegen tun? Wenn ihr Herz noch an diesem Mann hängt – wer immer er gewesen sein mag –, dann kann doch nur die Zeit diese Wunde heilen.«
»Oder eine neue Liebe«, erklärte Bianca und sprach dabei unwissentlich aus, was Dr. Daniel auch schon gedacht hatte.
»Wir können sie doch nicht einfach verkuppeln«, erwiderte Petra energisch. »Mit wem auch?«
»Ich fürchte, das ist der wunde Punkt«, meinte Alexandra. »Die besten Männer sind doch schon vergeben.«
»Denkst du da an Dr. Daniel?« feixte Bianca.
»Quatsch!« widersprach Alexandra nachdrücklich. »Er ist zwar ein außerordentlich attraktiver Mann, aber erstens ist er glücklich verheiratet und zweitens doppelt so alt wie Sophie.«
»Entschuldigt, daß ich mich verspätet habe«, erklang in diesem Moment die Stimme der Oberschwester Lena Kaufmann. »Habe ich etwas Wichtiges versäumt?«
»Nein, das nicht«, meinte Alexandra und informierte die Oberschwester in knappen Worten, worum es bei dieser Versammlung ging.
Lena Kaufmann seufzte. »Manchmal benehmt ihr euch wirklich wie kleine Schulmäd-chen. Wenn ihr mir das am Telefon gesagt hättet, dann wäre ich gar nicht erst gekommen.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Falls Sophie tatsächlich eine herbe Enttäuschung erlebt hat, ist es bestimmt nicht unsere Sache, uns da einzumischen.«
»Wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie sie immer deprimierter wird«, wandte Bianca ein und appellierte damit an Lenas weiches Herz, das sie gern hinter ihrer nur vordergründig rauhen Schale verbarg.
»Erst heute hat sie gesagt, daß sie froh ist über die viele Arbeit, weil sie dann nicht so viel grübeln kann«, fügte Alexandra hinzu. »Im übrigen wollen wir sie ja nicht gleich verkuppeln.« Sie sah Bianca und Petra an, ehe sie sich Lena wieder zuwandte. »Es würde ihr vielleicht schon guttun, mal von einem netten jungen Mann zu einer Tasse Kaffee eingeladen zu werden – ohne irgendeinen Hintergedanken.«
»Die Hintergedanken macht ihr euch schon«, vermutete Lena, mußte dabei aber lächeln. Im Grunde freute es sie ja, daß sich die Schwestern so viele Gedanken um die neue Kollegin machten. Und es stand außer Frage, daß sie es nur gut meinten.
Alexandra faßte das Lächeln der Oberschwester jedenfalls als Zustimmung auf.
»Also, dann würde ich sagen, wir stellen unser Vorhaben unter ein besonderes Motto.« Sie überlegte kurz. »Traumtyp für Schwester Sophie gesucht.«
»Und wie soll dieser Traumtyp aussehen?« fragte Lena noch immer leicht amüsiert. Sie bezweifelte ganz entschieden, daß die Bemühungen der jungen Schwestern letztlich von Erfolg gekrönt sein würden. Wenn Sophie auch nur halb so schwer enttäuscht worden war, wie es den Anschein hatte, würde sie nicht so rasch wieder an einem Mann Gefallen finden – noch dazu an einem, den andere für sie ausgesucht hatten.
»Genau da liegt das Problem«, räumte Alexandra ein. »Die besten Männer sind immer schon vergeben.«
»Wie wär’s mit Dr. Parker?« warf Bianca dazwischen. »Er sieht gut aus und ist ein unheimlich netter Mann. Darüber hinaus würde er sich bei seinen ausgezeichneten Fähigkeiten als Karate-Kämpfer auch als Beschützer für Sophie eignen.«
»Dr. Parker hat noch nie an einer Frau Interesse gezeigt«, wandte Petra Dölling ein. »Ich glaube, er hat auch schon eine große Enttäuschung erlebt. Soviel ich gehört habe, soll er in den Staaten verlobt gewesen sein.«
»Na, dann würden sie ja ausgezeichnet zusammenpassen«, urteilte Alexandra eifrig. »Geteiltes Leid ist halbes Leid.« Entschlossen rührte sie in ihrem Kaffee. »Ich werde den guten Parker morgen gleich mal drauf ansprechen. In aller Diskretion, versteht sich«, fügte sie mit einem Seitenblick zur Oberschwester hinzu.
Lena Kaufmann schmunzelte. »Na, dann viel Erfolg.«
*
Schwester Alexandra wartete am nächsten Morgen, bis Chefarzt und Oberarzt bei der Visite waren, dann betrat sie das Ärztezimmer, wo Dr. Jeffrey Parker am Schreibtisch saß und eine Krankenakte studierte.
»Soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee bringen?« wollte Alexandra wissen. Sie hatte lange hin und her überlegt, wie sie den jungen Anästhesisten dazu bringen sollte, mit Sophie auszugehen, doch die zündende Idee, auf die sie gewartet hatte, war ihr noch nicht gekommen, und so hoffte sie, daß sich im Laufe eines harmlosen Gesprächs etwas ergeben würde, wo sie einhaken könnte.
Dr. Parker schmunzelte. »Schwester Alexandra, Sie wissen doch ganz genau, daß ich keinen Kaffee trinke, weil mein Magen, der um diese Zeit grundsätzlich noch leer ist, heftig rebelliert, wenn ich ihn mit Koffein abfüttere.«
Alexandra errötete. Natürlich wußte sie das, aber wie hätte sie das Gespräch sonst beginnen sollen?
»Also, Schwesterlein, raus mit der Sprache«, fuhr Dr. Parker in neckischem Ton fort. »Was wollen Sie wirklich von mir?«
»Na ja, ich meine… das heißt, wir alle haben uns Gedanken gemacht…«, begann Alexandra stockend, dann platzte sie heraus. »Es geht um Schwester Sophie.«
Der junge Anästhesist lächelte in dieser sympathischen, lausbubenhaften Art.
»Meine liebe Alexandra, das hört sich ja fast nach Verkuppeln an«, stellte er fest.
Die Krankenschwester errötete bis unter die Haarwurzeln.
»Nein, natürlich nicht«, stammelte sie verlegen. »Es ist doch nur… Sophie ist so traurig, und sie scheint sehr einsam zu sein, und da dachten wir… es wäre für sie vielleicht ganz schön, mal eingeladen zu werden…« Noch während sie das sagte, wäre sie am liebsten im Erboden versunken. Welcher Teufel hatte sie nur geritten, als sie beschlossen hatte, dieses Gespräch mit Dr. Parker zu führen. Gleichgültig, wie sie ihre Worte vorbrachte – es hörte sich immer nach Verkuppeln an, und Alexandra hätte sich ohrfeigen können, daß sie auf diese hirnverbrannte Idee gekommen war. Wie sollte sie sich jetzt aus der Affäre ziehen, ohne sich bis auf die Knochen zu blamieren – wenn das nicht schon passiert war.
Dr. Parker bemerkte natürlich, was in ihr vorging.
»Ich finde es sehr nett, daß Sie sich um Ihre Kollegin solche Gedanken machen«, meinte er. »Deswegen müssen Sie sich auch ganz bestimmt nicht schämen.«
»Das ist es ja gar nicht«, murmelte Alexandra mit gesenktem Kopf. »Es ist vielmehr…« Sie stockte.
Da stand Dr. Parker auf und legte freundschaftlich einen Arm um ihre Schultern. »Ich weiß schon, Alexandra.« Er lä-chelte. »Aber es ist ja ein großes Kompliment für mich, daß Sie da an mich gedacht haben. Glauben Sie tatsächlich, Schwester Sophie würde mit mir ausgehen wollen?«
»Warum nicht?« entgegnete Alexandra sofort. »Sie sind nett, sehen gut aus…« Verlegen senkte sie den Kopf. Das hatte sie doch gar nicht sagen wollen.
»Sprechen Sie ruhig weiter, Alexandra«, bat Dr. Parker. »Von derartigen Komplimenten kann ich gar nicht genug bekommen.«
»Ich glaube, ich gehe jetzt lieber wieder an meine Arbeit«, murmelte Alexandra und machte, daß sie aus dem Zimmer kam, bevor ihr noch weitere unbedachte Worte herausrutschten.
Dr. Parker wartete, bis sie draußen war, dann schüttelte er lachend den Kopf. Alexandras Bemühungen, ihn mit Sophie zu verkuppeln, amüsierten ihn. Doch als er der jungen Schwester später begegnete, fielen ihm unwillkürlich Alexandras Worte wieder ein. »Sophie ist so traurig, und sie scheint sehr einsam zu sein…«
»Ist etwas nicht in Ordnung, Herr Doktor?« fragte Sophie, weil sie Dr. Parkers prüfenden Blick bemerkte.
»Doch, ich habe nur gerade überlegt… wann haben Sie denn heute Dienstschluß?« wollte der junge Anästhesist wissen.
Sophie war so verblüfft, daß sie im ersten Moment keinen Ton hervorbrachte.
»Um sechs«, antwortete sie schließlich.
»Das paßt ja ausgezeichnet«, urteilte Dr. Parker. »Haben Sie Lust, mich in die gemütliche Weinstube am Ortsrand von Steinhausen zu begleiten?«
Aus großen Augen starrte Sophie ihn an. »Sie… laden mich ein?«
»Ja, wenn ich darf.« Er grinste. »Ich bin auch ganz bestimmt kein Unhold.«
Sophe mußte lachen. »Das glaube ich Ihnen unbesehen, Herr Doktor.« Sie zögerte, dann nickte sie. »Ich nehme Ihre Einladung gern an.«
*
In der Kleinen Reblaus
herrschte wieder einmal Hochbetrieb, trotzdem gelang es Dr. Parker und Sophie, einen ruhigen Nischentisch zu ergattern.
»Darf ich für Sie mitbestellen?« fragte Dr. Parker, als er sah, wie Sophie ratlos die Karte anschaute.
Sie lächelte entschuldigend. »Ich bin leider keine große Weinkennerin.«
»Ich dafür um so mehr. Ich stamme aus Kalifornien, und meine Eltern hatten dort ein kleines Weingut.« Er lächelte. »Der kalifornische Wein, den meine Eltern herstellten, hatte Ähnlichkeit mit einem Bor-
deaux – nur war er sehr viel besser.«
»Kalifornien«, wiederholte Sophie, und ihre Stimme bekam dabei einen schwärmerischen Klang. »Dort muß es sehr schön sein.« Sie sah Dr. Parker an. »Warum sind Sie von da weggegangen?«
Eine leichte Melancholie huschte über das Gesicht des Arztes. »Das hatte persönliche Gründe, über die ich eigentlich nicht sprechen möchte. Es ist noch zu schmerzlich.«
Sophie errötete ein wenig. »Es tut mir leid, Herr Doktor. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
Dr. Parker zwang sich zu
einem Lächeln. »Halb so schlimm, Sophie. Schließlich konnten Sie das nicht wissen.«
Der Ober, der jetzt an den Tisch trat, unterbrach das Gespräch, und beide waren froh darüber. Dr. Parker gab die Bestellung auf, dann wandte er sich Sophie wieder zu.
»Ich hoffe, daß ich den richtigen Wein für Sie ausgewählt habe«, meinte er lächelnd.
»Bestimmt«, entgegnete Sophie, dann zuckte sie bedauernd die Schultern. »Es fragte sich nur, ob ich Ihre Wahl auch gebührend schätzen kann.«
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen, dann raffte sich Sophie zu der Frage auf, die sie seit der Einladung Dr. Parkers beschäftigte.
»Seit ich in der Waldsee-Klinik arbeite, waren Sie immer nett und freundlich zu mir, aber nie habe ich bemerkt, daß Sie… nun ja, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll…« Sie schwieg kurz. »Ihre Einladung hat mich sehr überrascht.«
Dr. Parker schmunzelte. »Das glaube ich Ihnen, und ich weiß auch nicht genau, ob ich Ihnen die Wahrheit sagen sollte.«
Erstaunt sah Sophie ihn an. Mit einer solchen Antwort hatte sie nun nicht gerade gerechnet.
»Die Wahrheit?« wiederholte sie. »Wie soll ich das verstehen?«
Dr. Parker seufzte. »Ich fürchte, ich muß tatsächlich Farbe bekennen, aber bitte, Sophie, verraten Sie mich nicht. Ich glaube, Ihre Kolleginnen wären sehr enttäuscht, wenn ihr Spielchen mißlingen würde.«
Sophie verstand immer weniger, doch Dr. Parker spannte sie nun nicht mehr länger auf die Folter.
»Ihre Kolleginnen machen sich große Sorgen um Sie«, fuhr er fort. »Sie sehen immer so traurig aus, und da haben die anderen Schwestern wohl gedacht, man müßte Sie irgendwie aufmuntern. Jedenfalls kam Alexandra heute zu mir und hat mich mehr oder weniger durch die Blume gefragt, ob ich mit Ihnen ausgehen möchte.«
Sophie errötete, dann stand sie auf. »Wenn das so ist…«
Auch Dr. Parker erhob sich, hielt die junge Frau aber an der Hand fest. »Es ist nicht so, wie Sie jetzt denken, Sophie. Wenn ich mit Ihnen nicht hätte ausgehen wollen, dann hätte ich es auch nicht getan.«
Sophie zögerte, dann setzte sie sich wieder. »Was heißt das nun wieder? Sind Sie… ich meine… wenn Sie für mich mehr als nur Sympathie empfinden würden… ich glaube, ich müßte Sie enttäuschen.«
Dr. Parker lächelte. »Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Sophie. Ich weiß, daß ich nicht Ihr Traummann bin. Da hätten Sie mich mit ganz anderen Blicken bedacht. Im übrigen bin ich noch nicht bereit für eine neue Beziehung.«
Teilsnahmsvoll sah Sophie ihn an. »Haben Sie auch eine Enttäuschung erlebt?«
Dr. Parker atmete tief durch, doch der Schmerz, der durch sein Herz zog, ließ sich nicht beseitigen.
»Meine Verlobte kam bei einem Unfall ums Leben«, gestand er leise.
Sophie war zutiefst betroffen. Jetzt verstand sie, weshalb er Kalifornien verlassen hatte, und sie wußte auch, was er gemeint hatte, als er gesagt hatte, es wäre zu schmerzlich für ihn, um drüber zu sprechen.
»Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, nun habe ich es doch getan«, sagte Sophie .
Dr. Parker schüttelte nur den Kopf. In diesem Moment war von dem scheinbar unbeschwerten jungen Mann mit seinem oft so lausbubenhaften Lächeln nichts mehr zu erkennen.
Spontan legte Sophie eine Hand auf seinen Arm. »Vielleicht war Alexandras Verkupplungsversuch doch für etwas gut. Zum einen habe ich gesehen, daß nicht nur ich Probleme habe, und zum anderen… glauben Sie, daß es zwischen einem Arzt und einer Krankenschwester auch eine ganz harmlose Freundschaft geben könnte?«
»Ja, Sophie, da bin ich sicher«, erklärte Dr. Parker warm. Seine Stimme klang dabei allerdings noch immer ein wenig rauh – ein sicheres Zeichen für Sophie, daß sein Aufenthalt in der Waldsee-Klinik nichts anderes als eine Flucht war… genauso wie bei ihr.
»Ich denke, wir haben gut daran getan, hierher zu kommen«, stellte sie aus diesen Gedanken heraus fest.
Dr. Parker nickte. »Ja, hier fühlte ich mich von Anfang an wie zu Hause.« Unwillkürlich mußte er daran denken, wie Karina, die Tochter Dr. Daniels, ihn schon beinahe gezwungen hatte, sich die Waldsee-Klinik anzusehen. Es war im übertragenen Sinne Liebe auf den ersten Blick gewesen, und er hatte es nie bereut, daß er angefangen hatte hier zu arbeiten.
»Ich fühle mich sogar besser als zu Hause«, gab Sophie zu. »Mein Vater hat kein Verständnis für meine Probleme. Er ist der Meinung, Liebeskummer müsse man einfach so wegstecken.« Traurig senkte sie den Kopf. »Aber ich kann Peter nicht vergessen, vielleicht werde ich es sogar nie können.«
*
Sophie und Dr. Parker genossen den gemeinsamen Abend. Sie waren beide sicher, daß zwischen ihnen nie eine Liebe wachsen würde, aber sie
verstanden sich gut und konnten über beinahe alles mitein-ander sprechen. So ging es bereits auf Mitternacht, als Dr. Parker die junge Frau vor dem Haus von Dr. Metzler absetz-
te.
»Vielleicht sollten wir das
bei Gelegenheit wiederholen«, schlug Dr. Parker vor, dann lächelte er. »Auf diese Weise hätten Alexandra & Co. auch ein Erfolgserlebnis.«
Auch Sophie lächelte. »Im ersten Moment war ich ärgerlich, aber jetzt… irgendwie ist es rührend, wie besorgt sie alle um mich sind.«
Dr. Parker nickte. »Das finde ich auch. Ich bin allerdings nicht überzeugt, ob ich wirklich der Traumtyp wäre, den sie Ihnen zugedacht hatten.«
Sophie schmunzelte. »Sie wollen jetzt nur ein Kompliment hören.« Dann wurde sie ernst. »Ich könnte mir schon vorstellen, daß so manche junge Frau von Ihnen träumt.« Sie lächelte wieder. »Und das sage ich sogar auf die Gefahr hin, daß Sie sich darauf etwas einbilden werden.«
»Bestimmt nicht«, versicherte Dr. Parker lachend. »Und ich halte es für ein Gerücht, daß es eine Frau gibt, die von mir träumen könnte.«
Sophie konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Ich glaube, wir sollten dieses Thema jetzt nicht vertiefen. Es ist spät, und morgen früh müssen wir beide wieder zum Dienst – nach Möglichkeit ausgeruht.«
»Dazu haben wir nicht mehr viel Zeit.« Er küßte Sophie freundschaftlich auf die Wange. »Gute Nacht. Und danke für den schönen Abend.«
»Diesen Dank kann ich nur zurückgeben«, erwiderte sie, dann stieg sie aus und winkte Dr. Parker noch einmal zu, bevor sie leise das Haus betrat. Sie wollte ihre Tante und ihren Onkel nicht wecken.
»Du kommst ziemlich spät.«
Sophie erschrak, als hinter ihr so unerwartet Erikas Stimme erklang.
»Ich bin nicht aufgeblieben, um dich zu kontrollieren«, stellte Erika gleich richtig. »Aber ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
Sophie lächelte. »Völlig un-nötig, Tante Erika. Ich war mit Dr. Parker in der Kleinen Reblaus.«
Aufmerksam sah Erika sie an. »Ist er die Lösung für deine Probleme?«
Da schüttelte Sophie den Kopf. »Er ist unheimlich lieb, und fast könnte ich die Frau beneiden, die ihn einmal zum Mann bekommen wird, aber… ich liebe ihn nicht, und bei ihm ist es genauso. Wir haben uns blendend unterhalten, und vielleicht werden wir auch mal wieder einen gemeinsamen Abend verbringen – aber nicht mehr. Dazu sind wir beide noch nicht bereit, und ich bin nicht sicher, ob es für mich überhaupt jemals wieder einen Mann geben wird. Das mit Peter sitzt einfach noch zu tief. Manchmal denke ich, es wird nie mehr anders werden.«
Tröstend legte Erika einen Arm um die Schultern ihrer Nichte. »Sag das nicht, Sophie. Du bist noch so jung. Ich bin sicher, daß dir eines Tages die Liebe wiederbegegnen wird.«
*
Völlig aufgelöst kam Gerda Rauh zu Dr. Daniel in die Sprechstunde.
»Ich habe meine Tage bekommen«, stieß sie hervor, dann brach sie in Tränen aus. »Muß ich das Ganze denn jetzt noch mal über mich ergehen lassen?« Verzweifelt sah sie Dr. Daniel an. »Die künstliche Befruchtung an sich wäre ja gar nicht so schlimm, aber das schreckliche Warten hinterher…«
Dr. Daniel nickte verständnisvoll. »Ich kann mir vorstellen, wie belastend das ist, und ich will auch ganz ehrlich sein: Bei dem geringen Anteil an Samenfäden, über die Ihr Mann verfügt, halte ich einen weiteren Versuch fast für aussichtslos.« Er schwieg kurz. »Wissen Sie, bei der Untersuchung wurde das zwar nicht so deutlich, aber an den drei Tagen, an denen wir die künstliche Befruchtung durchgeführt haben… beim letzten Mal war es tatsächlich so wenig Sperma, daß ich schon dachte, ich könnte die dritte Befruchtung gar nicht mehr vornehmen.«
Mit einer fahrigen Handbewegung strich Gerda ihr dichtes Haar zurück. »Das heißt, daß wir sowieso aufgeben müssen.«
Dr. Daniel zögerte und betrachtete die junge Frau vor sich sehr genau. Konnte er es wagen, ihr seinen Vorschlag zu unterbreiten?
»Es gäbe noch eine Möglichkeit«, erklärte er schließlich. »Allerdings wäre die Wartezeit dabei nicht weniger belastend – die Chance einer Schwangerschaft jedoch weitaus höher. Das Verfahren wurde in Austrahlien entwickelt, und es gibt nicht viele Kliniken, die nach dieser Methode arbeiten, aber mein Freund und Kollege Dr. Georg Sommer führt diese Art der Befruchtung in seiner Klinik durch.«
Neugierig sah Gerda den Arzt an. »Was ist das für ein Verfahren?«
»Man bezeichnet es als Tubal Sperm-Egg Transfer, abgekürzt TSET. Dabei bekommt die Frau Medikamente, die die Eireifung stimulieren, damit mehrere Ei-bläschen heranreifen. Unter Vollnarkose werden mit Hilfe einer Laparoskopie… einer Bauchspiegelung die Eier angesagt und mit den Spermien im Eileiter zusammengebracht. Im Prinzip ähnelt dieses Verfahren einer Befruchtung in der Retorte… also im Reagenzglas, nur mit dem Unterschied, daß die Eier nicht außerhalb des Körpers befruchtet werden, sondern wie bei einer normalen Empfängnis im Eileiter.«
Nachdenklich blickte Gerda vor sich hin, dann sah sie Dr. Daniel an. »Und Sie glauben, das könnte bei mir funktionieren?«
»Sagen wir mal so, einen Versuch wäre es zumindest wert. Allerdings sollten Sie schon vorher wissen, daß Sie dabei auch mit einer Mehrlingsschwangerschaft rechnen müssen – das bedeutet, daß Sie bei dieser Methode durchaus Zwillinge oder sogar Drillinge bekommen könnten.«
Im ersten Moment erschrak Gerda, doch dann freundete sie sich mit dem Gedanken an.
»Wir wollten ja eigentlich mehr Kinder… wenn auch nicht auf einmal«, meinte sie. »Aber da es für mich ohnehin so schwierig ist, schwanger zu werden, wäre eine solche Lösung wohl nicht einmal die schlechteste.«
Dr. Daniel nickte. »Im übrigen müssen Sie das natürlich nicht hier und jetzt entscheiden. Unterhalten Sie sich in Ruhe mit Ihrem Mann darüber. Ich bin auch gern bereit, mit Ihnen beiden das Ganze noch einmal zu besprechen.«
Gerda nickte. »Ich werde mit Ferdinand reden, und falls wir Fragen haben, werden wir uns an Sie wenden.«
»Tun Sie das.« Dr. Daniel reichte ihr die Hand und lächelte sie an. »Ich glaube, mit dieser Methode wäre Ihnen mehr gedient als mit einer weiteren künstlichen Befruchtung.«
*
Der ungewöhnlich laue
Herbstabend lud zu einem Spaziergang ein. Langsam schlenderte Sophie durch den Klinikpark hinunter zum Waldsee, der im Licht der tiefstehenden Sonne zwischen den Bäumen glitzerte, als wäre er mit Diamanten übersät.
Sophie ließ sich am Ufer nieder und schlang ihre Arme um die angezogenen Beine. Als sie über den idyllischen See blickte, bekam sie Lust zu einem abendlichen Bad, doch mittlerweile wußte sie, daß das ein mehr als zweifelhaftes Vergnügen wäre, denn der Waldsee wurde von einer eisigen Bergquelle gespeist. Nicht einmal im Hochsommer stieg seine Wassertemperatur auf mehr als zehn Grad an.
Sophie schloß die Augen. Nur das leise Rauschen der Tannen drang an ihr Ohr, bevor es plötzlich von einem kläglichen Maunzen unterbrochen wurde.
Abrupt richtete sich Sophie auf und blickte sich um, doch sie konnte nichts entdecken. Angestrengt lauschte sie, und da hörte sie es wieder. Sophie stand auf und folgte dem eigentümlichen Geräusch. Es dauerte eine Weile, bis sie fand, wonach sie suchte. Das klägliche Maunzen erfolgte von einem kleinen Kätzchen, das am Fuß einer mächtigen Tanne im Moos lag.
Spontan bückte sich Sophie und streichelte über das struppige, getigerte Fell.
»Na, kleine Minka«, sprach sie das Kätzchen leise an. »Oder bist du womöglich ein Micky?«
Das Kätzchen miaute jämmerlich, und in diesem Moment entdeckte Sophie die vielen kleinen Verletzungen, die zum Teil sogar noch bluteten. Rasch, aber dennoch sehr vorsichtig, nahm sie das Kätzchen auf den Arm und eilte den Waldweg entlang bis zu Dr. Daniels Praxis. Sie erreichte den Arzt gerade noch, bevor er zur Waldsee-Klinik fuhr.
»Herr Doktor, ich habe dieses Kätzchen im Wald gefunden!« rief sie schon von weitem. »Es ist verletzt!«
Dr. Daniel lief ihr entgegen und betrachtete besorgt die teils verkrusteten, teils noch blutenden Wunden des kleinen Tierchens, dann zuckte er bedauernd die Schultern.
»Ich fürchte, damit bin ich überfordert«, gestand er. »Aber ich fahre Sie rasch zu Dr. Sattler.«
Es dauerte knapp zehn Minuten, bis sie die Tierarztpraxis am Ortsrand von Steinhausen erreichten.
»Soll ich mit hineingehen?« fragte Dr. Daniel. »Dr. Sattler ist manchmal ein wenig ruppig und unfreundlich.«
Doch Sophie schüttelte den Kopf. »Sie haben sicher noch genug andere Arbeit. ich werde mit dem Herrn schon klarkommen. Im übrigen soll er sich ja nicht um mich, sondern um das Kätzchen kümmern.« Sie lä-chelte Dr. Daniel an. »Danke fürs Herfahren.«
Dann stieg sie aus und ging raschen Schrittes zu der schweren Eingangstür aus dunklem Holz. Unwillkürlich zögerte Sophie, bevor sie auf den Klingelknopf drückte. Das ganze Haus machte irgendwie einen abweisenden, fast drohenden Eindruck auf sie. Sophie schüttelte diesen Gedanken ab. Wahrscheinlich rührte ihr ungutes Gefühl nur daher, daß Dr. Daniel diese Bemerkung über den Tierarzt gemacht hatte.
In diesem Moment wurde die Tür so heftig aufgerissen,
daß Sophie erschrocken einen Schritt zurückwich. Vor ihr stand ein großer, stattlicher Mann. Er sah umwerfend gut aus, doch der ernste Ausdruck auf dem markanten Gesicht wirkte nahezu furchteinflößend. Der eisige Blick jagte Sophie einen Schauer über den Rücken.
»Guten Abend«, stammelte sie unsicher. »Ich… ich habe dieses Kätzchen gefunden…«
Ohne ein Wort, aber mit erstaunlicher Behutsamkeit, nahm der Mann das verletzte Kätzchen auf den Arm.
»Na, mein Kleines, was hast du denn angestellt?« fragte er das Tierchen, und der sanfte Ton stand in krassem Gegensatz zu seinem noch immer ernsten Gesicht.
Fasziniert betrachtete Sophie ihn. Der krasse Gegensatz zwischen Aussehen und Wesen dieses Mannes zog sie unwillkürlich in seinen Bann.
Das Kätzchen, das zuvor noch ängstlich gemaunzt hatte, war jetzt still. Es schien zu spüren, daß dieser Mann seinem bedrohlichen Äußeren zum Trotz ein durch und durch guter Mensch war.
Mit leiser Bewunderung sah Sophie zu, wie der junge Tierarzt rasch und geschickt die Verletzungen des Kätzchens versorgte, dann legte er es wieder in ihre Arme.
»Kommen Sie morgen noch mal her«, erklärte er, und dabei klang seine Stimme wieder barsch und unfreundlich.
Bedauernd blickte Sophie auf das kleine Tierchen hinunter, das sich in ihre Arme schmiegte.
»Ich kann es nicht mit nach Hause nehmen«, entgegnete sie leise, dann blickte sie auf. »Ich wohne im Haus meiner Tante, mein kleiner Neffe hat eine Katzenhaarallergie.« Sie zögerte, weil es ihr schwerfiel, diesen unnahbar wirkenden Mann um etwas zu bitten. »Könnte das Kätzchen nicht hierblieben? Zumindest so lange, bis ich eine eigene Wohnung gefunden habe?«
»Ich habe hier kein Tierheim!« herrschte er sie an.
»Herr Dr. Sattler, bitte…«, begann Sophie, doch als der Mann einen Schritt in ihre Richtung machte, wich sie unwillkürlich zurück. Doch er nahm ihr nur das Kätzchen ab.
»Gehen Sie!« verlangte er barsch.
Sophie zögerte. Sie wollte fragen, ob sie das Kätzchen besuchen dürfte… ob sie es abholen könnte, wenn sie eine Wohnung gefunden hätte, doch sie wagte nicht, den Mann noch einmal anzusprechen.
»Danke«, murmelte sie nur, dann verließ sie die Tierarztpraxis. Draußen atmete sie erst einmal tief durch, und dabei fiel ihr ein, daß er für die Behandlung des Kätzchens gar nichts verlangt hatte. Sophie blickte zu der geschlossenen Tür zurück, doch allein der Gedanke, die Praxis noch einmal zu betreten, flößte ihr Angst ein.
Trotzdem ging ihr der junge Mann nicht mehr aus dem Kopf. Jede Bewegung, jedes Wort, das er gesprochen hatte, ließ sie in Gedanken noch einmal in sich nachklingen. Dr. Daniel hatte nicht übertrieben. Dieser Dr. Sattler war ruppig… nein, er war richtig grob gewesen – zu ihr. Das Kätzchen dagegen hatte er sanft und liebevoll behandelt.
»Was für ein faszinierender Mann«, murmelte Sophie vor sich hin, und dabei wurde ihr bewußt, daß sie seit Betreten der Tierarztpraxis nicht mehr an Peter gedacht hatte. Bisher hatte sie der Gedanke an ihn praktisch ständig begleitet – sogar bei der Arbeit. Doch die Begegnung mit Dr. Sattler war für sie ein so einschneidendes Erlebnis gewesen, daß für Peter kein Platz mehr in ihrem Kopf gewesen war.
Ohne genau zu wissen weshalb, lenkte Sophie ihre Schritte zu Dr. Daniels Praxis. Sein Auto stand vor der Garage, also mußte er in der Waldsee-Klinik schon fertig sein. Trotzdem zögerte Sophie, bevor sie auf den Klingelknopf drückte. Konnte sie den vielbeschäftigten Arzt um diese Zeit noch stören? Sicher, in den letzten Wochen hatten sie viele Gespräche miteinander geführt, dennoch war sie doch eigentlich nicht mehr als eine Patientin.
Schließlich drückte Sophie trotzdem den Klingelknopf neben dem Schildchen Privat, und es dauerte nur wenige Minuten, bis Dr. Daniel ihr öffnete. Er bedachte sie mit einem prüfenden Blick.
»Mir scheint, Dr. Sattler hat Sie ein wenig erschreckt«, stellte er fest.
»Nicht nur ein wenig«, gestand Sophie. »Er ist ein sehr… außergewöhnlicher Mensch.«
Dr. Daniel ließ Sophie eintreten. »Gehen wir in die Praxis, da können wir uns ungestört unterhalten.« Er wartete, bis die junge Frau im Sprechzimmer Platz genommen hatte. »Haymo hat Sie anscheinend nicht nur erschreckt, sondern auch fasziniert.«
»Haymo«, wiederholte Sophie gedankenvoll. Sie schwieg einen Moment, dann sah sie Dr. Daniel an. »Warum ist er so… so barsch und unfreundlich?«
»Er spricht nicht über seine Vergangenheit«, antwortete Dr. Daniel. »Aber ich fürchte, er hat eine Menge mitgemacht. Wahrscheinlich gibt er sich nur aus diesem Grund so unnahbar. Er scheint entsetzliche Angst davor zu haben, seine Gefühle zu zeigen.«
Sophie senkte den Kopf.
»Das ist sehr schade«, flüsterte sie und konnte sich dabei das eigenartige Gefühl, das sie bei dem Gedanken an Haymo Sattler ergriff, gar nicht so recht erklären.
*
Gerda und Ferdinand Rauh brauchten nur wenige Tage, um sich zu entscheiden.
»Wir möchten diese neue Methode, von der Sie gesprochen haben, versuchen«, erklärte Gerda, als sie und ihr Mann zu Dr. Daniel in die Sprechstunde kamen. Das junge Ehepaar tauschte einen Blick, dann fügte Gerda hinzu: »Das wird dann aber unser letzter Versuch sein. Wir wollen nicht, daß unsere Ehe in die Brüche geht, weil wir uns in dem Bemühen um ein eigenes Kind nicht mehr darauf besinnen können, daß es zwischen uns auch noch – Liebe gibt.«
Dr. Daniel nickte. »Das ist eine gute Einstellung, und ich habe Ihnen ja von Anfang an gesagt, daß Sie beide sich darüber einig sein müssen, wie weit Sie gehen wollen.«
»Wie groß ist das Risiko für meine Frau?« wollte Ferdinand wissen. »Ich meine… unter einer Bauchspiegelung kann ich mir nicht viel vorstellen.«
»Ein solcher Eingriff wird in Vollnarkose durchgeführt«, erklärte Dr. Daniel. »Es wird ein kleiner Schnitt direkt unterhalb des Bauchnabels gemacht, durch den über eine Hohlnadel Gas in den Bauch gepumpt wird. Dieses Gas ist vollkommen unschädlich und dient nur dazu, daß man über das Laparoskop die Organe besser sehen kann. Durch einen zweiten, noch kleineren Schnitt über der Schamhaargrenze werden die nötigen Instrumente eingeführt. Alles in allem ist das Risiko weitaus geringer als bei einer normalen Operation mit Bauchschnitt. Das übliche Restrisiko durch die Narkose bleibt natürlich bestehen, aber damit hatte Ihre Frau auch bei der Notoperation, die ich vor fast einem Jahr durchgeführt habe, keine Probleme. Ich glaube nicht, daß Sie sich allzu große Sorgen machen müssen.« Er wandte sich Gerda zu. »Für Sie werden die ersten Tage nach dem Eingriff natürlich beschwerlich sein, weil das Gas, das wir in Ihren Bauch pumpen, nur ganz allmählich entweichen kann. Sie werden also noch eine Weile Schmerzen in der Schulter haben, die mit einem starken Muskelkater vergleichbar sind.«
Gerda runzelte die Stirn. »Warum in der Schulter, wenn Sie im Bauch arbeiten?«
Dr. Daniel lächelte. »Das werde ich in diesem Zusammenhang fast immer gefragt.« Dann erklärte er Gerda sehr ausführlich, womit diese Beschwerden im einzelnen zusammenhingen.
»Sind nun alle Fragen geklärt, oder haben Sie noch etwas auf dem Herzen?« wollte er zum Abschluß wissen.
Gerda seufzte. »Ich glaube, wenn ich nicht mehr soviel frage, ist es besser für mich. Allmählich schwirrt mir tatsächlich schon der Kopf.«
»Das glaube ich Ihnen«, meinte Dr. Daniel, dann griff er nach dem Telefonhörer. »Ich werde jetzt gleich einen Termin mit Dr. Sommer vereinbaren.« Er wählte eine Münchener Nummer, wartete, bis die Verbindung hergestellt war, und ließ sich dann mit dem Chefarzt verbinden.
»Grüß dich, Schorsch, ich bin’s«, gab er sich zu erkennen, als sich Dr. Georg Sommer gemeldet hatte.
»Robert, altes Haus!« rief sein Freund erfreut. »Na, wie fühlt man sich als Ehemann und Vater einer Fünfjährigen?«
»Blendend«, antwortete Dr. Daniel. Bei dem Gedanken an Manon und Tessa huschte ein zärtliches Lächeln über sein Gesicht, doch dann besann er sich wieder auf den eigentlichen Grund seines Anrufs. »So schwer es mir fällt, das einzugestehen, ich rufe nicht zu meinem Vergnügen an.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, entgegnete Dr. Sommer trocken. »Wann hast mich jemals rein privat angerufen? Also, du Quälgeist, was willst du nun schon wieder von mir?«
»Ich habe hier ein Ehepaar, das bei dir einen TSET machen lassen möchte«, erklärte Dr. Daniel ohne Umschweife. »Wann hast du einen Termin frei?«
»Das kommt darauf an«, entgegnete Dr. Sommer. »Wann hatte die Frau zuletzt ihre Tage?«
Dr. Daniel nannte das Datum, dann fügte er hinzu: »Sie hat einen unregelmäßigen Eisprung.«
Eine Weile herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung, weil Dr. Sommer offenbar den günstigsten Zeitpunkt für die Durchführung des TSET berechnete.
»Deine Patientin kann nächsten Dienstag kommen«, erklärte er schließlich. »Ich nehme an, daß du ihr schon alles ausführlich erklärt hast.«
»Natürlich«, erwiderte Dr. Daniel, dann lächelte er das Ehepaar Rauh an. »Möglicherweise werden bis zum Termin allerdings noch ein paar neue Fragen auftauchen.«
»Das ist klar«, meinte Dr. Sommer. »Aber du kennst mich ja und weißt, daß ich vor jedem Eingriff ein eingehendes Gespräch mit meinen Patienten führe.« Er schwieg kurz. »Begleitest du das Ehepaar in die Klinik?«
»Ja, wenn nichts Unvorher-gesehenes dazwischenkommt«, antwortete Dr. Daniel »Wir sehen uns also dann höchstwahrscheinlich am nächsten Dienstag.«
»Ja, Robert, ich freue mich.«
Die Freunde verabschiedeten sich sehr herzlich voneinander, dann legte Dr. Daniel auf und wandte sich dem Ehepaar Rauh wieder zu.
»Am nächsten Dienstag haben Sie einen Termin in der Klinik.« Er lächelte die beiden beruhigend an. »Dr. Sommer wird sich vor dem nötigen Eingriff selbstverständlich noch Zeit nehmen, um sich eingehend mit Ihnen zu unterhalten und eventuell noch offene Fragen zu beantworten. Wenn mir Praxis und Klinik Zeit lassen, werde ich Sie gern nach München begleiten.«
»Das ist wirklich nicht nötig, Herr Doktor«, entgegnete Gerda, und ihr Mann stimmte zu.
»Sie müssen wegen uns keine Umstände machen«, meinte er.
»Das sind keine Umstände«, entgegnete Dr. Daniel schlicht. »Wissen Sie, die Sorge um meine Patienten endet bei mir nicht hinter der Praxistür. Allerdings kann ich Ihnen trotzdem nichts versprechen, denn es könnte
ein Notfall dazwischenkommen. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag.«
Gerda und Ferdinand verabschiedeten sich von Dr. Daniel, dann verließen sie die Praxis.
»Er ist ein erstklassiger Arzt und ein wundervoller Mensch«, urteilte Gerda. »Ich bin heilfroh, bei ihm in Behandlung zu sein.«
*
In dem keinen, gemütlichen Wohnzimmer brannte kein Licht, nur die untergehende Sonne verbreitete noch etwas Helligkeit. Doch der junge Mann, der auf dem Sofa saß und vor sich hin starrte, brauchte auch kein Licht. Gedankenverloren streichelte er das kleine Kätzchen, das sich auf seinem Schoß zusammengerollt hatte, während vor seinem geistigen Auge die Vergangenheit aufstand, die er eigentlich hatte für immer verdrängen wollen.
Wieder und wieder hörte er die Stimme des Arztes. »Es tut mir leid, Herr Sattler, wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Die Verletzungen des Kleinen waren zu schwer…«
Ein trockenes Schluchzen entrang sich Haymos Brust. Da hatte er sich nun in diesem kleinen Haus am Ortsrand von Steinhausen vergraben und sich vorgenommen, künftig nur noch für seine Tiere zu leben. Doch dann tauchte hier eine junge Frau auf, die Angst und Schmerz wieder an die Oberfläche beförderte.
»Warum mußte ausgerechnet sie dich finden?« fragte er das kleine Kätzchen mit tränenerstickter Stimme. Dabei sah er dieses zarte Gesicht vor sich, die sanften tiefblauen Augen und das lange, wie Gold glänzende Haar – und er spürte die Gefahr, die von ihr ausging… es war eine Gefahr für sein Herz, das er eigentlich auf ewig vor jeder Frau hatte verschließen wollen. Zweimal war sein Herz gebrochen worden – ein drittes Mal sollte es nicht geschehen…
*
Gleich am nächsten Abend zog es Sophie wieder zur Tierarztpraxis – um sich nach dem Kätzchen zu erkundigen, aber auch, um Haymo wiederzusehen.
»Was wollen Sie?« fragte er, und seine Stimme klang dabei mehr als unfreundlich.
»Ich wollte Minka besuchen.« Sophie zwang sich zu einem Lächeln. »Oder Micky. Ich kenne mich da nicht so genau aus.«
»Minka paßt schon«, grummelte Haymo, dann ging er Sophie voran in sein Wohnzimmer. Hier lag das kleine Kätzchen auf einem weichen Kissen und schlief.
»Das Medikament, das sie noch bekommen muß, macht sie ein bißchen müde«, erklärte Haymo und wirkte nun schon weit weniger bärbeißig.
Leise trat Sophie zu dem Kätzchen, beugte sich hinunter und streichelte zärtlich das jetzt weiche, flauschige Fell.
»Ich wünschte, ich könnte sie mitnehmen«, erklärte sie leise.
»Sie sind noch nicht lange in Steinhausen?« wollte Haymo wissen.
Erstaunt sah Sophie ihn an. Gestern hatte er kaum ein Wort mit ihr gewechselt, und jetzt stellte er ihr diese Frage… noch dazu in einem ganz normalen, fast höflichen Ton.
»Nein, erst seit ein paar Wochen«, antwortete Sophie, während sie noch immer das kleine Tigerkätzchen streichelte. »Ursprünglich sollte es nur ein Besuch bei meiner Tante und meinem Onkel sein, aber dann…« Ein sanftes Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Hier ist es so friedlich und still – ganz anders als bei mir zu Hause. Und als Onkel Wolfgang mir eine Stelle als Krankenschwester in der Waldsee-Klinik gegeben hat, habe ich mich entschlossen zu bleiben.« Sie blickte auf und sah in Haymos dunkle Augen. »Mein Vater war ziemlich wütend, aber… ich bin froh, daß ich hier sein kann.« Sie schwieg einen Moment. »Allerdings ist es nicht ganz einfach, eine Wohnung zu finden – noch dazu jetzt. Es müßte ja jemand da sein, der sich ein bißchen um Minka kümmern kann, wenn ich Dienst habe.«
Haymo wies mit dem Daumen gegen die Zimmerdecke. »Da oben sind zwei Zimmer frei. Es ist zwar nur das ausgebaute Dachgeschoß, und die Zimmer sind sehr klein, aber für eine Person würde es reichen.« Noch während er sprach, hätte er sich ohrfeigen können. Was tat er denn da? Anstatt eine möglichst große Entfernung zwischen sich und diese Frau zu legen, bot er ihr die Dachwohnung in seinem Haus an…
Sophie war von dem Angebot so überrascht, daß sie sekundenlang kein Wort hervorbrachte.
»Sie meinen… ich könnte tatsächlich hier einziehen?« stammelte sie nach einer Weile des Schweigens.
Haymo zuckte die Schultern. »Von mir aus.« Er senkte den Kopf, und dann wurde sein Ton auf einmal wieder sehr ruppig. »Lange werden Sie es wohl nicht aushalten. Es ist nicht immer angenehm, über einer Tierarztpraxis zu wohnen. Da bellt eben gelegentlich mal ein Hund.«
»Das würde mich ganz bestimmt nicht stören«, versicherte Sophie und fühlte, wie sie plötzlich innerlich zu vibrieren begann. Sie wollte hier einziehen… in das Haus von Haymo… so nah bei ihm. Verstohlen betrachtete sie ihn und stellte dabei fest, daß sie sich noch immer ein wenig vor ihm fürchtete. Selbst wenn er sich mit ihr so harmlos unterhielt wie vorhin, wirkte er gänzlich unnahbar. Gleichzeitig fand sie ihn aber auch sehr anziehend, und in der vergangenen Stunde hatte sie jedesmal, wenn er das Wort an sie gerichtet hatte, heftiges Herzklopfen bekommen, wobei sie nicht wußte, ob es ihrer Angst vor ihm entsprang oder vielleicht einem ganz anderen, weit zärtlicheren Gefühl.
»Darf ich mir die Wohnung einmal ansehen?« fragte sie.
Haymo nickte knapp, dann ging er wortlos voran, stieg die steile, gewundene Treppe hinauf und schloß die Tür auf, dann ließ er Sophie an sich vorbei in die Wohnung treten.
Er hatte nicht gelogen. Die Zimmer waren tatsächlich winzig klein, doch die schrägen Wände vermittelten schon jetzt Behaglichkeit, obwohl die Wohnung noch vollkommen leer war. In Gedanken sah Sophie bereits Bilder an den Wänden und kleine gemütliche Möbelstücke. Im selben Moment wußte sie, daß diese Wohnung genau das war, wonach sie die ganze Zeit gesucht hatte.
Mit strahlenden Augen wandte sie sich Haymo zu. »Hier möchte ich wohnen.«
Wieder nickte er knapp. »Ich muß nur vorher mit meinem Vermieter sprechen, aber ich denke, es wird keine Probleme geben. Im Grunde ist ihm völlig egal, was mit diesem Haus geschieht. Wenn ich das Haus nicht gewollt hätte, wäre es wohl längst abgerissen worden.«
Noch einmal ließ Sophie ihren Blick durch die kleinen Räume schweifen.
»Ich bin froh, daß es nicht abgerissen wurde.« Sie lächelte Haymo an. »Und ich finde, es ist alles andere als eine Bruchbude. Minka und ich werden uns hier sehr wohl fühlen.«
*
Gerda Rauh war furchtbar nervös, als sie mit ihrem Mann und Dr. Daniel zur Sommer-Klinik nach München fuhr. Doch als sie den Chefarzt dann kennenlernte, fühlte sie zu ihm ähnliches Vertrauen wie zu Dr. Daniel.
»Ich weiß schon, es ist leicht gesagt, aber Sie müssen wirklich keine Angst haben«, erklärte Dr. Sommer nach dem langen Gespräch, das er mit Unterstützung von Dr. Daniel mit Gerda und Ferdinand geführt hatte. »Ich habe schon einige Male einen TSET vorgenommen, meistens sogar mit Erfolg.«
»Dann sollten wir es möglichst bald angehen«, meinte Gerda.
»Gut.« Dr. Sommer stand auf. »Dann bringe ich Sie jetzt auf Ihr Zimmer, und dort bekommen Sie gleich eine Spritze von mir.« Er lächelte Gerda bedauernd an. »Danach wird es für Sie eine Weile recht unangenehm, denn das Heranreifen mehrerer Eibläschen wird Ihnen arge Bauchschmerzen verursachen.«
»Ich werd’s schon überstehen«, entgegnete Gerda tapfer, griff dabei aber nach der Hand ihres Mannes.
»Ich bleibe bei dir, Liebes«, versprach Ferdinand sofort. »Deshalb habe ich mir ja Urlaub genommen.« Er schwieg einen Moment. »Wenn ich dir die Schmerzen auch nicht abnehmen kann, so will ich dir wenigstens seelischen Beistand leisten.«
Dr. Daniel beobachtete diese Szene und hoffte dabei inständig, daß dieser letzte Versuch nun endlich den ersehnten Erfolg für Gerda und Ferdinand bringen würde.
Dieser Gedanke beschäftigte auch das junge Ehepaar, doch zumindest für Gerda verblaßte er bald, denn Dr. Sommer hatte sie nicht grundlos vorgewarnt. Das Medikament, das die Eireifung stimulieren sollte, leistete wirklich ganze Arbeit. Gerda bekam entsetzliche Unterleibsschmerzen.
»Hätten Sie meiner Frau diese grauenhafte Tortur denn nicht ersparen können?« fragte Ferdinand, kaum daß Dr. Sommer das Zimmer betreten hatte.
Bedauernd schüttelte der den Kopf. »Tut mir leid, Herr Rauh, aber diese ›Eierernte‹, wie das Verfahren bezeichnet wird, ist unbedingt erforderlich. Allerdings muß Ihre Frau die Schmerzen jetzt nicht mehr lange aushalten. Noch heute werden wir die Befruchtung vornehmen.« Er warf einen Blick auf die Uhr, dann wandte er sich Gerda zu. »Ein bißchen Geduld müssen Sie noch haben. In spätestens einer Stunde werden Sie in den Operationssaal gebracht, und wenn Sie aus der Narkose erwachen, haben Sie das Schlimmste bereits überstanden.«
»Hoffentlich«, brachte Gerda hervor, während sie sich wieder vor Schmerzen krümmte. »Lange halte ich das nämlich nicht mehr aus.«
Das mußte sie auch nicht, denn schon eine knappe Stunde später wurde Gerda in den OP hinuntergefahren, und dann trat der Anästhesist zu ihr.
»Jetzt muß ich Ihnen ein bißchen weh tun«, gestand er, während er die Nadel, mit der die Infusionskanüle eingeführt wurde, bereits ansetzte.
»Schlimmer als meine Bauchschmerzen kann das gar nicht sein«, meinte Gerda, trotzdem zuckte sie vor Schmerz zusammen, als der Arzt die Nadel einstach.
»Schon vorbei«, erklärte er beruhigend, zog die Nadel zu-rück und schob gleichzeitig die Infusionskanüle weiter in die Vene vor.
»So, junge Frau, dann werden wir mal ein bißchen schlafen«, fuhr er fort, griff nach der von der Schwester vorbereiteten Spritze, setzte sie auf die gerade gelegte Infusionskanüle und preßte ihren Inhalt direkt in die Vene. Nahezu im selben Moment war Grda auch schon eingeschlafen.
»Na, dann wollen wir mal«, erklärte Dr. Sommer, während er an den OP-Tisch trat.
»Tubus ist drin«, meldete sich der Anästhesist. »Sie können anfangen, Herr Chefarzt.«
Die OP-Schwester reichte Dr. Sommer das Skalpell, dann setzte er den etwa zwei Zentimeter langen Schnitt unterhalb des Bauchnabels. Mit Hilfe einer Hohlnadel pumpte Dr. Daniel, der auf Dr. Sommers Bitte hin die Erste Assistenz übernommen hatte, Kohlensäuregas in den Bauch der Patientin, darauf führte der Chefarzt vorsichtig das Laparoskop ein.
»Wunderbar«, murmelte er zufrieden.
Währenddessen hatte Dr. Daniel den zweiten Schnitt über der Schamhaargrenze gesetzt, durch den Dr. Sommer nun eine Hohlnadel einführte, mit deren Hilfe er die von den Eierstocken produzierten Eibläschen ansaugte und sie zusammen mit dem Sperma von Ferdinand in den Eileiter einbrachte.
»Alles Weitere muß nun seinen normalen Gang gehen«, erklärte Dr. Sommer. Über das Laparoskop kontrollierte er noch einmal sehr genau, ob es während des Eingriffs zu irgendwelchen Verletzungen gekommen war, dann zog er das Gerät zurück. Die beiden kleinen Schnitte wurden geschlossen, dann sah Dr. Sommer seinen Freund an.
»Ich habe ein gutes Gefühl«, urteilte er spontan.
»Hoffentlich trügt es nicht«, meinte Dr. Daniel und sah zu, wie Gerda in den Aufwachraum gefahren wurde, dann warf er einen Blick auf die Uhr. »Ein bißchen Zeit habe ich noch. Ich könnte bei ihr bleiben, bis sie wieder aufwacht.«
Dr. Sommer grinste. »Du hast Zeit? Diese Nachricht sollte man in die Zeitung schreiben lassen.« Er runzelte die Stirn. »In den beinahe dreißig Jahren, die ich dich jetzt kenne, habe ich das bestenfalls dreimal erlebt.«
Dr. Daniel stieß ihn freundschaftlich an. »Du übertreibst mal wieder maßlos, Schorsch!«
»Na ja, ein bißchen vielleicht«, räumte Dr. Sommer ein. »Aber wenn du schon Zeit hast, dann darfst du dich selbstverständlich persönlich um deine Patientin kümmern. Ich sage inzwischen ihrem Mann Bescheid, daß alles gut verlaufen ist und daß er sie besuchen kann, sobald sie wieder auf der Station ist.«
Zusammen wuschen sich die Ärzte noch die Hände, dann machte sich Dr. Daniel auf den Weg in den Aufwachraum. Er kam gerade rechtzeitig, als Gerda zum ersten Mal die Augen öffnete. Als ihr Blick auf Dr. Daniels Gesicht fiel, wollte sie etwas sagen, doch die Stimme gehorchte ihr noch nicht wieder.
»Ich weiß schon, was Sie wissen wollen, Frau Rauh«, meinte Dr. Daniel. »Es ist alles gut verlaufen. Nun muß die Natur ih-ren eigenen Weg gehen.«
Ein erleichtertes Lächeln huschte über Gerdas Gesicht, dann fielen ihr die Augen wieder zu. Erst als sie zum zweiten Mal erwachte, konnte sie die Frage stellen, die ihr am wichtigsten war.
»Wann wissen wir, ob es geklappt hat?«
Dr. Daniel lächelte. »Wenn Ihre Tage ausbleiben.«
Gerda tastete nach der Hand des Arztes, dann lächelte sie ebenfalls und wiederholte unwissentlich die Worte von Dr. Sommer.
»Ich habe ein gutes Gefühl.«
*
Wie Haymo prophezeit hatte, war die Vermietung der Dachwohnung tatsächlich kein Problem. Überhaupt schien der Hausbesitzer die Einnahmen dieser Vermietung mehr als angenehmes Taschengeld zu betrachten; an dem Haus hatte er offenbar wirklich nur wenig Interesse. Anscheinend waren seine anderen Immobilien gewinnbringender.
Sophie war überglücklich, als sie am nächsten Ersten ihre eigenen vier Wände beziehen konnte. In der Zwischenzeit hatte sie sich auch schon das Nötigste an Mobiliar zugelegt, und obwohl die Wohnung noch nicht vollständig eingerichtet war, gelang es Sophie, bereits jetzt Ge-mütlichkeit zu verbreiten.
Das fiel auch Haymo auf, als er nach oben ging, um Sophie die kleine Minka zu bringen. In Wirklichkeit war das nur ein Vorwand, doch das wollte er sich nicht eingestehen, ebenso wie er den Wunsch verdrängte, sich auf dieses gemütliche Sofa unter der Dachschräge zu setzen und sich einfach wohlzufühlen – in Gesellschaft dieser bezaubernden jungen Frau, die wie ein Orkan in sein Herz gewirbelt war und dort für gehörige Unordnung sorgte.
»Nun können Sie sich ja selbst um Minka kümmern«, knurrte er. »Mir ist sie unten bloß im Weg.«
Das war eine glatte Lüge. Er wußte nämlich schon jetzt, daß ihm das sanfte Kätzchen, das ihm in den vergangenen Tagen wie ein Schatten gefolgt war, entsetzlich fehlen würde.
»Es tut mir leid, daß Sie sich so lange um Minka kümmern mußten«, entgegnete Sophie bedauernd. »Ich hätte sie längst zu mir genommen, aber Andi… mein kleiner Neffe…«
»Das haben Sie mir ja schon erklärt«, fiel Haymo ihr unwillig ins Wort. »Mein Gedächtnis funktioniert noch ganz gut.«
Sophie errötete. Warum war Haymo nur so unberechenbar. Mal war er höflich, fast sogar freundlich, dann wieder sprach er in einem Ton mit ihr, der ihr Angst einjagte.
»Das habe ich auch gar nicht bezweifelt«, meinte sie verlegen, während sie das Kätzchen auf ihrem Arm streichelte. Doch es dauerte nicht lange, bis Minka auf den Boden wollte. Vorsichtig setzte Sophie sie ab und beobachtete mit leisem Staunen, wie das Kätzchen schnurrend um Haymos Beine strich. Der junge Mann warf einen kurzen Blick nach unten, machte aber keine Anstalten, Minka auf den Arm zu nehmen oder wenigstens zu streicheln.
»Ich habe noch zu tun«, erklärte er knapp, nickte Sophie kurz zu und ging auffallend rasch die Treppe wieder hinunter.
Sophie sah ihm nach, dann schloß sie die Tür, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und seufzte tief auf.
»Wie soll ich nur jemals aus ihm schlau werden?« murmelte sie traurig, dann bückte sie sich und streichelte Minka, die neben der Tür saß und hoffnungsvoll darauf wartete, daß sie sich wieder öffnen würde.
»Ich dachte immer, Tiere würden instinktiv spüren, wer sie mag und wer nicht«, erklärte sie. »Warum liebst du ihn so, Minka? Du bist ihm nur im Weg. Nicht einmal streicheln wollte er dich.«
Das Klopfen an der Tür ließ sie hochschrecken, und eine winzigen Augenblick hoffte sie, Haymo wäre zurückgekommen, doch als sie die Tür aufriß, stand Dr. Daniel davon. Er konnte ih-ren Blick rasch deuten.
»Sie haben jemand anderen erwartet, nicht wahr?«
Sophie zögerte, dann schüttelte sie mit einem tiefen Seufzer den Kopf. »Nein, Herr Doktor, eigentlich nicht.«
Väterlich legte Dr. Daniel einen Arm um Sophies Schultern. »Da scheint aber ein großer Kummer auf dem kleinen Herzen zu liegen.«
Sophie mußte lächeln. »Das haben Sie jetzt sehr nett gesagt.« Sie sah den Arzt an. »Überhaupt scheint es mir, als wären Sie immer zur Stelle, wenn man Sie braucht.«
»Nun ja, Hellseher bin ich nicht«, entgegnete Dr. Daniel schmunzelnd.
»Mein Besuch hat einen
ganz anderen Grund. Sie waren lange Zeit nicht mehr bei mir
in der Praxis, und da wollte
ich mal sehen, wie es Ihnen geht.«
»Ach so, wegen der Scheinschwangerschaft. Ich muß gestehen, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, aber jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir auf, daß ich keinerlei Beschwerden mehr habe.«
Dr. Daniel betrachtete sie aufmerksam. »Und mir scheint, der besagte Peter spielt in Ihrem Leben auch keine tragende Rolle mehr.«
Sophie errötete. »Was müssen Sie jetzt nur von mir denken. Da mache ich zuerst
ein entsetzliches Theater, und dann…«
Dr. Daniel ließ sie gar nicht aussprechen. »Wissen Sie, was ich wirklich denke?« Er gab die Antwort gleich selbst. »Ihnen hätte gar nichts Besseres passieren können. Dieser Peter war für Sie nicht nur unerreichbar, er scheint mir auch ein verantwortungsloser Mensch zu sein, und ich bin froh, daß Sie sich von dieser unseligen Liebe befreien konnten.«
Sophie seufzte. »So gesehen haben Sie wohl recht, allerdings scheine ich diese Art von Liebe förmlich anzuziehen.« Mit einer langsamen, müden Bewegung strich sie ihr blondes Haar zu-rück. »Ich habe das Gefühl, als wäre meine Liebe diesmal noch aussichtsloser.«
»Haymo«, sagte Dr. Daniel nur.
Sophie zögerte, dann nickte sie.
»Als er mir diese Wohnung angeboten hat, war er freundlich, beinahe sogar nett«, erklärte sie. »Aber gerade eben hat er mir Minka heraufgebracht.« Wieder seufzte sie. »Er war so kurz angebunden, daß es schon fast wieder unhöflich war, und er hatte es furchtbar eilig, wieder hinunterzukommen.«
»Die Praxis hat regen Zulauf«, meinte Dr. Daniel. »Vielleicht war er gerade im Streß.«
Sophie schüttelte den Kopf. »Nicht um diese Zeit. Anscheinend erträgt er es nicht, länger als fünf Minuten mit mir dieselbe Luft zu atmen«, fügte sie voller Bitterkeit hinzu, dann warf sie dem kleinen Kätzchen, das noch immer wartend neben der Tür saß, einen Blick zu. »Minka liebt ihn heiß und innig, dabei empfindet er sie nur als lästig.«
Dr. Daniel runzelte die Stirn. Er kannte Haymo Sattler nicht sehr gut, aber er wußte, daß der junge Mann mit Tieren nicht nur ausgezeichnet umgehen konnte, sondern sie auch über die
Ma-ßen liebte. Er ging auf in seinem Beruf, und die Tiere dankten es ihm mit blindem Vertrauen.
»Wie ich Ihnen schon einmal sagte, scheint er sehr viel mitgemacht zu haben«, meinte Dr. Daniel. »Etwas Genaues weiß niemand darüber, denn Haymo lebt hier draußen fast wie ein Einsiedler, und er gibt sich praktisch allen Menschen gegenüber ruppig und grob. Die einzigen, die eine andere Seite seines Wesens kennenlernen, sind die Tiere, die er behandelt.«
Sophie senkte den Kopf. »Wahrscheinlich war es ein Fehler, daß ich ausgerechnet in diese Wohnung gezogen bin.« Dann sah sie Dr. Daniel an. »Warum konnte es diesmal nicht einfach sein? Warum konnte ich mich nicht in einen ganz normalen jungen Mann verlieben?«
»Weil das Herz nicht nach der Vernunft fragt«, erwiderte Dr. Daniel schlicht, dann schenkte er Sophie ein aufmunterndes Lächeln. »Nun lassen Sie nicht gleich den Kopf hängen. Vielleicht wendet sich ja noch noch alles zum Guten.«
*
Diese Hoffnung gab Sophie schon bald auf. Haymo ging ihr nach Möglichkeit aus dem Weg, und auch Minka schien er tags-über nur höchst widerwillig zu versorgen. Wie ausgiebig er in Wahrheit mit dem kleinen Kätzchen spielte und schmuste, konnte Sophie nicht einmal ahnen.
Als er dann eines Abends an ihrer Wohnungstür klopfte, war sie so überrascht, daß sie im ersten Moment kein Wort hervorbrachte.
»Meine Sprechenstundenhilfe muß zur Hochzeit ihrer Enkelin«, erklärte Haymo ohne gro-ße Umschweife. »Ich weiß zwar, daß Sie Krankenschwester sind, aber soweit ich gesehen habe, können Sie mit Tieren gut umgehen. Können Sie morgen für einen Tag einspringen?«
Sophie brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was da gerade geschehen war. Haymo Sattler bat sie… ausgerechnet sie, seine Sprechstundenhilfe zu vertreten.
»Da haben Sie aber Glück, daß ich morgen dienstfrei habe«, brachte sie nach einer Weile des Schweigens hervor. »Na-türlich helfe ich Ihnen mit der Sprechstunde – sofern ich Ihnen da überhaupt eine Hilfe sein kann. Ich habe ja keine Ahnung, was in einer Tierarztpraxis zu tun ist.«
Haymo zuckte die Schultern. »Das kriegen wir schon irgendwie hin.«
Sophie zögerte, dann sprach sie doch aus, was ihr spontan durch den Kopf gegangen war. »Sie wußten doch sicher schon früher, daß Ihre Sprechstundenhilfe zu dieser Hochzeit gehen würde.«
Haymo verstand, was sie damit sagen wollte. »Natürlich, und ich habe mich auch umgesehen, aber… es ist nicht so leicht, eine Aushilfe zu bekommen.«
Da er für seine Verhältnisse gerade so umgänglich war, entschloß sich Sophie zu einer weiteren Frage.
»Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee hereinbitten?«
Haymo kämpfte sichtlich mit sich, stimmte überraschenderweise aber zu, doch Sophie bemerkte die Spannung, unter der er stand. Impulsiv legte sie eine Hand auf seinen Arm und spürte, wie Haymo unter der Be-rührung zusammenzuckte.
»Herr Dr. Sattler, darf ich Sie etwas fragen? Etwas Persönliches?«
»Nein.« Kurz und hart kam Haymos Antwort.
Sophie errötete und zog ihre Hand zurück. Sie wurde aus diesem Mann nicht schlau. Da war er beinahe schon freundlich und bat sie darum, seine Sprechstundenhilfe zu vertreten, und dann schlug er von einer Sekunde zur anderen einen Ton an, der ihr gleich wieder Angst machte.
Sophie zuckte erschrocken zurück, als Haymo unvermittelte nach ihrer Hand griff.
»Ich wollte Sie nicht verletzen«, erklärte er mit ungewöhnlicher Sanftheit in der Stimme, »aber es ist noch immer zu schmerzlich für mich, darüber zu sprechen. Ich bitte Sie also, mich nichts Persönliches zu fragen – noch nicht.«
Wieder errötete Sophie.
»Es tut mir leid«, murmelte sie. »Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Dr. Sattler.«
»Haymo«, verbesserte er spontan. »Bitte, Sophie, nennen Sie mich Haymo.« Er schwieg einen Augenblick und fuhr dann fort: »Keine Sorge, Sie sind mir nicht zu nahe getreten.«
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen, und irgendwie rechnete Sophie damit, daß Haymo aufstehen und wieder gehen würde. Statt dessen wandte er sich ihr plötzlich
zu.
»Sie halten mich für einen sehr schwierigen Menschen, nicht wahr?«
Sophie zögerte, dann nickte sie.
»Verstehen Sie mich nicht falsch«, bat sie sofort. »Es liegt vielleicht gar nicht an Ihnen, aber… ich habe ein bißchen Angst vor Ihnen.«
Sehr ernst sah er sie an. »Ich will nicht, daß Sie vor mir Angst haben, Sophie. Ich bin ein schwieriger Mensch, aber ich war nicht immer so.«
Er sah Sophie an, und dabei keimte in ihm die Hoffnung auf, er würde vielleicht mit ihrer Hilfe wieder so werden, wie er einmal gewesen war.
*
Aufgeregt, aber mit strahlendem Gesicht, betrat Gerda Rauh das Sprechzimmer von Dr. Daniel.
»Ich glaube, es hat geklappt!« stieß sie hervor und nahm sich dabei kaum Zeit, den Arzt richtig zu begrüßen. »Meine Tage sind seit einer Woche überfällig, und ich spürte so ein seltsames Ziehen in der Brust. Außerdem habe ich morgens keinen rechten Appetit. Mir ist zwar nicht übel, aber sehr viel essen kann ich auch nicht.«
Dr. Daniel lächelte. »Das klingt tatsächlich äußerst vielversprechend, Frau Rauh. Und natürlich werden wir der Sache sofort auf den Grund gehen.«
Er begleitete die junge Frau ins Labor und bat seine Sprechstundenhilfe, einen Schwangerschaftstest vorzunehmen. Das Ergebnis bekam er schon wenige Minuten später vorgelegt.
»Positiv«, erklärte er mit einem gesonders herzlichen Lä-cheln. »Sie erwarten ein Baby, Frau Rauh, und ich glaube, ich muß nicht extra betonen, daß ich mich mit Ihnen freue.«
»Nein, Herr Doktor, das sieht man Ihnen an«, erwiderte Gerda, dann brach sie plötzlich in Tränen aus. »Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt.« Sie blickte auf und lächelte, wäh-rend noch immer Tränen über ihr Gesicht liefen. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Doktor – Ihnen und auch Dr. Sommer. Sie haben an mir ein Wunder vollbracht.« Sie schwieg einen Moment. »Können Sie jetzt schon feststellen, ob es Zwillinge werden?«
Bedauernd schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Zu diesem frühen Zeitpunkt leider noch nicht.« Aufmerksam betrachtete er die junge Frau. »Wären Zwillinge jetzt vielleicht doch ein Problem für Sie?«
Da schüttelte Gerda lächelnd den Kopf. »Nein, Herr Doktor. Es ist mir nicht wichtig, wie viele Kinder ich bekommen werde – entscheidend ist, daß Ferdinand und ich endlich Eltern werden.«
*
Der Abend in Sophies Wohnung hatte etwas in Haymo verändert. Er konnte es nicht erklären, aber er hatte auf einmal das Gefühl, als müsse er seine Empfindungen vor Sophie nicht mehr verstecken. Und so war es für ihn auch kein Problem, als sie an einem kühlen Herbsttag früher aus der Klinik kam und ihn beim Spielen mit Minka überraschte. Eine Weile beobachtete sie Mensch und Tier und erkannte die zärtliche Liebe, die zwischen beiden bestand.
»So habe ich Sie noch nie gesehen«, gestand Sophie leise.
Hamo erschrak, weil er sie nicht hatte hereinkommen hö-ren. Doch dann brachte er sogar ein Lächeln zustande.
»Ich weiß«, entgegnete er.
»Sie zeigen Ihre Gefühle nicht gern.«
Sophie hatte gerade ausgesprochen, da bekam sie ein wenig Angst. Haymo war doch so unberechenbar. Würde er auf diese Behauptung wütend reagieren?
Doch Haymo dachte gar nicht daran, böse zu werden. Er sah Sophie lange an, dann nickte er wieder.
»Sie haben recht«, erklärte er. »Ich zeige nicht gern Gefühle, denn bisher habe ich nur schlechte Erfahrungen damit gemacht.«
Sophie nahm ihren ganzen Mut zusammen. »Möchten Sie darüber sprechen?« Und dabei wußte sie, wenn er das tat, würde sie ihm ein ganzes Stück nä-herkommen.
Auch Haymo war der tiefere Sinn ihrer Frage bewußt, daher antwortete er nicht gleich, sondern wandte sein Gesicht wieder dem Kätzchen zu, das schmeichelnd um ihn herumstrich, doch der junge Mann nahm es jetzt gar nicht wahr. Seine Gedanken beschäftigten sich mit Sophies Frage, und er war nicht sicher, ob er sie mit Ja beantworten sollte.
Wenn er es tat und ihr seine ganze Geschichte erzählte, dann würde er unweigerlich sein Innerstes offen vor Sophie ausbreiten, und obwohl er sich gegen die Gefühle, die er für sie empfand, nicht mehr wehrte, hatte er doch Angst vor einer solchen Offenheit ihr gegen-über. Was, wenn er sich in ihr irrte? Wenn sie seine Schwä-chen, die er ihr im Laufe
des Gesprächs offenbaren würde, ausnutzte, um ihm weh zu tun?
»Haymo, ich glaube, es würde dir guttun, darüber zu sprechen«, erklärte Sophie und wechselte ganz unbewußt zum vertrauten Du über.
Ihre sanfte Stimme war für ihn wie ein Streicheln. Langsam drehte sich Hamo zu ihr um und sah sie lange an, dann nickte er. »Gut, Sophie, ich werde dir alles erzählen – auch auf die Gefahr hin, daß ich dadurch sehr verletzlich werde.«
Sophie verstand. Haymo war im Begriff, ihr sein Herz zu öffnen, und sie schwor sich, dieses Vertrauen niemals zu enttäuschen.
»Ich war gerade achtzehn, als ich mich zum ersten Mal verliebte«, begann Haymo leise. »Carla und ich schienen wie füreinander bestimmt. Bereits ein halbes Jahr später standen wir vor dem Traualtar. Ich war glücklich wie nie zuvor in meinem Leben, doch dieses Glück währte nur ein Jahr.«
Haymos Stirn zog sich in bedrohliche Falten, als er an den Augenblick dachte, in dem er Carla und ihren Tennislehrer bei einer leidenschaftlichen Umarmung ertappt hatte.
»Ich bin ein Mensch, für den Treue das Wichtigste auf der Welt ist – vor allem in einer Ehe. Diesen Seitensprung konnte ich Carla nie verzeihen, aber vermutlich hat sie das auch gar nicht erwartet. Zwei Tage nach der Scheidung heiratete sie diesen Tennislehrer. Mittlerweile ist sie bereits zum vierten Mal geschieden.« Die Worte kamen voller Bitterkeit, und unwillkürlich ergriff Sophie tröstend seine Hand. Haymo zwang sich zu einem Lächeln, doch es kam nicht von Herzen, denn seine Gedanken verweilten in einer schlimmen Vergangenheit.
»Es dauerte zwei Jahre, bis ich den Mut hatte, ein zweites Mal zu heiraten, doch ich war sicher, daß Verena anders wäre als Carla. Wir führten auch eine sehr glückliche Ehe, und als nach einem Jahr mein kleiner Sohn Werner zur Welt kam, glaube ich vor Glück wahnsinnig zu werden.« Haymo schwieg eine Weile, dann fügte er leise hinzu: »Es war die schönste Zeit meines Lebens.« Doch gleich darauf zog sich seine Stirn in schmerzvolle Falten, und Sophie spürte, wie schwer es ihm fiel weiterzusprechen. Sie ahnte, daß etwas Schreckliches geschehen sein mußte.
»Laß es sein, Haymo«, meinte sie leise. »Ich sehe, wie weh es dir tut, darüber zu sprechen.«
Doch Haymo schüttelte den Kopf. »Ich habe damit angefangen, jetzt sollst du auch den Rest erfahren.« Er atmete tief durch. »Vielleicht ist es gut, wenn ich mir endlich alles von der Seele spreche.« Doch es dauerte noch eine Weile, bis er weitersprach.
»Werner war sechs, als Ve-
rena sich entschloß, ihr Jurastudium fortzusetzen. Es war eine schwierige Zeit, denn sie hatte viel nachzuarbeiten, und auch ich war in diesen Monaten furchtbar eingespannt. Als ich von meinen Hausbesuchen bei den umliegenden Bauernhöfen früher als erwartet zurückkehrte, war Verena nicht allein. Sie hatte Werner zu ihren Eltern gebracht, um sich in aller Ruhe einem Studienkollegen widmen zu können.«
Sophie spürte Haymos Zittern, als er diese Worte aussprach, und sie stellte sich vor, wie er in dieser Situation wohl reagiert haben mochte.
»Ich war entsetzlich wütend«, gestand Haymo. »Aber viel schlimmer war die maßlose Enttäuschung, die ich empfand. Meine Liebe war jetzt ein zweites Mal verraten worden. Und es kam noch viel schlimmer, denn diesmal war es nicht allein mit einer Scheidung abgetan. Da war noch Werner… und der Richter sprach Verena das Sorgerecht für ihn zu.« Noch heute schmerzte ihn diese Urteil so sehr, daß er in hilflosem Zorn die Fäuste ballte.
»Sie war sehr… großzügig, was mein Besuchsrecht anging«, fuhr Haymo zögernd fort. »Ich durfte meinen Jungen oft bei mir haben, bis…« Völlig übergangslos brach er in Tränen aus. Sophie erschrak zutiefst. Damit hatte sie nicht gerechnet, und sie hatte auch keine Ahnung, wie sie sich jetzt verhalten sollte.
Haymo wandte sich ab, und es dauerte lange, bis er sich wieder in der Gewalt hatte.
»Es war ein schrecklicher Unfall«, brach es schließlich aus ihm heraus, und seine Stimme schien direkt aus dem Herzen zu kommen – eine Stimme vol-ler Schmerz und Trauer. »Verena war auf der Stelle tot, und Werner… er wurde zwar noch operiert, doch er… er konnte nicht mehr gerettet werden.«
*
Stunden waren seither vergangen, und Sophie hätte später nicht mehr sagen können, wie sie sie verbracht hatten. Es war weit nach Mitternacht, und noch immer hielt Sophie den völlig gebrochenen Mann an ihrer Seite im Arm, um ihm Trost und Hilfe zu schenken.
Das war nicht mehr der ruppige Haymo, den sie kennengelernt hatte. Es war ein sehr verletzlich wirkender junger Mann, der in den Armen einer Frau Geborgenheit suchte.
Jetzt löste er sich von ihr, und auf seinem Gesicht lag wieder etwas von dem Ausdruck, den sie kannte.
»Nun weißt du alles«, erklärte er leise. »Und du hältst mein Herz in deiner Hand.« Er senkte den Kopf. »Ich bin bei weitem nicht so hartherzig, wie ich mich hier gebe. Du bist jetzt die einzige, die das weiß, und ich kann nur hoffen, daß ich meine Offenheit niemals bereuen muß. Du hast die Macht, mich zu zerstören, denn noch einmal würde ich den Verrat meiner Liebe nicht überleben.«
Langsam hob Haymo den Blick und sah in ein Paar tiefblaue Augen, die ihn voller Offenheit anschauten.
»Heißt das…« Sie brachte den Satz nicht zu Ende.
Haymo nickte. »Ja, Sophie, das heißt, daß ich zum dritten Mal in meinem Leben liebe. Von ganzem Herzen.«
Sie konnte kaum glauben, was sie eben gehört hatte. Fassungslos starrte sie Haymo an.
»Mich?« fragte sie dann leise. »Wirklich mich?«
Haymo zögerte nur den Bruchteil einer Sekunde, dann nickte er. »Ja, Sophie, ich liebe dich.«
Und jetzt endlich konnte sie an ihr Glück glauben. Mit einer stillen, ehrlichen Freude in den Augen schmiegte sie sich an Haymo, ließ zu, daß er sie zärtlich in den Arm nahm, und beugte sich ihm entgegen, als seine Lippen sich den ihren nä-herten.
»Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet«, gestand sie leise.
»Ich habe es gespürt«, entgegnete Haymo, »aber ich wollte es nicht wahrhaben. Meine Angst vor einer neuen Bindung war zu groß, und… sie ist noch immer sehr groß.« Mit ernstem Blick sah er sie an. »Bitte, Sophie, tu mir nicht weh.«
»Niemals«, versprach sie. »Ich liebe dich, Haymo. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.«
*
Obwohl Sophie und Haymo aus ihrer Beziehung kein Geheimnis machten, hatte sich diese Nachricht noch nicht bis zu den Schwestern der Waldsee-Klinik herumgesprochen, als Sophie durch Zufall ein Gespräch zwischen Alexandra und Bianca mitbekam.
»Das mit Dr. Parker ging ja voll daneben«, stellte Alexandra enttäuscht fest. »Dabei habe ich in ihn so große Hoffnungen gesetzt.«
»Ja, er wäre für Sophie wirklich ideal gewesen«, stimmte Bianca zu. »Wen kann man ihr denn jetzt noch als Traumtyp anbieten?
Da mußte Sophie, die unauffällig an der Tür gestanden hatte, herzlich lachen. Ihre Kolleginnen erschraken zutiefst, verlegene Röte überzog ihre Gesichter.
»Ich finde es wirklich toll, daß ihr euch um mich solche Sorgen macht«, meinte sie, und die beiden Schwestern spürten, daß das ehrlich gemeint war. Erleichtert atmeten sie auf.
»Dann bist du uns nicht böse?« vergewisserte sich Bianca trotzdem.
»Nicht die Spur«, betonte Sophie. »Allerdings ist es nicht nötig, daß ihr euch weitere Gedanken macht. Ich habe mir meinen Traumtyp nämlich schon selbst gesucht.« Sie überlegte einen Moment. »Na ja, Dr. Daniel hat wohl auch ein biß-chen dabei mitgeholfen. Ohne ihn und meine kleine Minka…« Sie beendete den Satz nicht, sondern sah ihre Kolleginnen an. »Anscheinend seid ihr so ziemlich die einzigen, die das noch nicht wissen.« Ein glückliches Lächeln erhellte ihr hübsches Gesicht. »Haymo Sattler und ich werden uns in Kürze verloben.«
»Der Tierarzt?« vergewisserte sich Alexandra und tauschte einen kurzen Blick mit Bianca.
»Ich weiß schon, was ihr denkt«, meinte Sophie, »aber es ist alles ganz anders. Haymo ist nicht der ruppige, unnahbare Mensch, den er immer gespielt hat. Er ist der beste Mann, den ich nur finden konnte.« Als sie jetzt wieder lächelte, schien ihr ganzes Gesicht von innen heraus zu leuchten. »Ich bin so glücklich, wie nie zuvor…«
– E N D E –