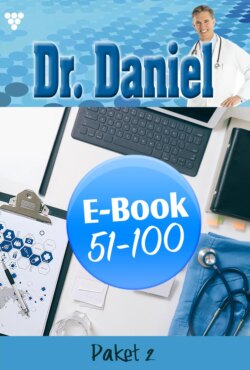Читать книгу Dr. Daniel Paket 2 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIm Laufschritt betrat Dr. Robert Daniel die Steinhausener Waldsee-Klinik. Eigentlich hätte er den lauen Herbstabend mit seiner Frau Manon und seinem kleinen Adoptivtöchterchen Tessa auf dem heimatlichen Balkon genießen wollen, doch ein alarmierender Anruf aus der Klinik hatte ihn hierher gehetzt.
»Robert, gut, daß Sie so schnell kommen konnten«, rief die Gynäkologin der Klinik, Dr. Alena Reintaler, erleichtert. »Fräulein Neubert ist gerade in den Untersuchungsraum gebracht worden.«
Dr. Daniel runzelte erstaunt die Stirn.
»Eva-Maria Neubert?« vergewisserte er sich, während er Alena in die Gynäkologie folgte.
Eine Antwort auf seine Frage erübrigte sich, denn jetzt betrat Dr. Daniel den Raum, wo sich Eva-Maria mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Untersuchungsliege zusammenkrümmte. Mit einem Schritt war Dr. Daniel bei ihr und nahm die Binde weg, die sich das junge Mädchen zwischen die Beine geklemmt hatte und die nun vollständig durchgeblutet war.
Forschend sah Dr. Daniel das junge Mädchen an. »Eva-Maria, bist du schwanger?«
Sie preßte die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf, doch dabei huschte eine verräterische Röte über ihr blasses Gesicht.
»Ich muß dich untersuchen, Eva-Maria«, erklärte Dr. Daniel, während er sich schon Plastikhandschuhe überstreifte.
Eva-Maria wimmerte leise vor sich hin, während der Arzt die Untersuchung vornahm. Dann streifte Dr. Daniel die Handschuhe ab und warf sie in den Abfall-eimer.
»Du warst ja doch schwanger.« Wieder sah er das junge Mädchen ernst an. »Sei ehrlich, Eva-Maria. Hast du versucht, das Kind wegzumachen?«
Heftig schüttelte sie den Kopf. »Ich habe plötzlich Bauchschmerzen bekommen, und dann hat es angefangen zu bluten. Bitte, Herr Doktor, das müssen Sie mir glauben.«
»Natürlich glaube ich dir«, versicherte Dr. Daniel, dann sah er Alena an. »Sofort OP bereitmachen. Es war offensichtlich keine vollständige Fehlgeburt. Ein Teil der Plazenta muß im Uterus zurückgeblieben sein.« Er wandte sich dem jungen Mäd-chen wieder zu. »Keine Angst, Eva-Maria. Du wirst jetzt ein bißchen schlafen, und wenn du aufwachst, ist alles wieder gut.«
Aufmerksam betrachtete er das Mädchen, dann griff er nach ihrem Handgelenk, um den Puls zu messen.
»90«, murmelte er besorgt, während er eiligst das Blutdruckmeßgerät holte. »100 zu 60.« Instinktiv ahnte er, wo er nach dem Grund für den drohenden Schockzustand suchen mußte, und tastete vorsichtig den Bauch der Patientin ab. Der Befund bestätigte seinen Verdacht. Rasch wandte er sich der eintretenden Schwester zu, die Eva-Maria in den Operationssaal bringen wollte. »Bianca, holen Sie mir schnellstens ein Infusionsbesteck.«
»Was ist los, Robert?« wollte der Anästhesist Dr. Jeffrey Parker wissen, der unbemerkt den Raum betreten hatte. »Ich dachte, wir bekommen einen Notfall ins OP?«
»Bekommen wir auch«, entgegnete Dr. Daniel. »Aber die Behandlung des Schocks ist im Moment vorrangig. Die Patientin hat vermutlich innere Blutungen.«
Dr. Parker nickte. »Ich kümmere mich darum.«
»Danke, Jeff. Ich gehe inzwischen in den Waschraum, damit ich nachher gleich mit der Operation beginnen kann.«
Während Dr. Daniel das Zimmer verließ, kontrollierte Dr. Parker noch einmal Puls und Blutdruck. Die Pulsfrequenz lag bereits bei 120, während der Blutdruck noch weiter unter 100 abgefallen war. Rasch und geschickt legte Dr. Parker die Infusion.
»Und jetzt ab mit ihr in den OP«, ordnete er an. »Aber schnell.«
Er half Schwester Bianca, die fahrbare Trage in den Operationssaal zu bringen, dann ließ er sich von der OP-Schwester Petra Dölling keimfreie Handschuhe überstreifen, nahm die vorbereitete Spritze entgegen und preßte deren Inhalt direkt in die Infusionskanüle, die er zuvor gelegt hatte. Das Medikament wirkte rasch und ließ Eva-Maria einschlafen, während Dr. Parker noch einmal Puls und Blutdruck kontrollier-
te.
»Wie sieht’s aus?« wollte Dr. Daniel wissen, der jetzt in Alenas Begleitung in den Operationssaal kam.
»Nicht besonders«, antwortete Dr. Parker. »Die Infusion bringt leider nur wenig.« Er trat an das Kopfende des OP-Tisches und begann mit der Instubation.
»Tubus ist drin«, erklärte er schließlich. »Sie können anfangen, Robert.«
Dr. Daniel streckte die rechte Hand aus und bekam von der OP-Schwester ohne Aufforderung das Skalpell gereicht. Er führte den Bauchschnitt durch, dann setzte Alena die Operationshaken an.
»Meine Güte«, stieß sie hervor, als sie einen ersten Blick auf das Operationsfeld werfen konnte. »Wie kann eine Fehlgeburt zu so massiven intraabdominalen Blutungen führen?«
Dr. Daniel seufzte. »Ich fürchte, Eva-Maria hat mich belogen. Vermutlich hat sie versucht abzutreiben und dabei die Gebärmutterwand durchstoßen.«
Währenddessen hatte die OP-Schwester schon begonnen abzusaugen, doch es dauerte eine Weile, bis Dr. Daniel freie Sicht bekam.
»Uterusperforation durch…« Der Arzt stockte. »Oh, das ist ja die Spirale… und ich dachte…« Er beendete den Satz nicht, sondern entfernte die Spirale, die sich durch die Muskulatur der Gebärmutter gebohrt und damit zu den extremen inneren Blutungen geführt hatte.
»Petra, noch einmal absaugen, bitte.«
Die OP-Schwester kam Dr. Daniels Aufforderung nach, dann warf der Arzt einen kurzen Blick zum Anästhesisten.
»Wie sieht’s jetzt aus, Jeff?« wollte er wissen.
Dr. Parker zuckte die Schultern. »Noch immer nicht gut, aber etwas stabiler.«
Dr. Daniel behob den Schaden, den die Spirale bei der Gebärmutter angerichtet hatte, doch trotzdem sickerte noch immer weiter Blut in den Bauchraum.
»Sie sackt wieder ab«, knurrte Dr. Parker. »Mensch, Mädchen, mach doch keinen Mist.« Er nahm eine der bereitgestellten Blutkonserven, schloß die Infusion an und regelte die Tropfgeschwindigkeit. Über einen weiteren Zugang bekam die Patientin Kochsalzlösung, doch das Ergebnis war unbefriedigend. Der Blutdruck war noch immer bedenklich niedrig. »Er liegt jetzt bei sechzig. Der zweite Wert ist nicht mehr meßbar.«
»Die zurückgebliebene Plazenta scheint ebenfalls Blutungen zu verursachen«, erklärte Alena.
Dr. Daniel nickte. »Das kann aber nicht das einzige sein.« Er warf Dr. Parker einen kurzen Blick zu. »Geben Sie ihr Ergometrin.« Er konzentrierte sich wieder auf das Operationsfeld, und plötzlich erkannte er, daß die verirrte Spirale noch ganz andere Schäden angerichtet hatte. »Ich hab’s. Kein Wunder, daß Sie die Patientin nicht stabil kriegen.« Ohne von seiner Arbeit aufzusehen, fuhr er fort: »Petra, lassen Sie meinen Sohn rufen. Ich brauche hier noch mehr Hände.«
Schwester Petra gab die Anweisung weiter und stand wenig später wieder am OP-Tisch, um Dr. Daniel weiter zu assistieren. Auch sein Sohn Stefan ließ nicht lange auf sich warten. In knappen Worten informierte Dr. Daniel ihn, dann übernahm Stefan von Alena die Operationshaken, während die junge Gynäkologin Dr. Daniel half, die vielen kleinen Wunden zu schließen, die die verirrte Spirale gerissen hatte.
»Sie kollabiert!« rief Dr. Parker in diesem Moment.
Dr. Daniel brauchte nicht eine Sekunde, um zu einem Entschluß zu kommen.
»Alena, legen Sie einen arteriellen Zugang«, ordnete er an, dann wandte er sich Dr. Parker zu. »Geben Sie ihr das Blut im Druckbeutel.«
Alena und der Anästhesist kamen der Aufforderung unverzüglich nach, während Dr. Daniel nun allein versuchte, der vielen Blutungen in Eva-Marias Körper Herr zu werden, doch der Zustand der Patientin blieb weiterhin bedenklich.
»Alena, geben Sie ihr einen Milliliter Atropin«, ordnete Dr. Daniel an, ohne von seiner Arbeit aufzublicken, dann wandte er sich an die OP-Schwester. »Petra, bereiten Sie eine Doparmin-Infusion vor.«
»Multifokale Extrasystolen!« rief Dr. Parker.
»Auch das noch«, knurrte Dr. Daniel und warf einen Blick auf den Monitor, der anzeigte, daß Eva-Marias Herz den Belastungen nicht mehr standhielt. »Jeff, spritzen Sie der Patientin hundert Milligramm Lidocain intravenös.«
Der schrille Piepton, der im nächsten Augenblick vom Monitor ertönte, fuhr allen Ärzten in die Glieder. Herzstillstand!
»Den Defibrillator!« rief Dr. Daniel, doch die OP-Schwester stand schon bereit und reichte ihm die beiden Defibrillatorpaddel.
»Auf 260 laden«, kommandierte Dr. Daniel, dann drückte er die Defebrillatorpaddel auf Eva-Marias Brust. »Zurücktreten!« Er bestägte den Knopf, der einen kurzen Stromstoß durch den Körper der Patientin jagte. Noch immer schrillte der entsetzliche Piepton durch den Raum.
»300!« rief Dr. Daniel und wiederholte das Manöver. Der schrille Pfeifton verstummte und machte dem regelmäßigen Piepen Platz, das anzeigte, daß das Herz seine Arbeit wieder aufgenommen hatte.
»Wir haben sie«, stieß Dr. Daniel hervor, und die Erleichterung war ihm dabei deutlich anzuhören.
»Der Blutverlust ist noch immer enorm hoch«, gab Alena zu bedenken.
»Geben Sie ihr eine weitere Konserve«, ordnete Dr. Daniel an. »Ich muß zusehen, daß ich die Blutungen endlich zum Stillstand bringe.«
»Blutdruck ist noch immer nicht meßbar«, erklärte Dr. Parker.
Dr. Daniel erwiderte nichts. Er wußte, daß Eva-Marias Leben am seidenen Faden hing, und wenn es ihm nicht gelang, die vielen kleinen Wunden zu schließen und damit die Blutung zu stoppen, bevor ihr Herz ein weiteres Mal versagte, würden wohl alle Wiederbelebungsversuche versagen.
»Kammerflimmern!« rief Dr. Parker.
»Halte durch, Mädchen«, murmelte Dr. Daniel wie beschwörend vor sich hin. »Ich hab’s ja gleich.«
Diesmal war es Dr. Parker, der den Defibrillator betätigte, und er brauchte schon doppelt so viele Versuche wie Dr. Daniel zuvor, obwohl es noch nicht einmal zu einem Herzstillstand gekommen war.
»Ein drittes Mal kriegen wir sie nicht mehr«, prophezeite er, aber das wußte auch Dr. Daniel. Es grenzte fast an ein Wunder, daß es Dr. Parker überhaupt noch gelungen war, den Herzschlag der Patientin wieder stabil zu bekommen.
Angestrengt blickte Dr. Daniel auf das Operationsfeld, doch es schien, als wäre es ihm nun endlich gelungen, sämtliche Wunden zu schließen.
»Blutdruck ist wieder meßbar«, meldete sich Dr. Parker in diesem Moment. »Siebzig zu
fünfzig. Nicht berauschend, aber immerhin.«
Dr. Daniel atmete auf. »Ich glaube, wir haben’s geschafft.« Noch einmal vergewisserte er sich, ob wirklich kein Blut mehr in den Bauchraum trat, dann sah er seinen Sohn an. »Stefan, du kannst die Wunde schließen. Ich muß mich jetzt um die Reste der Plazenta kümmern.«
Die Beine der Patientin wurden vorsichtig auf die speziellen Bügel gelegt, um Dr. Daniel die nötige Sicht zu verschaffen. Vorsichtig begann er, mit Dehnungsstiften die Zervix zu weiten, dann führte er die Kürette ein und nahm die Ausschabung vor.
Währenddessen hatte Stefan den Bauchschnitt geschlossen.
»Das war ziemlich knapp«, meinte er.
Dr. Daniel war jetzt ebenfalls fertig und erhob sich. »Das kann man wohl sagen. Eine halbe Stunde später, und sie wäre uns auf dem Tisch weggestorben. Mit achtzehn Jahren – sie ist ja noch ein halbes Kind.« Er betrachtete die Reste der Fehlgeburt und schüttelte verständnislos den Kopf. »Sie muß bestimmt schon im dritten Monat gewesen sein. Ich verstehe das nicht. Sie muß doch gewußt haben, daß die Spirale immer noch in der Gebärmutter war.«
Stefan runzelte die Stirn. »Sie trug eine Spirale? Wie konnte sie dann überhaupt schwanger werden?«
»So etwas kommt vor«, entgegnete Dr. Daniel. »Sehr selten, aber es kann doch passieren. Jede Verhütungsmethode hat eine gewisse Fehlerquote.« Er seufzte. »Wenn sie sich wieder erholt hat, werde ich noch eingehend mit ihr über all das sprechen müssen.« Er wandte sich seinem Sohn zu. »Stefan, bring’ sie vorerst mal auf Intensiv. Ich will kein Risiko eingehen.« Dann sah er auf die Uhr. »Ich werde noch hierbleiben, bis sie das erste Mal zu sich kommt.«
*
Es war schon beinahe Mitternacht, als Eva-Maria die Augen öffnete. Dr. Daniel beugte sich über sie.
»Hast du Schmerzen, Eva-Maria?« fragte er.
Das junge Mädchen öffnete den Mund, doch nur ein heiseres Krächzen kam hervor.
»Du mußt nicht sprechen«, erklärte Dr. Daniel. »Nicken oder Kopfschütteln genügt.«
Eva-Maria brachte ein schwaches Nicken zustande, dann versuchte sie, eine Hand zu heben, um Dr. Daniel zu zeigen, wo sie Schmerzen hatte, doch die Nachwirkungen der Narkose ließen noch keine koordinierten Bewegungen zu.
»Nur nicht anstrengen, Eva-Maria«, meinte Dr. Daniel. »Ich kann mir schon vorstellen, wo du Schmerzen hast.« Er zog eine Spritze auf und injizierte das Medikament direkt in die Infusionskanüle. »Es wird gleich besser werden, mein Kind.«
Tränen rollten über Eva-Marias blasse Wangen. Dr. Daniel griff nach einem Papiertaschentuch und wischte sie vorsichtig weg.
»Nicht weinen, Mädchen, es kommt alles wieder in Ordnung.« Er zögerte einen Moment, dann fügte er hinzu: »Deine Eltern lassen dich ganz lieb grüßen. Sie kommen dich morgen besuchen.« Er streichelte sanft über ihr langes blondes Haar, dann kontrollierte er an dem speziellen Thermometer noch die Temperatur der Patientin. Sie war leicht erhöht, doch das besagte nach dem schweren Eingriff, den Eva-Maria hinter sich hatte, nicht viel.
Dr. Daniel wartete noch, bis sie wieder eingeschlafen war, dann verließ er die Intensivstation.
»Sie scheinen das Mädchen sehr gut zu kennen«, stellte Dr. Parker fest, der heute die Nachtschicht hatte und auf seinem Rundgang auch zur Intensivstation gekommen war, obwohl er gewußt hatte, daß Dr. Daniel noch hier war. Aber auch dem jungen Anästhesisten hatte die Sorge um die Achtzehnjährige keine Ruhe gelassen.
Jetzt nickte Dr. Daniel. »Eva-Maria war eines der ersten Babys, die ich in meiner Eigenschaft als Gynäkologe hier in Steinhausen auf die Welt geholt habe.« Er warf einen Blick durch die Glasscheiben der Intensivstation. »Jetzt wäre sie an ihrer ersten Schwangerschaft beinahe gestorben.«
»Sie wußten weder etwas von dieser Schwangerschaft noch von der Spirale, die sie immer noch trug«, stellte Dr. Parker fest. »Gehört Fräulein Neubert denn nicht zu Ihrem Patientenkreis?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein. Sie ist vor knapp einem Jahr zu meiner Kollegin in die Kreisstadt gewechselt. Wahrscheinlich hatte sie auf einmal Bedenken, sich von einem Mann an ihren intimsten Stellen untersuchen zu lassen. Viele Mädchen entwickeln in dieser Richtung plötzlich starke Schamgefüh-
le.«
Dr. Parker dachte eine Weile nach, dann lächelte er. »Irgendwie kann ich das verstehen. Wenn ich mir vorstelle, ich müßte mich von einer Urologin untersuchen lassen…, ich glaube, da hätte ich auch Hemmungen, mich vor ihr auszuziehen.«
Dr. Daniel nickte. »So gesehen haben Sie recht. Andererseits wissen Sie selbst ja auch, daß man als Arzt immer nur den Patienten sieht – gleichgültig, welchen Geschlechts er ist. Und ich denke, einer Ärztin geht es da nicht anders.«
Jetzt lächelte Dr. Parker. »Sie müßten das eigentlich am allerbesten wissen, Robert. Immerhin sind Sie seit kurzem mit einer Ärztin verheiratet.«
»Ich werde Manon bei Gelegenheit fragen, was sie empfindet, wenn ein gutaussehender Patient bei ihr im Sprechzimmer erscheint«, entgegnete Dr. Daniel schmunzelnd. »Schließlich ist das für mich in vielerlei Hinsicht interessant zu wissen.«
Dr. Parkers Züge wurden fast spitzbübisch. »Fragt sich nur, ob sie Ihnen die Wahrheit sagen wird.«
Dr. Daniel drohte ihm scherzhaft mit dem Finger. »Mein lieber Jeff, Sie sind wohl früher ein rechter Lausbub gewesen.«
Der junge Anästhesist nickte ohne zu zögern. »Der schlimmste von ganz Kalifornien. Und einen großen Teil davon habe ich mir bewahrt.« Er wurde plötzlich ernst. »Ich finde es traurig, wenn man als Erwachsener jeglichen Humor verliert – abgesehen davon, daß ich eigentlich nie ganz erwachsen werden möchte.« Er senkte den Kopf. »Vor ein paar Jahren, als Doreen… meine Verlobte starb, habe ich die Hölle durchlebt, und manchmal habe ich das Gefühl, als würde mich das ganze Elend von damals wieder einholen. Viele meiner Freunde haben nach diesem schrecklichen Unglück gesagt, ich würde dadurch wohl endlich erwachsen werden.« Er brachte ein schiefes Lächeln zustande. »Ich bin es nicht geworden, und ich will es auch nicht werden. Ich will noch nicht fertig sein…, ich möchte etwas lernen…, etwas entdecken können…, irgendwann vielleicht sogar eine neue Liebe, obwohl das jetzt noch in weiter Ferne liegt.«
Dr. Daniel war erstaunt über diese Offenheit. Noch nie hatte Jeff so viel über sich erzählt, und Dr. Daniel freute sich über das Vertrauen, das der junge Mann ihm offenbar entgegenbrachte. Impulsiv legte er einen Arm um Dr. Parkers Schultern.
»Ich bin froh, daß Sie so sind, Jeff«, meinte er, dann warf er einen Blick auf die Uhr. »Allmählich wird es Zeit für mich, nach Hause zu gehen.«
Doch Dr. Parker spürte, wie er zögerte.
»Gehen Sie nur, Robert«, erklärte er. »Ich kümmere mich schon um Ihre Patientin – abgesehen davon, daß sie sowieso die meiste Zeit schlafen wird. Immerhin hat sie eine ziemlich starke Narkose bekommen.«
Das wußte natürlich auch Dr. Daniel, trotzdem drängte es ihn, noch eine Weile bei Eva-Maria zu bleiben.
»Es ist wirklich nicht nötig, daß Sie auch noch Ihren Nachtschlaf opfern«, betonte Dr. Parker. »Ich habe sowieso Dienst, und Sie können sich darauf verlassen, daß ich…«
»Ich weiß, Jeff«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Es ist auch wirklich kein Mißtrauen gegen Sie, aber gerade nach so schwierigen Operationen ist es nicht ganz einfach für mich, mich von dem Fall zu lösen – und zudem kenne ich diese Patientin nun schon eine so lange Zeit.«
»Wenn es Sie beruhigt, rufe ich Sie an, falls sich an dem Zustand der Patientin etwas ändern sollte«, bot Dr. Parker an.
Dr. Daniel nickte. »Das würde mich tatsächlich beruhigen.« Er sah den Anästhesisten an. »Rufen Sie aber wirklich an, Jeff. Gleichgültig, um welche Uhrzeit es sein sollte.«
Dr. Parker legte die rechte Hand auf sein Herz und lächelte. »Großes Indianerehrenwort.«
Dr. Daniel mußte lachen. »Sie sind wirklich unverbesserlich.« Und dabei dachte er, daß es wohl gerade das war, was einen großen Teil von Jeffs Beliebtheit bei den Kollegen, Schwestern und Patienten ausmachte. Daneben war er natürlich auch ein herausragender Anästhesist.
*
Noch vor Beginn seiner Sprechstunde fuhr Dr. Daniel zur Waldsee-Klinik, um nach Eva-Maria zu sehen, und ihr Zustand hatte sich tatsächlich ein wenig gebessert, wenn sie im Moment auch noch schlief. Die Temperatur war ebenfalls gesunken und damit schon fast normal, was den Arzt unter den gegebenen Umständen beruhigte. Trotzdem ließ er die Patientin noch auf der Intensivstation, um kein unnötiges Risiko einzugehen.
»Der Chefarzt möchte Sie sprechen«, erklärte Schwester Bianca, als Dr. Daniel die Intensivstation verließ.
Mit einem tiefen Seufzer sah der Arzt auf die Uhr. »Eigentlich sollte jetzt meine Sprechstunde beginnen. Fräulein Sarina wird mich vierteilen, und Fräulein Meindl wird ihr dabei vermutlich helfen.«
Bianca, die sowohl Dr. Daniels Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau als auch die Empfangsdame Gabi Meindl kannte, schüttelte lächelnd den Kopf.
»Ihre beiden Damen verehren Sie viel zu sehr, als daß sie Ihnen auch nur ein Haar krümmen würden«, meinte sie. »Aber ich kann Dr. Metzler natürlich sagen, daß Sie erst mittags für ihn Zeit haben.«
Doch Dr. Daniel winkte ab. »Fünf Minuten mehr oder weniger machen jetzt eigentlich auch nichts mehr aus. Ich komme sowieso schon viel zu spät in die Sprechstunde.« Er schmunzelte. »Aber daran sind meine beiden Damen ja ebenfalls gewöhnt.«
Trotzdem machte er sich jetzt rasch auf den Weg zur Chirurgie und traf den Chefarzt Dr. Wolfgang Metzler in dessen Büro an. Erstaunt blickte der Dr. Daniel an.
»Mit dir habe ich um diese Zeit noch gar nicht gerechnet«, gab er offen zu.
»Mit mir muß man eben rechnen«, scherzte Dr. Daniel.
Der Chefarzt zog die Augenbrauen hoch. »Du bist ja richtig gut gelaunt.«
»Stimmt«, meinte Dr. Daniel. »Eine Patientin, die mir gestern abend beinahe auf dem OP-Tisch weggestorben wäre, ist jetzt auf dem Wege der Besserung. Das ist für mich ein Grund zur Freude.« Er lächelte. »Und wag es ja nicht, mir meine gute Laune mit irgendwelchen Hiobsbotschaften zu vermiesen.«
Dr. Metzler betrachtete die dünne Akte, die vor ihm lag, und zuckte die Schultern. »Ob es eine Hiobsbotschaft ist, weiß ich noch nicht. Uns wurde ein Zivildienstleistender zugeteilt. Sàndor Balog.« Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Der Name klingt irgendwie ausländisch.«
»Ungarisch«, belehrte Dr. Daniel ihn. »Sàndor wurde in Pècs geboren, kam nach dem Tod seines Vaters aber schon als Fünf-jähriger mit seiner Mutter hierher. Karin stammte ursprünglich aus Steinhausen, ging aber aus Liebe zu Jànos Balog nach Ungarn.«
»Du bist ja wieder mal glänzend informiert«, stellte Dr. Metzler fest. »Komisch, ich bin in Steinhausen geboren und aufgewachsen, aber…«
»Aber dann bist du für etliche Jahre ins Ausland gegangen«, vollendete Dr. Daniel den angefangenen Satz seines Kollegen. »Währenddessen ist in Steinhausen die Zeit allerdings auch nicht stehengeblieben.« Er lächelte. »Auch wenn man manchmal diesen Eindruck haben könnte.«
Dr. Metzler nickte. »Ja, da hast du wohl recht.« Er schwieg einen Moment und betrachtete wieder die Akten vor sich. »Was ist dieser Sàndor eigentlich für ein Mensch?«
»Ein sehr sympathischer junger Mann, der keine Arbeit scheut«, urteilte Dr. Daniel. »Ich könnte mir sogar vorstellen, daß er sich für diese Art Zivildienst entschieden hat, um später einmal Krankenpfleger zu werden. Er hat sich schon als Teenager sozial sehr engagiert, hat oft freiwillig im Altenheim der Kreisstadt und im Behindertenheim in München gearbeitet.«
»Das klingt ja wirklich äußerst vielversprechend«, gab Dr. Metzler überrascht zu.
»Was bedeutet, daß du wieder einmal Vorurteile hattest«, bemerkte Dr. Daniel. »Wahrscheinlich hast du allein schon bei dem Wort ›Zivildienstleistender‹ rot gesehen, habe ich recht?«
Dr. Metzler wurde bei diesen Worten tatsächlich ein bißchen verlegen.
»Aha, jetzt bekomme ich also auch noch den Kopf gewaschen«, grummelte er.
»Nein, Wolfgang, absolut nicht, aber du solltest dir den Menschen immer erst vorher anschauen und dir danach ein Urteil von ihm bilden – nicht umgekehrt.«
»Danke, das war deutlich«, knurrte Dr. Metzler. »Aber ich werde es mir merken.«
»Sehr schön.« Dr. Daniel lächelte. »Und nun sei bitte nicht beleidigt.«
Dr. Metzler seufzte, mußte dann aber ebenfalls lächeln. »Bin ich ja auch gar nicht. Es ist nur…, du triffst mit deiner Kritik immer haargenau den wunden Punkt, und das tut einem meistens ziemlich weh.«
Er schwieg kurz. »Und jetzt mach, daß du in deine Praxis kommst, bevor dir noch mehr Sachen einfallen, die du an mir kritisieren könntest. Für heute ist mein Bedarf in dieser Richtung nämlich schon wieder gedeckt.«
Dr. Daniel mußte lachen. »Na, so schlimm wird’s schon nicht gewesen sein. Aber zumindest in einem hast du recht: Ich muß mich jetzt wirklich beeilen.« Er war schon an der Tür, als er noch einmal zurückblickte. »Wenn Sàndor kommt, dann ruf mich bitte an. Ich würde mich gern ein bißchen näher mit ihm unterhalten.«
»Wird gemacht, Herr Direktor!« seufzte Dr. Metzler kopfschüttelnd, während Dr. Daniel das Büro und wenig später auch die Klinik verließ. Er ahnte bereits, daß in seiner Praxis eine regelrechte Invasion herrschen würde.
*
Die Allgemeinmedizinerin Dr. Manon Daniel, die zusammen mit ihrem Mann eine Gemeinschaftspraxis im Erdgeschoß der stattlichen Villa am Kreuzbergweg führte, hatte ihr Ordinationszimmer gerade betreten, als ihre Sprechstundenhilfe Brigitte Klein den ersten Patienten hereinbegleitete.
»Guten Morgen, Herr Balog«, grüßte Manon mit einem freundlichem Lächeln. »Was führt Sie zu mir?«
»Eigentlich nichts Besonderes«, entgegnete der junge Mann mit dem markanten Gesicht und den dunklen Locken. »Ich soll morgen früh meinen Dienst in der Waldsee-Klinik antreten, und da muß ich mich vorher noch untersuchen lassen.« Er lächelte. »Eigentlich Unsinn, weil ich doch vollkommen gesund bin, aber Vorschrift ist eben Vorschrift, und ich will mit dem Chefarzt ja nicht schon am ersten Tag einen Strauß ausfechten.«
Manon mußte lachen. »Ich denke doch, Sie wollen mit ihm überhaupt keinen Strauß ausfechten, oder?«
»Ganz bestimmt nicht«, bekräftigte Sàndor, dann lächelte er wieder. »Ich freue mich schon sehr auf meine künftige Arbeit.«
»Machen Sie jetzt eine Ausbildung als Krankenpfleger?« wollte Manon wissen.
Sàndor schüttelte den Kopf. »Nein, ich leiste nur meinen Zivildienst ab.«
»Sie werden in den kommenden Monaten viel arbeiten müssen, und es wird nicht immer eine leichte Arbeit für Sie sein.«
»Das weiß ich«, erklärte Sàndor. »Ich habe früher schon oft im Altenheim der Kreisstadt ausgeholfen.« Er wurde fast ein bißchen verlegen, als er gestand: »Wissen Sie, eigentlich wollte ich ja Arzt werden, aber…« Er zuckte die Schultern. »Leider habe ich das Gymnasium nicht gepackt… jedenfalls nicht mit dem dafür erforderlichen Notendurchschnitt, den ich fürs Medizinstudium gebraucht hätte. Und ein anderes Studium hätte mich nicht interessiert. Ich habe also meinen Abschluß gemacht, und der Zivildienst gibt mir nun eine gute Gelegenheit, in den Beruf eines Krankenpflegers wenigstens mal hineinzuschnuppern.«
Der junge Mann gefiel Manon. Obwohl er gerade erst zwanzig Jahre alt war, wußte er offensichtlich schon sehr genau, was er anfangen wollte. Und dabei ließ er sich auch von schwerer und sicher nicht immer sehr angenehmer Arbeit keineswegs abhal-
ten.
»Also, Herr Balog, dann will ich Sie mal untersuchen«, erklärte Manon und stand auf. »Als erstes wird Ihnen meine Sprechstundenhilfe ein bißchen Blut abnehmen. Sind Sie einverstanden, wenn ich das Ergebnis gleich direkt an die Waldsee-Klinik weiterleite?«
Sàndor nickte. »Selbstverständlich.« Wieder wurde er ein bißchen verlegen. »Eigentlich hätte ich diese Untersuchung schon viel früher machen lassen müssen, aber…, na ja, wer reißt sich schon darum, zum Arzt zu gehen, wenn er sich vollkommen gesund fühlt.«
»Dr. Metzler ist in diesen Dingen zwar ziemlich streng und achtet innerhalb der Klinik auch sehr auf Disziplin«, meinte Manon. »Trotzdem wird er Ihnen wegen der verspäteten Untersuchung sicher nicht gleich den Kopf abreißen.«
Sàndor lächelte. »Ich hoffe doch sehr, daß er das unterläßt.« Dann erhob er sich ebenfalls und folgte Manon in einen kleinen Raum.
»Legen Sie sich einstweilen auf die Liege«, bat Manon. »Fräulein Klein wird sich sofort um Sie kümmern. Anschließend kommen Sie dann wieder zu mir.«
Sàndor kam der Aufforderung nach, aber noch bevor er sich hinlegte, meinte er: »Mir wird beim Blutabnehmen bestimmt nicht schlecht. Ich meine…, ich würde das auch im Sitzen sicher gut verkraften können.«
»Das glaube ich Ihnen unbesehen«, erwiderte Manon. »Aber bei mir in der Praxis wird grundsätzlich im Liegen Blut abgenommen.«
»Wenn das so ist, dann will ich natürlich keine Sonderbehandlung verlangen«, verwahrte sich Sàndor und legte sich nun auf den Rücken.
Es dauerte wirklich nur kurze Zeit, bis Brigitte Klein den Raum betrat. Sie lächelte zwar, doch ihr Gesicht war so blaß, daß es sogar Sàndor auffiel.
»Ist Ihnen nicht gut?« fragte er besorgt.
»Doch, alles in Ordnung«, behauptete Brigitte, dann legte sie einen Gurt um Sàndors rechten Oberarm und strich mit dem Mittelfinger der rechten Hand über seine Armbeuge, um eine Vene zu finden, in die sie einstechen konnte.
»Jetzt piekst es ein bißchen«, warnte sie ihn, während sie nach der Einwegspritze griff. Geschickt stach sie in die Vene ein und zog den Kolben zurück. Als sich das Röhrchen langsam mit Blut füllte, begann Brigitte plötzlich auffallend zu schwanken. Ihre Hände begannen zu zittern, und dann sackte sie mit einem leisen Seufzen zusammen.
»Meine Güte«, entfuhr es Sàndor, während er ungeachtet der Tatsache, daß die Nadel noch in seiner Armbeuge steckte, von der Liege herunterstieg und sich über die ohnmächtige Sprechstundenhilfe beugte.
»Frau Doktor!« rief er. »Schnell!«
Manon eilte sofort herein und erfaßte die Lage mit einem Blick.
»Legen Sie sich wieder hin, Herr Balog«, bat sie. »Ich kümmere mich gleich um Sie.«
»Eilt wirklich nicht«, meinte er. »Versorgen Sie nur erst die junge Frau. Sie kam mir vorhin schon so schrecklich blaß vor.«
Manon nickte nur, brachte Brigitte in eine stabile Seitenlage und schob ein Kissen unter ihre Beine. Im selben Moment kam die junge Sprechstundenhilfe wieder zu sich, doch als sie sich aufrichten wollte, hielt Manon sie zurück.
»Bleiben Sie erst mal liegen, Fräulein Klein«, erklärte sie. »Sie sind ohnmächtig geworden.«
»Es…, es geht aber schon wieder«, stammelte Brigitte leise, dann huschte eine verlegene Röte über ihr immer noch unnatürlich blasses Gesicht. »Ich bin allmählich daran gewöhnt. In letzter Zeit hatte ich das leider schon öfter.«
»Ein Grund mehr, daß Sie liegenbleiben müssen«, betonte Manon, dann stand sie auf. »So, Herr Balog, jetzt befreie ich Sie endlich von der Nadel.«
Durch seine Bewegungen, als er Brigitte helfen wollte, hatte er sich die Vene durchstochen, und obwohl Manon nun mit einem mehrfach gefalteten Mulläppchen fest auf die Einstichstelle drückte, ließ sich der Schaden nicht mehr beheben.
»Ich fürchte, da ist Ihnen ein riesiger blauer Fleck sicher«, meinte sie bedauernd.
»Nicht so tragisch«, entgegnete Sàndor gelassen. »Der vergeht auch irgendwann wieder.«
Kaum verarztet, stand er auch schon auf, nahm Brigitte kurzerhand auf seine starken Arme und hob sie nun auf die Untersuchungsliege.
»Ich gehe in der Zwischenzeit ins Wartezimmer«, erklärte er ohne große Umstände. »Versorgen Sie nur erst die junge Frau.«
»Ein netter Mann«, urteilte Brigitte noch mit etwas schwacher Stimme. »So mancher andere wäre vielleicht ärgerlich geworden.« Wieder errötete sie. »Es ist mir so peinlich, daß ich gerade jetzt umgekippt bin… während der Blutabnahme. So etwas ist mir noch nie passiert.« Sie schüttelte den Kopf. »Als ich das Blut sah…, mir wurde plötzlich so furchtbar schlecht…«
»Sie sagten vorhin, Sie wären schon öfter ohnmächtig geworden«, erinnerte Manon sie, während sie die Manschette um Brigittes Oberarm legte, um den Blutdruck zu messen.
»Ja, aber noch nie vor einem Patienten. Meistens bei der Auswertung von Urin- und Blutproben…, einmal auch zu Hause, als ich mir ein Schnitzel machen wollte und das rohe Fleisch sah… In die Metzgerei wage ich mich inzwischen schon gar nicht mehr hinein.«
»Neunzig zu sechzig«, erklärte Manon und nahm die Manschette wieder ab. »Der Blutdruck ist förmlich in den Keller gesackt. Ich werde Ihnen jetzt ein bißchen Blut abnehmen und Dr. Scheibler bitten, es gleich für mich auszuwerten.«
»Die Ärzte der Waldsee-Klinik sind doch ohnehin schon so eingespannt«, wehrte Brigitte ab. »Und gerade der Oberarzt…«
»Das soll nicht Ihre Sorge sein«, fiel Manon ihr ins Wort. »Fräulein Klein, wenn Sie ständig ohnmächtig werden, dann muß man dieser Sache unbedingt auf den Grund gehen.« Sie schwieg kurz, bevor sie mit leisem Tadel in der Stimme hinzufügte: »Ich finde es gerade von Ihnen als Arzthelferin etwas nachlässig, daß Sie mit dieser Sache nicht von sich aus zu mir gekommen sind.«
»Ich hatte Angst«, gestand Brigitte. »Wenn es nun etwas Ernstes ist…«
»Gerade deshalb hätten Sie sich mir ja anvertrauen müssen.« Dann jedoch tätschelte Manon beruhigend ihren Arm. »Aber es kann sich ja auch nur um etwas verhältnismäßig Harmloses handeln…, eine leichte Anämie vielleicht.«
Brigitte nickte zwar, doch Manon sah ihr an, daß sie daran nicht mehr so recht glauben konnte – für die Ärztin ein weiterer Beweis, daß ihre Sprechstundenhilfe bei der Beschreibung ihres derzeitigen Gesundheitszustandes nicht ganz ehrlich gewesen war.
*
Dr. Daniel war erstaunt, als er gegen Mittag in den anderen Teil der Praxis hinüberging, um seine Frau zum Essen abzuholen, und das Wartezimmer brechend voll vorfand. Zwischen zwei Patienten mogelte er sich in Manons Sprechzimmer hinein.
»Ja, sag mal, Liebling, was ist denn bei dir los?« wollte er wissen. »Ist etwa eine Epidemie ausgebrochen?«
Manon seufzte. »Nein, aber meine Sprechstundenhilfe ist heute früh umgekippt.«
Besorgt runzelte Dr. Daniel die Stirn. »Etwas Ernstes?«
»Ich hoffe nicht. Gerrit hat zugesagt, ihre Blutprobe bis mittags auszuwerten, aber ich werde wohl gar nicht dazu kommen, mit ihm darüber zu sprechen. Zuerst muß ich mich um meine Patienten kümmern.«
Mißbilligend schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Und warum sagst du mir dann nichts davon? An deinem Telefon befindet sich ein Knopf, mit dem du mich direkt in meinem Sprechzimmer erreichen kannst.«
Manon lächelte entschuldigend. »Nicht einmal dazu hatte ich heute Zeit.«
»Na ja, jetzt werde ich mich mal um die Sache kümmern. Als erstes schicke ich dir Stefan herunter, damit er dir bei der Sprechstunde helfen kann. Er hat heute dienstfrei, und zufällig weiß ich, daß er noch oben in der Wohnung ist.«
»Robert, das ist wirklich nicht…«
»Doch, es ist dringend nötig, sonst sitzt du nämlich bis heute abend hier unten, und Stefan freut sich auch, wenn er ein bißchen Verantwortung übernehmen darf – gerade jetzt, wo sich seine Assistenzzeit dem Ende nähert.« Er schwieg einen Moment. »In der Zwischenzeit werde ich zur Waldseeklinik hinüberfahren und mir das Ergebnis der Blutprobe anschauen. Möglicherweise muß Fräulein Klein sogar in die Klinik, aber das können wir ja dann gemeinsam mit ihr besprechen. Wo ist sie jetzt?«
»Ich habe sie mehr oder weniger genötigt, sich hinzulegen.«
Dr. Daniel nickte. »Dann schicke ich dir Fräulein Sarina herüber. Sie bleibt über Mittag meistens in der Praxis und wird sicher bereit sein, für Fräulein Klein einzuspringen.«
Das war für Sarina von Geh-rau tatsächlich keine Frage, und auch Stefan zögerte keine Sekunde, in Manons zweitem Sprechzimmer einen Teil ihrer Patienten zu untersuchen und zu behandeln.
Dr. Daniel selbst nahm sich unter diesen Umständen ebenfalls keine Zeit zum Mittagessen, sondern fuhr sofort in die Waldsee-Klinik und machte sich dort auf die Suche nach dem Oberarzt Dr. Gerrit Scheibler. Er fand ihn im Labor, wo er gerade mit der Auswertung von Blutproben beschäftigt war.
»Bitte, Robert, drängen Sie mich nicht«, bat er inständig. »Ich ersticke förmlich in Arbeit.«
Dr. Daniel nickte. »Das sehe ich. Kann ich Ihnen helfen?«
Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Das ist nett gemeint, aber ich fürchte, durch diesen Wust von Arbeit muß ich mich allein quälen.« Er warf Dr. Daniel einen kurzen Blick zu. »Ich nehme an, Ihre Frau schickt Sie.«
»Ganz so würde ich das nicht bezeichnen«, entgegnete Dr. Daniel wider Willen schmunzelnd. »Ich mußte Manon beinahe zwingen, sich helfen zu lassen.«
Dr. Scheibler lächelte ebenfalls, ohne sich aber in seiner Arbeit unterbrechen zu lassen. »In ein paar Minuten bin ich fertig.«
»Ich gehe in der Zwischenzeit zur Intensivstation und sehe nach Fräulein Neubert«, erklärte Dr. Daniel. »Ich komme dann wieder her. Sie müssen mir das Ergebnis der Blutuntersuchung also nicht noch hinterhertragen.«
»Danke, Robert, aber ich glaube, das hätte ich heute sowieso nicht tun können.«
Dr. Daniel winkte ab. »Ich kenne Sie.«
Dr. Scheibler nickte bedeutungsvoll. »Das scheint mir auch so.«
»Also, bis gleich«, meinte Dr. Daniel, dann verließ er das Labor und ging raschen Schrittes zur Intensivstation hinüber.
Eva-Maria war wach, und ein Blick auf den Monitor zeigte Dr. Daniel, daß ihre Werte zu gut waren, um einen weiteren Aufenthalt auf dieser Station zu rechtfertigen.
»Du hast dich ja wirklich schnell erholt«, stellte er erfreut fest.
»Finden Sie?« entgegnete Eva-Maria zweifelnd. »Ich fühle mich miserabel, und die Schmerzen im Bauch kommen auch schon wieder.«
»Das kann ich mir vorstellen«, meinte Dr. Daniel. »Du hast schließlich eine lange und sehr schwierige Operation hinter dir. Wenn man sich das alles vor Augen hält, dann hast du dich tatsächlich sehr schnell erholt.« Er lächelte. »Das bedeutet allerdings nicht, daß du jetzt gleich wieder nach Hause gehen kannst. Ein Weilchen wirst du schon noch hierbleiben müssen, aber heute nachmittag kannst du immerhin auf die normale Station verlegt werden. Das ist für dich dann ein bißchen angenehmer.« Während er gesprochen hatte, hatte er eine Spritze vorbereitet, die er wiederum direkt in die Infusionskanüle injizierte. »Die Schmerzen werden gleich besser werden, Eva-Maria.« Er kontrollierte das Thermometer, doch das junge Mädchen hatte kein Fieber mehr, woraufhin Dr. Daniel den Temperaturfühler gleich entfernte.
»Was war das?« wollte Eva-Maria wissen. »Es hat die ganze Zeit so schrecklich gedrückt, aber die Schwester sagte, es müsse dort bleiben, wo es ist.«
»Das war nur eine Art Fieber-thermometer«, antwortete Dr. Daniel. »Aber es ist jetzt nicht mehr nötig, deine Temperatur rund um die Uhr zu kontrollieren.«
In diesem Moment trat Schwester Bianca herein.
»Gut, daß Sie kommen«, meinte Dr. Daniel. »Fräulein Neubert kann auf die normale Station verlegt werden. Temperaturfühler ist bereits draußen, Katheder und Infusion müssen noch ein paar Tage bleiben. Kontrollieren Sie bitte dreimal täglich Temperatur, Blutdruck und Puls. Sollte irgend etwas nicht normal sein, benachrichtigen Sie mich bitte auf der Stelle.«
»In Ordnung, Herr Doktor«, stimmte Bianca zu.
Dr. Daniel wandte sich noch einmal an Eva-Maria. »Heute abend komme ich wieder zu dir, und soviel ich weiß, werden dich deine Eltern heute nachmittag besuchen.«
Eva-Maria preßte die Lippen zusammen, dann schüttelte sie den Kopf.
»Ich…, ich möchte nicht…« wehrte sie leise ab. »Wenn sie mir Vorwürfe machen…«
Aufmerksam sah Dr. Daniel sie an. »Haben sie denn einen bestimmten Grund dazu?«
Eva-Maria zuckte die Schultern. »Ich hatte eine Fehlgeburt und liege im Krankenhaus…, das sind vermutlich Gründe genug, um mir Vorwürfe zu machen.«
»Nicht unbedingt«, entgegnete Dr. Daniel. »Allerdings…, wenn du heute noch keinen Besuch empfangen möchtest, dann kann ich deine Eltern davon benachrichtigen.«
Eva-Maria nickte. »Ja, bitte, Herr Doktor. Ich…, ich möchte nicht, daß sie mich so sehen…, mit all diesen Schläuchen…« Doch ihr Erröten bewies, daß das nur die halbe Wahrheit war.
»In Ordnung, Eva-Maria«, stimmte Dr. Daniel nachdenklich zu, zögerte einen Moment und fuhr dann fort: »Ich nehme an, daß ich heute abend noch ein paar Fragen an dich haben werde, und ich hoffe, daß du mir dann die ganze Wahrheit anvertrauen wirst.«
Wieder errötete das junge Mädchen, blieb die Antwort aber schuldig.
»Eine ziemlich harte Nuß«, urteilte Dr. Parker, als er Dr. Daniel auf dem Flur vor der Intensivstation begegnete.
Der Arzt seufzte. »Ich weiß nicht, Jeff, Eva-Maria war immer ein sehr liebes, nettes Mädchen. Ihr momentanes Verhalten paßt irgendwie gar nicht zu ihr – ebenso wie die Tatsache, daß sie sich die Spirale nicht entfernen ließ, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr.« Er runzelte die Stirn. »Wie kommen Sie überhaupt zu einer solchen Ansicht?«
»Ich kam zufällig dazu, als Fräulein Neubert Schwester Bianca förmlich bekniete, ihr den Temperaturfühler zu entfernen«, erzählte Dr. Parker. »Ich weiß natürlich, daß der Druck, den er verursacht, recht unangenehm ist, aber zu diesem Zeitpunkt konnten wir ihrem Wunsch einfach noch nicht entsprechen. Um sie von den ganzen Unannehmlichkeiten ein wenig abzulenken, habe ich versucht, mit ihr zu sprechen, doch sie zeigte sich dabei äußerst verstockt und gab mir – wenn überhaupt – nur sehr knappe, fast schon unfreundliche Antworten.«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Auch das ist untypisch für sie, aber ich hoffe doch sehr, daß ich herausbekommen werde, was sie so verändert hat.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Meine Güte, schon so spät! Ich muß ja schnellstens ins Labor hinüber.«
Er verabschiedete sich hastig von dem jungen Anästhesisten und eilte zu Dr. Scheibler, der inzwischen mit der Auswertung von Brigitte Kleins Blutprobe fertig war.
»Ich dachte schon, Sie hätten vergessen, noch einmal herzukommen«, empfing ihn der Oberarzt nicht ganz ernst.
»Ich stehe zwar wieder mal im Streß«, entgegnete Dr. Daniel. »Aber im ganzen funktioniert mein Gedächtnis noch recht gut.«
»Daran habe ich auch nicht gezweifelt«, verwahrte sich Dr. Scheibler, dann reichte er Dr. Daniel das Blatt, auf dem die Ergebnisse verzeichnet waren, faßte seine Erkenntnisse aber gleich kurz zusammen. »Die Blutsenkung ist beschleunigt und der Eisenwert zu niedrig. Der Eisenmangel ist aber nicht so gravierend, daß er für die Ohnmachtsanfälle der Patientin die Ursache sein sollte.«
Dr. Daniel lächelte. »Woraufhin Sie natürlich den HCG-Wert überprüft haben.«
Dr. Scheibler nickte. »Richtig, und ich würde sagen, die Patientin ist schwanger.« Bei dieser Nachricht blieb er ungewöhnlich ernst, doch mit dem Grund dafür hielt er nicht lange hinter dem Berg. »Allerdings – und das ist nun die schlechte Nachricht – leidet Fräulein Klein an Diabetes. Möglicherweise ist es ihr bekannt, aber ich vermute eigentlich eher Gestationsdiabetes, so daß sich dieser Zustand nach der Schwangerschaft wahrscheinlich wieder verflüchtigen wird.«
»Was die augenblickliche Gefahr für das Kind aber leider nicht vermindert«, meinte Dr. Daniel stirnrunzelnd und nahm nun auch das zweite Blatt Papier entgegen, das Dr. Scheibler ihm reichte. »»Ich werde sofort mit Manon und Fräulein Klein sprechen. Wenn wir die Zuckerkrankheit in den Griff bekommen, kann sie ja dennoch eine normale Schwangerschaft und Geburt haben.« Er reichte dem Oberarzt die Hand. »Danke, Gerrit, daß Sie das gleich für mich erledigt haben.«
»Ist doch selbstverständlich.« Er schwieg kurz. »Grüßen Sie Fräulein Klein von mir, und sagen Sie ihr, ich würde ihr auf jeden Fall alles Gute wünschen.«
*
Als Dr. Daniel die Praxis wieder erreichte, war das Wartezimmer leer.
»Manon?« rief er fragend.
»Ich bin hier!« erklang ihre helle Stimme aus dem kleinen Raum, der normalerweise für Blutabnahmen gebraucht wurde.
Als Dr. Daniel eintrat, sah Manon ihm erwartungsvoll entgegen. Brigitte Klein, die noch immer auf der Untersuchungsliege lag, richtete sich ein wenig auf, dann versuchte sie, im Gesicht des Arztes zu lesen.
»Sie bringen schlechte Nachrichten, nicht wahr?« Ihre Stimme klang dabei sehr leise und voller Angst.
»Nein, Fräulein Klein«, entgegnete Dr. Daniel beruhigend. »Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie es jetzt vielleicht denken.« Er lehnte sich an die Kante der Untersuchungsliege und griff wie tröstend nach Brigittes Hand. »Die Blutuntersuchung hat ergeben, daß Sie schwanger sind.«
Die junge Frau erschrak zutiefst, dann verbarg sie ihr Gesicht in den Händen.
»Ausgerechnet jetzt«, stammelte sie, und man hörte ihr dabei die Verzweiflung an. »Oliver wird aus allen Wolken fallen. Wir wollten doch noch gar nicht…«
Dr. Daniel und Manon tauschten einen kurzen Blick. Die Ärztin erkannte die Besorgnis in den Augen ihres Mannes. Sie ahnte, daß die Schwangerschaft für ihn noch nicht das eigentliche Problem darstellte.
Jetzt ließ Brigitte die Hände sinken und sah Dr. Daniel bittend an.
»Können Sie es wegmachen?«
»Ich glaube nicht, daß Sie eine so wichtige Entscheidung jetzt übers Knie brechen sollten«, entgegnete Dr. Daniel, der genau wußte, daß im Moment Verzweiflung und Ratlosigkeit aus Brigitte sprachen. »Gleichgültig, mit welcher Reaktion Sie von Ihrem Freund rechnen – er sollte doch zumindest erfahren, daß er im Begriff ist, Vater zu werden. Möglicherweise ist er ja gar nicht so entsetzt darüber, wie Sie es jetzt befürchten.«
»Das ist er bestimmt«, flüsterte Brigitte und war dabei den Tränen nahe. »Wir haben doch erst vor einem Jahr den Baugrund gekauft, und jetzt…, der Rohbau steht zwar, aber wir stecken bis zum Hals in Schulden. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann…, wie soll es denn dann weitergehen?«
Es widerstrebte Dr. Daniel, Brigitte jetzt mit noch einem weiteren Problem zu belasten, doch er hatte als Arzt keine andere Wahl.
»Das alles ist sehr schlimm, Fräulein Klein«, meinte er. »Aber ich bin sicher, daß sich die finanziellen Schwierigkeiten irgendwie beheben lassen würden.«
Mit einem Ruck hob Brigitte den Kopf, die aus seinen Worten etwas Bestimmtes herausgehört zu haben glaubte. »Ist mit dem Kind etwas nicht in Ordnung?« Sie wartete seine Antwort gar nicht erst ab, sondern fügte sofort hinzu: »Dann verlange ich ohnehin eine Abtreibung.«
»Es geht nicht um das Kind, Fräulein Klein, sondern um Sie«, entgegnete Dr. Daniel ruhig. »Wurde bei Ihnen jemals Diabetes festgestellt?«
Brigitte erbleichte. Ihr Gesicht war jetzt von beinahe durchscheinender Blässe, so daß Manon besorgt nähertrat. Sie hätte sich nicht gewundert, wenn Brigitte plötzlich erneut ohnmächtig zurückgesunken wäre.
»Diabetes?« Ihre Stimme war nicht mehr als ein Flüstern. »Oh, mein Gott.«
»Da Sie offensichtlich noch nie an Zuckerkrankheit gelitten haben, vermute ich, daß es sich bei Ihnen um eine sogenannte Gestationsdiabetes handelt. Ich nehme an, Sie wissen, was das ist.«
Brigitte nickte schwach. »Eine vorübergehende Zuckerkrankheit, die nur in der Schwangerschaft auftritt.«
»Trotzdem ist damit nicht zu spaßen«, erklärte Dr. Daniel. »Die Gefahren, die für das Kind entstehen, sind ebenso groß wie bei der normalen Zuckerkrankheit..«
Da brach Brigitte in Tränen aus. Ihr ganzes Leben lag plötzlich in Scherben vor ihr, und sie hatte im Moment keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Impulsiv legte Manon einen Arm um ihre bebenden Schultern.
»Wir werden jetzt ganz systematisch vorgehen, Fräulein Klein«, betonte Dr. Daniel, und seine tiefe, warme Stimme zeigte wieder einmal Wirkung. Brigitte wurde spürbar ruhiger, während Manon sie tröstend streichelte. »Als erstes werde ich Sie in die Waldsee-Klinik überweisen, damit ich Sie und das Baby gründlich untersuchen kann. Wir werden Ihre Diabetes behandeln. Im übrigen wird Ihnen die Ruhe dort draußen bestimmt guttun, und wenn Sie möchten, werden meine Frau und ich Ihnen gern beistehen, wenn Sie mit Ihrem Freund sprechen«, bot Dr. Daniel ihr an.
Brigitte nickte zuerst, doch dann schüttelte sie den Kopf. »Ich…, ich weiß nicht…, Oliver muß ja denken…«
»Wenn er Sie liebt, wird er dafür Verständnis haben«, meinte Manon, dann half sie Brigitte von der Liege herunter.
Mit langsamen, schleppenden Schritten folgte die junge Frau den beiden Ärzten nach draußen und stieg dann in Dr. Daniels Wagen. Es hatte zu regnen begonnen, und das trübe Wetter paßte genau zu Brigittes momentaner Stimmung. Auch in ihr sah alles grau und trostlos aus.
*
Der erste Eindruck, den Dr. Wolfgang Metzler von Sàndor Balog bekam, war mehr als positiv. Der junge Mann sah absolut nicht so aus, als würde er hier nur seine Dienstzeit absitzen wollen.
»Es wartet eine Menge Arbeit auf Sie«, erklärte Dr. Metzler schließlich. »Und es wird manchmal eine äußerst unangenehme Arbeit sein.«
»Das macht nichts«, urteilte Sàndor. »Ich habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen.« Er zögerte einen Moment, rückte dann aber mit seinem eigentlichen Anliegen doch heraus. »Herr Chefarzt, ich fürchte, es ist viel zu früh dafür, aber…, glauben Sie, daß später…, wenn ich meinen Zivildienst abgeleistet habe…, daß dann hier für mich einmal eine Stelle frei sein wird?«
Dr. Metzler lächelte. Es gefiel ihm, daß der junge Mann bereits jetzt an seine weitere Zukunft dachte.
»Ja, Herr Balog, ich denke schon«, meinte er. »Für einen tüchtigen Krankenpfleger ist in der Waldsee-Klinik immer Platz.«
Sàndor lächelte. »Das ist schön. Wissen Sie, ich habe mitbekommen, wie die Klinik entstanden ist, und seitdem war es immer mein Wunsch, hier zu arbeiten. Ich bin froh, daß ich jetzt endlich die Möglichkeit dazu habe.«
»Das höre ich natürlich gern«, erklärte Dr. Metzler, dann reichte er Sàndor die Hand. »Ich denke, wir werden gut zusammenarbeiten.« Er begleitete den jungen Mann hinaus. »Ich werde Sie jetzt unserem Oberarzt anvertrauen. Dr. Scheibler wird Ihnen die Klinik zeigen und Ihnen wohl auch schon die ersten Aufgaben zuteilen. Eine lange Eingewöhnungszeit werden Sie vermutlich nicht haben.«
»Die brauche ich auch nicht. Schließlich bin ich ja zum Arbeiten hergekommen.«
»Dieses Eingeständnis war ein großer Fehler.«
Mit diesen Worten und einem freundlichen Lächeln kam Dr. Gerrit Scheibler auf ihn zu und reichte ihm nun auch die Hand, um sich vorzustellen.
»Ich werde Sie jetzt nämlich gleich mit Arbeit nur so überhäufen«, prophezeite er, doch so schlimm wurde es dann gar nicht.
Dr. Scheibler machte ihn mit dem übrigen Personal bekannt und zeigte ihm die Räumlichkeiten der Klinik, dann warf er einen Blick auf die Uhr.
»Da sind wir ja gerade rechtzeitig fertiggeworden«, meinte er. »Unsere Krankenpflegehelferin Darinka Stöber beginnt in ein paar Minuten mit der Verteilung des Mittagessens. Da dürfen Sie jetzt gleich mithelfen. Finden Sie allein in die Chirurgie hinüber, oder brauchen Sie mich?«
»Nein, Herr Oberarzt, so groß und unübersichtlich ist die Klinik nicht, daß ich mich hier verlaufen könnte«, erklärte Sàndor.
Dr. Scheibler nickte. »Gut, dann also an die Arbeit. An-schließend können Sie in die Kantine zum Mittagessen gehen, und nachher melden Sie sich dann wieder bei mir.«
»In Ordnung, Herr Oberarzt.«
Eiligen Schrittes durchquerte Sàndor die Eingangshalle und lief dann die Treppe hinauf.
»Ein netter Junge«, urteilte Dr. Scheibler, als der Chefarzt auf ihn zukam.
Dr. Metzler nickte. »Wenn man Robert glauben darf, dann haben wir mit ihm wirklich einen guten Fang gemacht.«
»Das Gefühl habe ich auch. Es scheint, als würde er keiner Arbeit aus dem Weg gehen, und genauso etwas brauchen wir hier. Die Schwestern sind ohnehin restlos überlastet.«
Das bemerkte auch Sàndor schon nach wenigen Stunden, was seinen Entschluß, hier kräftig mit zuzupacken, nur noch mehr festigte, und die Krankenschwestern waren für diese Unterstützung sehr dankbar.
»Sàndor, auch auf die Gefahr hin, daß du uns bald zusammenbrichst…«, begann Schwester Bianca, als der junge Zivildienstleistende mit einem Packen Bettwäsche den Flur entlangkam.
Jetzt grinste er. »So schnell bin ich nicht unterzukriegen. Was liegt denn an?«
»Ich muß bei einer Patientin Temperatur, Blutdruck und Puls kontrollieren«, erklärte Bianca. »Ich zeige dir, wie das geht, und ab morgen könntest du das dann übernehmen.«
»Wirklich?« vergewisserte sich Sàndor, und seine strahlenden Augen bewiesen, daß er sich über diese neue Aufgabe freute. »Du willst mich tatsächlich schon auf die Patienten loslassen?«
Bianca lachte. »Da habe ich bei dir eigentlich wenig Bedenken. Ich glaube, du wirst schon in Kürze die Herzen aller anwesenden Damen gebrochen haben – gleichgültig, ob es sich nun um Patientinnen oder Personal handelt.«
Sàndor errötete. »Hör bloß auf. Ich bin doch kein Casanova.«
Du hättest aber das Zeug dazu, dachte Bianca, sprach es jedoch nicht aus, um den jungen Mama jetzt nicht noch verlegener zu machen. Offensichtlich war ihm ja überhaupt nicht bewußt, wie gut er aussah und welchen
Charme er ganz ungewollt versprühte.
Dann betraten sie gemeinsam das Zimmer der Patientin, von der Bianca gesprochen hatte.
»Guten Tag, Fräulein Neubert«, grüßte die Schwester freundlich, doch von dem jungen Mädchen erfolgte kaum eine Reaktion. Mit ernsten, traurigen Augen schaute sie zur Tür, wandte den Blick aber gleich wieder ab.
»Ich möchte Ihnen unseren neuen Krankenpfleger vorstellen«, fuhr Bianca ungeachtet der Teilnahmslosigkeit der Patientin fort. »Er heißt Sàndor und wird ab morgen regelmäßig zu Ihnen kommen, um Temperatur, Puls und Blutdruck zu kontrollieren.«
Eva-Maria Neubert betrachtete den jungen Mann eine Weile, dann brachte sie sogar ein kurzes Lächeln zustande, doch ihre Augen blieben ernst. Im nächsten Moment war ihr flüchtiges Interesse schon wieder erloschen.
»Was ist mit ihr?« wollte Sàndor wissen, als er mit Bianca wieder auf dem Flur stand.
Die junge Stationsschwester seufzte. »Sie hatte eine Fehlgeburt. Etwas Genaueres weiß noch niemand. Sie spricht ja kein Wort, allein Dr. Daniel gegenüber ist sie ein ganz klein wenig aufgeschlossener.«
Sàndor lächelte. »Ich glaube, es gibt niemanden, der Dr. Daniel gegenüber nicht aufgeschlossen wäre.«
»Du kennst ihn?«
»Ja, ich war fünf, als meine Mutter und ich nach Steinhausen kamen. Mama war erst kurz zuvor Witwe geworden und ich noch voller Sehnsucht nach meinem Papa. Dr. Daniel hat uns damals viel geholfen.«
Bianca betrachtete ihn etwas eingehender. Er wirkte so unbeschwert, daß man nicht auf den Gedanken gekommen wäre, er könnte in seinem Leben schon sehr viel Leid mitgemacht haben. Doch die wenigen Worte, die er über sich und seine Eltern gesprochen hatte, ließen auf sehr schicksalsschwere Jahre schlie-ßen.
»Dr. Daniel ist ein wundervoller Mensch«, erklärte Bianca gedankenvoll, weil sie nicht sicher war, ob sie sich weiter nach Sàndors Vergangenheit erkundigen sollte.
»Ja, das ist er wirklich«, bestätigte der junge Mann, dann wanderte sein Blick zur Tür, hinter der er das traurige Mädchen wußte. »Hoffentlich kann er ihr helfen.«
*
Seit einer Stunde wartete Oliver Horvath schon auf seine Verlobte. Eigentlich hatten sie sich auf der Baustelle treffen wollen, um noch ein paar kleinere Arbeiten zu erledigen. Ungeduldig schaute Oliver auf die Uhr.
»Warum kann in dieser Praxis nie pünktlich Schluß sein«, grummelte er, seufzte tief auf und machte sich dann wieder an die Arbeit. Er würde damit vermutlich längst fertig sein, bis Brigitte endlich kommen konnte.
Das Motorengeräusch eines sich nähernden Autos ließ Oliver erstaunt aufsehen. In diese abgelegene Gegend weit außerhalb von Steinhausen verirrten sich nur wenige Fahrzeuge – und wenn, dann waren es höchstens Radfahrer. Noch viel erstaunter war Oliver, als der Wagen neben ihm hielt und Dr. Daniel dann ausstieg.
»Guten Abend, Herr Horvath«, grüßte er freundlich, aber mit ernstem Ausdruck im Gesicht.
Oliver erschrak. »Ist etwas mit Brigitte?«
»Sie hatte keinen Unfall oder etwas ähnliches«, versuchte Dr. Daniel den jungen Mann gleich zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang.
»Es hängt mit diesen Ohnmachtsanfällen zusammen, nicht wahr?« fragte Oliver, und seine Stimme vibrierte dabei ein wenig. »Ich habe ihr immer wieder gesagt, daß sie sich Frau Dr. Carisi…, ich meine…, Frau Dr. Daniel…, Ihrer Frau anvertrauen solle, aber sie meinte, das wäre nicht nötig.« Unwillkürlich griff er nach Dr. Daniels Arm und klammerte seine Finger so fest darum, das es schmerzte. »Was ist mit Brigitte?«
»Ich glaube, das sollte sie Ihnen selbst sagen«, entgegnete Dr. Daniel. »Machen Sie sich vorerst mal keine zu großen Sorgen…, es handelt sich um keine Krankheit…, jedenfalls nicht so, wie Sie es jetzt vielleicht befürchten.«
Nun verstand Oliver überhaupt nichts mehr, doch er wurde nicht lange auf die Folter gespannt. Zusammen mit Dr. Daniel erreichte er schon eine knappe Viertelstunde später die Waldsee-Klinik und schließlich auch Brigittes Zimmer im ersten Stockwerk der Gynäkologie.
Sehr blaß und mit verweinten Augen sah sie ihm entgegen, während sich ihre Finger unwillkürlich um Manons Hand schlossen. Die Ärztin war auf ihre Bitte hin noch bei ihr geblieben.
»Brigitte, Liebling«, stieß Oliver hervor und war bereits im nächsten Moment an ihrem Bett. Zärtlich streichelte er über ihr kurzes dunkelblondes Haar.
»Oliver, ich…«, begann sie zögernd, warf Manon und Dr. Daniel einen hilfesuchenden Blick zu, bevor sie herausplatzte: »Ich bin schwanger!«
Schockiert fuhr Oliver zurück und starrte seine Verlobte völlig fassungslos an. »Du bist… was?«
Wieder brach Brigitte in Tränen aus. »Es tut mir leid…, ich…,ich weiß nicht, wie es passiert ist…« In diesem Moment fiel es ihr ein. Der Ärger mit der Baufirma, die zuerst den vereinbarten Termin nicht eingehalten und dann so unzuverlässig gearbeitet hatte. In der Hektik hatte Brigitte mehrfach die Einnahme der Pille vergessen… »Es muß damals gewesen sein, als uns die Firma versetzt hat…«
Oliver nickte mechanisch. Natürlich erinnerte auch er sich an die vielen Aufregungen. Sein Blick glitt von Brigitte ab, dann stand er abrupt auf und ging zur Tür, doch mitten im Raum blieb er stehen, als wäre er gegen eine Mauer gerannt. Langsam drehte er sich um.
»Es ist wirklich der ungünstigste Zeitpunkt für ein Baby«, murmelte er, dann kehrte er zu Brigitte zurück und nahm sie zärtlich in die Arme. »Aber wir beide werden es schon schaffen.« Er schwieg kurz. »Wenn ich im Moment auch keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll.«
Dr. Daniel und Manon, die sich bis jetzt nicht eingemischt hatten, atmeten erleichtert auf. Immerhin schienen sich Brigittes ärgste Befürchtungen nicht zu bewahrheiten. Allem Anschein nach würde Oliver auch in dieser Situation zu seiner Verlobten stehen. Allerdings wußte er auch noch nicht die ganze Wahrheit.
»Es ist leider nicht nur die Schwangerschaft«, erklärte Dr. Daniel und bemühte sich dabei um einen besonders sanften Ton.
Mit einem Ruck wandte sich Oliver ihm zu. »Ist mit dem Baby etwas nicht in Ordnung?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Mit dem Baby hat es glücklicherweise nichts zu tun, Herr Horvath. Die Ultraschalluntersuchung hat ergeben, daß es ganz normal entwickelt ist.« Er schwieg kurz, bevor er fortfuhr: »Ihre Verlobte leidet unter Gestationsdiabetes…, das ist eine spezielle Art der Zuckerkrankheit, die während der Schwangerschaft erstmals auftritt und sich danach meistens wieder normalisiert. Die Gefahren, die dadurch für das ungeborene Kind entstehen, sind nicht unerheblich, und aus diesem Grund habe ich mich auch entschlossen, Ihre Verlobte stationär in die Klinik einzuweisen. Wir müssen Sorge tragen, damit Ihr Kind auch gesund zur Welt kommt.«
Oliver bedeckte das Gesicht mit den Händen.
»Meine Güte«, stammelte er, dann ließ er die Hände langsam sinken und sah Dr. Daniel an. »In diesem speziellen Fall…, ich meine…, wäre es da nicht besser für alle Beteiligten, die Schwangerschaft zu beenden?« Er seufzte. »Verstehen Sie mich bitte nicht falsch…, das Baby kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber irgendwie wäre es schon zu schaffen – vorausgesetzt, es ist gesund. Ein behindertes Kind…« Er wischte sich mit einer fahrigen Handbewegung über die Stirn. »O Gott, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne daß es herzlos klingt.«
»Ich verstehe schon, was Sie meinen, Herr Horvath«, meinte Dr. Daniel. »Aber die Zuckerkrankheit Ihrer Verlobten rechtfertig zumindest im Augenblick noch keine Abtreibung, und vermutlich wird sich daran auch nichts ändern. Im übrigen besteht die eigentliche Gefahr nicht in einer Behinderung, sondern darin, daß das Kind im Mutterleib absterben könnte.« Beruhigend legte er eine Hand auf Olivers Schulter. »Ich werde mich sehr intensiv um Ihre Verlobte kümmern, das verspreche ich Ihnen, und die Chancen, daß Sie ein gesundes Kind bekommen werden, sind sehr groß, das kann ich Ihnen ebenfalls versichern. Glücklicherweise haben wir den Diabetes ja noch festgestellt, bevor er für das Kind gefährlich werden konnte.«
Oliver nickte ein wenig halbherzig.
»Wir stecken bis über den Hals in Schulden«, murmelte er. »Mit meinem Verdienst allein…, ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen…«
Dr. Daniel tauschte einen Blick mit seiner Frau, dann wandte er sich Oliver und Brigitte wieder zu.
»Auch da wird sich eine Lösung finden lassen«, meinte er und versuchte besonders zuversichtlich zu klingen, was ihm nicht so recht gelang. Für das junge Paar sah es im Moment jedenfalls sehr düster aus.
*
»Wie sollen wir den beiden nur helfen?« fragte Manon ratlos, als sie mit ihrem Mann den Flur entlangging. Sie hatten Brigitte und Oliver allein gelassen, weil sie gespürt hatten, daß das junge Paar jetzt für sich allein sein wollte.
Dr. Daniel zuckte die Schultern. »Im Augenblick habe ich da auch noch keinen konkreten Plan.« Er schwieg kurz. »Wenn die Diät etwas bewirkt, haben wir wenigstens ein Problem im Griff.« Er seufzte. »Ansonsten muß sie Insulin spritzen. Das wäre gerade im Hinblick auf ihre schlechte psychische Verfassung nicht sehr günstig.«
Manon nickte betrübt. »Sie tut mir so leid. Die finanzielle Belastung ist schon schlimm genug für sie, und dann auch noch Diabetes. Das arme Ding.«
»Wie ich vorhin schon sagte – es wird sicher eine Lösung geben«, meinte Dr. Daniel. »Entscheidend ist vorerst der gesundheitliche Aspekt.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, dann gab er Manon die Autoschlüssel. »Fahr’ du einstweilen schon mal nach Hause, Liebes. Ich muß noch rasch nach Eva-Maria sehen. Das Mädchen macht mir ebenfalls große Sorgen.«
Manon nickte, dann berührte sie sanft seine Wange. »Sehen wir uns heute noch?«
»Natürlich, Manon«, versicherte Dr. Daniel. »In spätestens zwei Stunden bin ich zu Hause.« Er küßte sie. »Gib Tessa noch einen Gutenachtkuß von mir.«
»Da wird sie aber ziemlich enttäuscht sein«, vermutete Manon. »Du hast heute früh versprochen, ihr vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte vorzulesen.«
»Ich weiß«, seufzte Dr. Daniel, und es tat ihm auch sichtlich leid, daß er sein Töchterchen enttäuschen mußte. »Vielleicht kannst du Stefan dazu überreden, dann ist sie wieder einigermaßen versöhnt. Und morgen nehme ich mir bestimmt Zeit für sie.«
Manon stellte sich auf Zehenspitzen und küßte sie zärtlich.
»Ich liebe dich, Robert«, flüsterte sie ihm zu, dann verließ sie die Klinik. Dr. Daniel sah ihr nach. Er wäre jetzt gern mit seiner Frau nach Hause gefahren, doch seine Sorge um Eva-Maria hielt ihn hier noch fest.
Eiligen Schrittes kehrte er zur Gynäkologie zurück und betrat dann nach kurzem Anklopfen das Zimmer des jungen Mädchens.
»Guten Abend, Eva-Maria«, grüßte er freundlich. »Wie fühlst du dich?«
Sie zuckte nur die Schultern. »Nicht besonders.«
Ohne große Umstände setzte sich Dr. Daniel auf die Bettkante. »Dann solltest du dir vielleicht mal alles von der Seele sprechen, und da du dich mit deinen Eltern nicht unterhalten willst…«
»Ich will mich mit niemandem unterhalten«, fiel Eva-Maria ihm ungehalten ins Wort.
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du dich sehr verändert. Was ist denn nur passiert?«
»Nichts«, antwortete Eva-Maria knapp und drehte dann demonstrativ den Kopf zur Seite.
»Mit diesem Verhalten kommst du bei mir nicht durch«, entgegnete Dr. Daniel ernst. »Hör mal, Eva-Maria, du warst mindestens im dritten Monat schwanger, und du machst mir nicht weis, daß du das nicht bemerkt hast. Trotzdem hast du dich nicht an deine Gynäkologin gewandt, um dir die Spirale entfernen zu lassen.«
Eva-Maria war bei diesen Worten bleich geworden. Irgendwie hatte sie nicht damit gerechnet, daß Dr. Daniel das alles so genau nachvollziehen könnte. Sie legte die Hände vors Gesicht und schluchzte hilflos auf.
»Ich dachte…, das Baby würde weggehen, wenn ich die Spirale drin lasse«, gestand sie unter Tränen. »Dann kamen die Schmerzen…, und das Blut…, und ich hatte Angst…« Aus verweinten Augen sah sie ihn an. »Er hätte mich doch nie geheiratet.«
So ähnlich hatte sich Dr. Daniel die ganze Sache schon vorgestellt.
»Wußtest du das bereits, bevor du dich mit ihm eingelassen hast?« wollte er wissen.
Eva-Maria schüttelte den Kopf. »Er war so lieb…, so zärtlich…, er hat mir den Himmel auf Erden versprochen…, bis er hatte, was er wollte.«
Besänftigend streichelte Dr. Daniel über das lange blonde Haar des Mädchens. »Und nun hast du Angst, daß deine Eltern dir Vorwürfe machen werden.«
Eva-Maria nickte, während noch immer Tränen über ihre Wangen rollten. »Sie müssen doch denken, ich würde mit jedem…, aber das ist nicht wahr. Tobi war mein erster fester Freund, und ich habe auch nicht gleich…, na ja, Sie wissen schon. Aber als er sagte, er würde mich immer lieben…, doch es war alles nur gelogen…« Wieder begannen die Tränen zu fließen.
Tröstend nahm Dr. Daniel das junge Mädchen in die Arme. »Nicht weinen, mein Kind. Ich kenne deine Eltern sehr gut, daher weiß ich ganz sicher, daß sie für dich Verständnis aufbringen werden.« Er schwieg einen Moment. »Wenn du möchtest, spreche ich zuerst mit ihnen.«
Mit tränennassen Augen blickte sie zu ihm auf.
»Das würden Sie wirklich tun, Herr Doktor?« fragte sie hoffnungsvoll, dann überzog verlegene Röte ihr zartes Gesicht. »Ich hätte Sie als Arzt behalten sollen, aber… Tobi hat gesagt, es wäre unschicklich, sich von einem Mann gerade da untersuchen zu lassen.«
Dr. Daniel seufzte. »Seltsamerweise vertreten gewisse junge Männer häufig diese Ansicht, haben ihrerseits aber keine Hemmungen, ein Mädchen in Schwierigkeiten zu bringen.« Aufmunternd tätschelte er Eva-Marias Gesicht. »Aber keine Sorge, es kommt jetzt wieder alles in Ordnung. Was die Fehlgeburt und die verirrte Spirale angeht, bist du ja noch mal mit dem Schrecken davongekommen.« Dabei verschwieg er, wie nahe Eva-Maria dem Tod gewesen war. »In ein paar Tagen können wir Katheder und Infusion entfernen, dann wird es dir bald wieder bessergehen. Und das mit deinen Eltern halte ich auch für kein allzu großes Problem. Noch heute werde ich mit ihnen sprechen.«
Dankbar drückte Eva-Maria seine Hand. »Wie soll ich das jemals gutmachen, Herr Doktor?«
»Indem du schnell gesund wirst und künftig gut auf dich aufpaßt.«
Eva-Maria nickte eifrig. »Das mache ich bestimmt, Herr Doktor, ich verspreche es.«
*
Die traurigen Augen ließen Sàndor nicht mehr los. Den ganzen Abend über saß er in seinem Zimmer und starrte vor sich hin. Dabei sah er vor seinem geistigen Auge immer wieder das blasse Mädchengesicht mit dem Blick, der ihn mitten ins Herz getroffen hatte.
Schließlich hielt er es nicht länger aus, verließ sein Zimmer und sagte zu seiner Mutter, er müsse noch mal kurz weg. Zehn Minuten später erreichte er die Waldsee-Klinik.
»Sàndor, was tun Sie denn noch hier?«
Der junge Mann erschrak, als hinter ihm so unerwartet die tiefe Stimme von Dr. Metzler erklang. Verlegene Röte überzog sein Gesicht, als er sich umdrehte.
»Es ist…, eine Patientin…, der Gedanke an sie läßt mir einfach keine Ruhe«, gestand Sàndor unsicher.
Dr. Metzler runzelte die Stirn. »Wenn die Sorge um eine Patientin Sie hierhertreibt, dann ist das durchaus in Ordnung. Eines sollten Sie allerdings wissen: Ich sehe es nicht gern, wenn jemand vom Personal etwas mit einem Patienten anfängt, denn meistens ist das nichts weiter als ein flüchtiges Abenteuer, und Sie können sich darauf verlassen, daß ich dem einen Riegel vorschieben würde.«
Sàndors verlegene Röte vertiefte sich bei diesen Worten noch.
»Das will ich ganz bestimmt nicht, Herr Chefarzt«, versicherte er. »Es ist wirklich nur…, sie war so traurig…, und…« Dr. Metzlers forschender Blick verunsicherte ihn immer mehr, so daß er schließlich schwieg.
»Gehen Sie zu der Patientin und vergewissern Sie sich, daß es ihr gut geht«, riet Dr. Metzler ihm. »Danach fahren Sie wieder nach Hause. Sie haben morgen einen anstrengenden Dienst vor sich.«
Sàndor nickte. »Ja, Herr Chefarzt.«
Er zögerte noch sekundenlang, dann ging er eiligen Schrittes in die Gynäkologie hinüber, lief die Treppe hinauf und stand schließlich schwer atmend vor dem Zimmer, in dem er Eva-Maria Neubert wußte. Er hatte den Chefarzt nicht belogen, aber er hatte ihm dennoch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es war mehr als nur Sorge, was ihn hierhergetrieben hatte – wenn er auch bestimmt kein flüchtiges Abenteuer im Sinn hatte. So etwas lag ihm nicht. Er nahm Gefühle sehr ernst.
Jetzt öffnete er leise die Tür und spähte ins Zimmer. Eva-Maria schlief. Der schwache Lichtschein, der vom Flur aus in ihr Zimmer fiel, ließ ihr Gesicht zart und zerbrechlich aussehen. Langsam ging Sàndor näher und betrachtete das junge Mädchen. Ihr Gesicht wirkte gelöst…, friedlich – ganz anders als heute nachmittag, wo er mit Bianca hier gewesen war. Ob Dr. Daniel ihr wohl hatte helfen können?
»Hoffentlich«, flüsterte Sàndor und berührte mit einer sanften Geste das weiche blonde Haar, das wie ein Fächer auf dem Kopfkissen lag.
Eva-Maria bewegte sich im Schlaf. Erschrocken fuhr Sàndor zurück, als hätte er etwas Verbotenes getan, dann verließ er leise das Zimmer. Er wollte von Eva-Maria nicht entdeckt werden, weil er nicht gewußt hätte, wie er ihr seinen nächtlichen Besuch hätte erklären sollen.
Als er auf dem Flur stand, blickte er sich unwillkürlich um und war froh, daß der Chefarzt nicht in der Nähe war. Er durchquerte die Eingangshalle und kehrte dann nach Hause zurück. Dabei wußte er, daß heute etwas mit ihm geschehen war – etwas Großes…, Gewaltiges. Doch er war nicht sicher, ob es auch gut für seine Zukunft sein würde.
*
Dr. Daniels stille Hoffnung erfüllte sich nicht. Bereits nach den ersten Tagen zeichnete sich ab, daß eine Diät allein nicht ausreichte, um Brigitte Kleins Diabetes in den Griff zu bekommen. Wenigstens im Falle von Eva-Maria Neubert war Besserung in Sicht. Sie hatte sich recht gut erholt, und Dr. Daniel hatte zwischen ihr und ihren Eltern erfolgreich vermitteln können. Die Neuberts waren von jeher eine Familie gewesen, die eng zusammengehalten hatte, und daran änderte auch die Schwangerschaft ihrer Tochter, die so dramatisch verlaufen war, nichts.
»Was ist mit Fräulein Klein?«
Die Frage seiner Frau riß Dr. Daniel aus seinen Gedanken. Mit einem tiefen Seufzer blickte er von seinen Unterlagen auf.
»Wir müssen auf Insulin zurückgreifen«, erklärte er. Bekümmert schüttelte er den Kopf. »Wie soll ich ihr das nur beibringen? Sie ist im Moment ohnehin so labil.« Wieder seufzte er. »Wenn ich ihr wenigstens eine Lösung für die finanziellen Probleme anbieten könnte, die sie und ihr Verlobter haben.« Er fuhr sich mit einer Hand durch das dichte blonde Haar. »Sie muß ja den Eindruck haben, als würde ihre Lage immer schlimmer werden.«
»So ähnlich ist es ja leider auch«, meinte Manon. Sie schwieg kurz. »Weißt du, wie hoch ihre Schulden sind?«
Dr. Daniel nickte. »Herr Horvath hat es mir gesagt. Der Betrag ist zu hoch, als daß ich ihnen helfen könnte. Daran hatte ich nämlich im ersten Moment gedacht.«
»Und ihre Eltern? Können sie von dieser Seite keine Unterstützung bekommen?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. Genau das hatte er Oliver Horvath auch gefragt, doch der junge Mann hatte keine Eltern mehr, und die Kleins hatten Mühe überhaupt mit der spärlichen Rente zu Rande zu kommen. An eine Unterstützung für ihre Tochter und den zukünftigen Schwiegersohn war nicht zu denken.
»Das sieht ja wirklich hoffnungslos aus«, urteilte Manon. »Wenn man nur…«
Ein zaghaftes Klopfen an der Tür unterbrach sie.
»Ja, bitte!« rief Dr. Daniel.
Im nächsten Moment trat seine Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau ein.
»Ich weiß schon, das Wartezimmer ist brechend voll, und Sie wollen wissen, wann ich endlich mit der Sprechstunde beginnen werde«, vermutete Dr. Daniel und brachte dabei sogar ein leichtes Schmunzeln zustande.
Doch Sarina schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Doktor, deshalb bin ich nicht hier.« Sie lächelte. »Wobei ich allerdings zugeben will, daß im Wartezimmer tatsächlich schon ein paar Patientinnen sitzen.« Dann wurde sie wieder sehr ernst. »Gabi und ich machen uns große Sorgen um Brigitte. Wie geht es ihr denn?«
»Nicht sehr gut«, gab Dr. Daniel zu. »Die Schwangerschaft gestaltet sich schwierig, und dazu kommen leider auch noch private Probleme.«
Sarina erschrak. »Hat Oliver etwa mit ihr Schluß gemacht?«
»Sie scheinen ja außerordentlich gut Bescheid zu wissen«, stellte Dr. Daniel fest.
»Nun ja, seit Eröffnung der Gemeinschaftspraxis haben Brigitte, Gabi und ich uns angefreundet«, gestand Sarina. »Es ist nicht so, daß wir ständig zusammenstecken würden, aber wir verstehen uns gut und haben eben auch oft über private Dinge miteinander gesprochen.«
Dr. Daniel nickte. »Dann wissen Sie vermutlich auch, daß Fräulein Klein und ihr Verlobter in finanziellen Schwierigkeiten stecken.«
»Ja und nein. Brigitte hat nur erzählt, daß sie und Oliver bauen wollen, und natürlich sind Gabi und ich nicht so naiv zu denken, so etwas ließe sich aus dem Handgelenk schütteln.« Und dann begriff sie plötzlich. »Wenn Brigitte erst entbunden hat, fällt für eine ganze Weile ihr Verdienst weg.«
Dr. Daniel nickte. »Es sieht für die beiden im Moment wirklich ziemlich bitter aus.« Er seufzte. »Trotzdem müssen wir uns jetzt erst mal um die Sprechstunde kümmern.«
»Das gilt auch für mich«, fügte Manon hinzu, dann sah sie Sarina an. »Können Sie bei mir drüben auch ein bißchen nach dem Rechten sehen?«
»Das ist doch gar keine Frage, Frau Doktor«, entgegnete Sarina, ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen. »Solange Brigitte ausfällt, übernehmen Gabi und ich selbstverständlich ihre Pflichten.«
»Danke, Fräulein Sarina. Das ist sehr lieb von Ihnen, und das werde ich bei Gelegenheit auch Ihrer Kollegin sagen.«
Manon verabschiedete sich mit einem zärtlichen Kuß von ihrem Mann, dann folgte sie der jungen Sprechstundenhilfe nach drau-ßen.
»Sehr lange müssen Sie diese Doppelbelastung aber nicht mehr ertragen«, versprach sie. »Ich werde mich demnächst um eine Nachfolgerin für Fräulein Klein kümmern.«
Sarina war sichtlich überrascht. »Kommt Brigitte denn vor der Entbindung nicht mehr in die Praxis?«
Manon zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, damit ist wohl kaum zu rechnen. Im Moment läßt das weder ihre körperliche noch ihre psychische Verfassung zu.«
Sarina war zutiefst betroffen.
»Stell dir vor, Gabi, Brigitte geht’s gar nicht gut«, erzählte sie ihrer Kollegin, kaum daß Manon in ihrem Teil der Praxis verschwunden war. »Sie kann vor der Entbindung wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten.«
»Das ist ja wirklich fürchterlich«, pflichtete Gabi ihr sofort bei.
»Ich werde sie heute noch besuchen«, beschloß Sarina spontan, dann blickte sie sinnend vor sich hin. »Frau Dr. Carisi…, ach nein, Frau Dr. Daniel wollte ich sagen…, also…, sie will sich demnächst um eine Nachfolgerin für Brigitte kümmern.«
Gabi nickte, hielt aber mitten in der Bewegung inne. »Das ist doch eigentlich nicht nötig – vor allem jetzt, wo Frau Dr. Daniel gar nicht mehr den ganzen Tag in der Praxis arbeitet.«
Sarina lächelte. »Genau das wollte ich von dir hören. Derselbe Gedanke ist mir nämlich auch schon gekommen, und…«
»Bekomme ich heute noch Arbeit oder nicht?«
Sarina und Gabi erschraken zutiefst, als hinter ihnen so unerwartet Dr. Daniels Stimme erklang.
»Na, Sie beide haben aber ein sehr schlechtes Gewissen«, urteilte er schmunzelnd, dann wurde er ernst. »Aber ich kann mir schon denken, daß die Sorge um Fräulein Klein Sie so abgelenkt hat.«
»Ja, das auch«, gab Sarina zu. »Allerdings haben Gabi und ich gerade über etwas anderes gesprochen. Wissen Sie, Ihre Frau sagte eben, sie würde sich um eine Nachfolgerin für Brigitte umsehen, aber… eigentlich ist das doch gar nicht nötig.«
Dr. Daniel runzelte die Stirn. »Ich finde es zwar sehr lobenswert, daß Sie die Arbeit Ihrer Kollegin so selbstlos übernehmen wollen, aber Sie beide kennen den Betrieb hier doch am allerbesten. Sowohl bei mir als auch bei meiner Frau geht es ja meistens zu wie auf dem Wochenmarkt. Sie würden also die meiste Zeit ganz erheblich im Streß stehen ohne eine weitere Kraft.«
Sarina und Gabi tauschten einen Blick.
»Wir schaffen das schon«, urteilte Gabi dann recht entschlossen.
»Also schön«, meinte Dr. Daniel. »Dann werden wir uns bei Gelegenheit mal zusammensetzen und die Einzelheiten besprechen. Aber jetzt sollten wir unsere Patienten wirklich nicht länger warten lassen.«
*
Eva-Maria verstand sich selbst kaum. Da war sie noch vor wenigen Tagen völlig niedergeschlagen gewesen, weil sie das Gefühl gehabt hatte, Tobi niemals vergessen zu können, und nun…
Die sich öffnende Tür unterbrach ihre Gedanken. Mit einem schüchternen Lächeln sah sie den jungen Mann an, der hereintrat. Sàndor hieß er, und allein sein Name klang für sie schon wie Musik.
»Guten Morgen, Fräulein Neubert«, grüßte er, und seinem freundlichen Lächeln war nicht zu entnehmen, ob sie für ihn eine Patientin wie jede andere war oder vielleicht ein bißchen mehr.
»Guten Morgen«, flüsterte Eva-Maria. Sie scheute sich davor, ihn einfach Sàndor zu nennen, hatte aber auch nicht den Mut, nach seinem Nachnamen zu fragen.
Mit geübten Griffen legte Sàndor die Manschette um Eva-Marias Oberarm, pumpte auf und drückte dann das Stethoskop in ihre Armbeuge. Dabei berührten seine Fingerspitzen ihre Haut, und obwohl die Berührung an sich nichts Intimes ausdrücken sollte, klopfte Eva-Marias Herz so laut, daß sie das Gefühl hatte, Sàndor müßte es hören.
Mein Blutdruck muß jetzt mindestens bei zweihundert liegen, dachte Eva-Maria.
»130 zu 70«, erklärte Sàndor, und das junge Mädchen hätte am liebsten die Augen geschlossen, um seine tiefe, weiche Stimme in sich nachklingen zu lassen.
Er griff nach ihrem Handgelenk, um den Puls zu zählen, und nun konnte Eva-Maria ihr Vibrieren nicht mehr unterdrücken. Erstaunt sah Sàndor sie an.
»Sie zittern ja«, stellte er fest, dann lächelte er. »Sie werden doch wohl keine Angst vor mir haben, Fräulein Neubert.«
»Nein«, hauchte Eva-Maria und wurde über und über rot. »Es ist nur…, diese ganze Atmo-sphäre hier im Krankenhaus…, das alles macht mich ein bißchen nervös, und…, ich fühle mich auch nicht besonders gut…«
Aufmerksam sah Sàndor sie an. »Soll ich Frau Dr. Reintaler Bescheid sagen? Oder lieber Dr. Daniel?«
Hastig schüttelte Eva-Maria den Kopf. »Das ist sicher nicht nötig. Ich…, ich brauche bestimmt nur etwas Ruhe.«
»Ich bin gleich fertig«, erwiderte Sàndor.
»Nein, so war das nicht gemeint«, entgegnete Eva-Maria rasch. Sie wollte seine Gesellschaft doch so lange wie möglich auskosten.
»Sàndor!« Schwester Bianca schaute zur Tür herein. »Beeil dich. Wir müssen Frau Gerber aus dem Aufwachraum holen, sonst wird Dr. Parker giftig.«
Sàndor lächelte, was Eva-Maria erneut völlig dahinschmelzen ließ.
»Das kann ich mir bei ihm gar nicht vorstellen«, meinte er, während er schon seine Sachen zusammenräumte und sich mit einem freundlichen »bis heute mittag« von Eva-Maria verabschiedete.
»Täusch’ dich nicht«, erwiderte Bianca. »Dr. Parker hat gerade zum zweiten Mal hier oben angerufen und gefragt, wo wir bleiben. Der Aufwachraum ist nicht so groß, daß…«
Mehr hörte Eva-Maria nicht mehr, weil sich die Tür nun hinter Bianca und Sàndor schloß. Sehnsüchtig blickte sie ihm nach. »Bis heute mittag«, hatte er gesagt und dabei gelächelt.
Eva-Maria seufzte. »So wird er alle Patienten anlächeln.«
Sie warf einen Blick auf die Uhr. Noch fast vier Stunden würden vergehen, bis sie ihn wiedersah. Er würde ihr das Mittagessen bringen, Puls, Blutdruck und Temperatur kontrollieren und dann wieder gehen.
Eva-Maria runzelte die Stirn. Wenn irgend etwas vorfallen würde, was ihn länger in ihrem Zimmer hielt…
Ich könnte einen Schwindelanfall vortäuschen, dachte sie. Dann müßte er sich doch um mich kümmern. Oder noch besser – eine Ohnmacht.
Sie lächelte vor sich hin. Heute mittag würde sie ihn jedenfalls länger in ihrem Zimmer gefangenhalten.
Doch Dr. Daniel machte ihr, ohne etwas von ihren zärtlichen Gefühlen für Sàndor zu ahnen, einen Strich durch die Rechnung. Der junge Mann hatte gerade das Tablett auf dem fahrbaren Nachttischchen abgestellt, als Dr. Daniel mit einem fröhlichen Gruß ins Zimmer trat.
»Nun, Eva-Maria, wie fühlst du dich?« fragte er, während sich Sàndor diskret zurückziehen wollte. Doch Dr. Daniel wandte sich ihm noch einmal zu. »Warte draußen auf mich. Ich möchte mich ein bißchen mit dir unterhalten.«
»Ja, Herr Dr. Daniel, gern«, stimmte er zu und lächelte – ein Beweis für Eva-Maria, daß Sàndor tatsächlich zu jedem so freundlich war wie zu ihr.
»Entschuldige, Eva-Maria«, erklärte Dr. Daniel nun. »Es gehört sich eigentlich nicht, eine Frage zu stellen und sich dann mit jemand anderem zu unterhalten, aber ich wollte verhindern, daß mir Sàndor wieder durch die Lappen geht. Schon seit Tagen versuche ich vergeblich, ihn zu treffen.«
»Kennen Sie ihn denn?« wollte Eva-Maria wissen.
Dr. Daniel nickte. »Ja, fast so gut wie dich. Er ist hier in Steinhausen aufgewachsen.«
»Komisch«, murmelte Eva-Maria. »Ich habe ihn nie zuvor gesehen.«
»Das ist nicht weiter verwunderlich. So ein kleines Dorf ist Steinhausen ja heute auch nicht mehr. Außerdem ist Sàndor in den vergangenen Jahren in München zur Schule gegangen und hat in seiner Freizeit viel gelernt.« Er schwieg kurz. »Aber wir wollten eigentlich nicht über Sàndor sprechen, sondern über dich. Also, mein Kind, wie fühlst du dich?«
»Ganz gut«, meinte Eva-Maria. »Ich habe keine Schmerzen mehr, und Frau Dr. Reintaler hat bei der Visite gesagt, mein Zustand wäre mehr als zufriedenstellend.«
Dr. Daniel nickte und warf einen Blick in die Krankenakte, die er sich mitgebracht hatte, dann lächelte er Eva-Maria an.
»Ich glaube, wir können uns bald über deine Entlassung unterhalten.« Er überlegte eine Weile. »Übers Wochenende möchte ich dich noch hierbehalten, aber ich denke, am Montag kannst du dann wieder nach Hause.«
»Das ist schön«, behauptete Eva-Maria und versuchte ihr Entsetzen über diese Nachricht zu verbergen. Nach Hause! Das bedeutete für sie – weg von Sàndor. Nein, sie wollte nicht nach Hause! Nicht jetzt schon!
Irgend etwas muß mir einfallen, damit ich diese Entlassung verhindern kann, dachte sie verzweifelt. Irgend etwas…
*
Sarina von Gehrau erschrak zutiefst, als sie Brigitte Klein sah. Blaß und schmal lag sie in ihrem Bett, starrte blicklos vor sich hin und erweckte den Eindruck, als wäre sie schwer krank, jedenfalls aber keine werdende Mutter.
»Brigitte«, sprach Sarina sie leise an.
Die junge Frau hob den Kopf und zwang sich zu einem Lächeln, das ihr kläglich mißlang. Spontan setzte sich Sarina auf die Bettkante und griff nach Brigittes Hand.
»Dr. Daniel hat gesagt, daß es dir nicht gut geht«, erklärte sie.
Brigitte seufzte. »Das ist noch untertrieben, Sarina. Ich fühle mich miserabel. Ich habe Schwangerschafts-Diabetes – so schlimm, daß ich Insulin spritzen muß.« Mit einer fahrigen Handbewegung wischte sie sich über die Augen. »Oliver ist so lieb zu mir…, er will mir helfen, dabei sehe ich ihm an, wie schwer er selbst unter der ganzen Last trägt. Ich bin schwanger, zuckerkrank, und er steht mit den vielen Schulden allein da. Sarina, ich wünschte, Dr. Daniel hätte einer Abtreibung zugestimmt.«
Doch Sarina schüttelte ernst den Kopf. »Das hättest du niemals wirklich gewollt. Erinnerst du dich noch, wie wir uns einmal über dieses Thema unterhalten haben?«
Wieder seufzte Brigitte. »Natürlich erinnere ich mich. Ich habe gesagt, wenn Mutter und Kind gesund sind, dann gibt es immer einen Weg, und dieser Ansicht bin ich auch jetzt noch, aber…, ich bin nicht gesund, und ich weiß nicht, ob mein Kind es sein wird.«
»Das kann Dr. Daniel feststellen, und wenn für dich oder das Kind auch nur die geringste Gefahr bestehen sollte, dann würde er einer Abtreibung zustimmen, das weißt du so gut wie ich.«
Ein wenig verlegen senkte Brigitte den Kopf. »Er ist so gut…, so fürsorglich zu mir, und ich danke es ihm so schlecht.«
»Dafür hat er Verständnis«, versicherte Sarina. »Er weiß genau, in welch schlimmer Situation du steckst, und ich glaube, er macht sich große Sorgen um dich.«
»Aber wirklich helfen kann er mir leider auch nicht«, entgegnete Brigitte niedergeschlagen, und Sarina wußte, daß sie dabei nicht so sehr an den medizinischen Aspekt dachte.
»Ist die finanzielle Belastung denn wirklich so schlimm?« wollte sie wissen.
Brigitte nickte. »Wir haben einfach zu knapp kalkuliert. Es hätte sicher geklappt, wenn das mit der Schwangerschaft nicht passiert wäre. Oliver und ich hätten ungefähr fünf Jahre lang gemeinsam verdienen müssen, dann wäre das Ärgste überstanden gewesen, aber jetzt…, im ungünstigsten Fall müssen wir verkaufen, und das womöglich auch noch mit Verlust. Wer will schon einen Rohbau – auch wenn das Haus noch so idyllisch liegt.«
Sarina dachte eine Weile angestrengt nach.
»Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit«, murmelte sie, dann griff sie nach Brigittes Hand und drückte sie sanft. »Mach dir im Augenblick noch keine Sorgen darüber.« Sie lächelte. »Ich weiß schon, das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber du solltest versuchen, erst mal an dich und dein Baby zu denken. Für das andere wird sich schon eine Lösung finden lassen.«
»Das sagt Dr. Daniel auch, aber…, es sieht doch alles so hoffnungslos aus, Sarina.« Wieder strich sie über ihre Augen. »Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.«
*
Als Sàndor das Zimmer von Eva-Maria betrat, fiel ihm sofort der beißende Geruch auf.
»Fräulein Neubert, fühlen Sie sich nicht gut?« fragte er besorgt.
»Mir war gerade furchtbar übel«, erklärte Eva-Maria mit gequältem Blick. »Mein ganzes Mittagessen habe ich erbrochen.«
»Es ist heute schon das zweite Mal, daß Sie sich übergeben müssen«, meinte er. »Das Frühstück konnten Sie ja auch nicht behalten. Haben die Tropfen, die Schwester Bianca Ihnen gegeben hat, denn nichts genützt?«
Eva-Maria schüttelte den Kopf, dann brach sie in Tränen aus. »Morgen sollte ich entlassen werden. Daraus wird nun bestimmt nichts.«
»Ich werde Dr. Parker informieren«, beschloß Sàndor kurzerhand. »Er hat Wochenenddienst.«
Es dauerte nur wenige Minuten, bis Sàndor mit dem jungen Anästhesisten zurückkehrte.
»Ich habe gerade erfahren, daß Sie sich heute schon zweimal übergeben mußten«, erklärte Dr. Parker. »Haben Sie außer der Übelkeit noch andere Beschwerden?«
Eva-Maria zögerte kurz, dann nickte sie. »Ich habe schreckliche Magenschmerzen…, es ist, als würde mir jemand mit einem Messer die Magenwände aufschneiden.«
»Das klingt aber gar nicht gut«, urteilte Dr. Parker besorgt, dann tastete er Eva-Marias Bauchdecke ab. Obwohl sie mehrere Male wie im Schmerz zusammenzuckte, hatte er nicht den Eindruck, daß sie tatsächlich Beschwerden hatte.
»Sàndor, rufen Sie bitte Dr. Scheibler an«, erklärte Dr. Parker. »Er hat heute Bereitschaft und ist in einem solchen Fall wohl qualifizierter als ich.«
Der junge Mann kam der Aufforderung des Arztes umgehend nach, während Dr. Parker schon in die Eingangshalle hinunterging. Es dauerte nicht lange, bis der Oberarzt die Klinik betrat.
»Was ist los, Jeff?« wollte er wissen. »Sàndor hat sich am Telefon ja so angehört, als würde die Welt gleich untergehen.«
»Das nun nicht gerade«, entgegnete Dr. Parker. »Es geht um Fräulein Neubert, die Fehlge-burtspatientin, die Robert beinahe auf dem OP-Tisch weggestorben wäre. Sie hat sich heute zweimal übergeben und klagt über schneidende Magenschmerzen«. Er schwieg kurz. »Die Bauchdecke ist weich und auch nicht druckempfindlich, soweit ich das beurteilen kann.«
»Sie glauben, daß sie simuliert?«
Dr. Parker zuckte die Schultern. »Ich kann es ihr nicht unterstellen, ausschließen kann ich es aber auch nicht. Und Tatsache ist nun einmal, daß sie sich übergeben hat. Der Geruch, der im Zimmer hing, war deutlich.«
»Ich sehe sie mir an«, beschloß Dr. Scheibler, doch er kam bei seiner Untersuchung zu dem gleichen Ergebnis wie Dr. Parker. Kurzerhand nahm er eine Blutuntersuchung vor, machte Ultraschall- und Röntgenaufnahmen, doch er konnte keinen krankhaften Befund erheben. Nach einigem Überlegen zog er schließlich Dr. Daniel zu Rate.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie am Sonntagnachmittag störe«, entschuldigte er sich am Telefon. »Aber Fräulein Neubert…«
Weiter kam Dr. Scheibler gar nicht, denn Dr. Daniel sagte zu, sofort zu kommen. Aufmerksam hörte er sich den Bericht der beiden Ärzte an, dann schüttelte er den Kopf.
»Eva-Maria ist keine Simulantin«, meinte er. »Wenn sie über Schmerzen klagt, dann hat sie auch ganz sicher welche.«
»Ihr angebliches Schmerzempfinden war bei der Untersuchung durch mich anders als bei Jeff – abgesehen davon, daß wir beide das Gefühl hatten, als wäre der Bauch überhaupt nicht druckempfindlich.« Er zögerte ganz kurz. »Aber wie auch immer – wir werden wohl nicht darum herumkommen, einmal in den Magen hineinzuschauen, da alle anderen Untersuchungsmethoden nicht das Geringste ergeben haben.«
Dr. Daniel nickte nachdenklich, dann beschloß er: »Ich gehe jetzt mal zu ihr hinauf und spreche mit ihr. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, daß sie simuliert, aber wenn doch, dann wird die Aussicht auf eine Magenspiegelung sie rasch wieder zur Vernunft bringen.«
Zusammengekrümmt lag Eva-Maria im Bett und schluchzte leise vor sich hin.
»Herr Doktor«, brachte sie mühsam hervor. »Ich hatte mich schon so auf meine Entlassung gefreut, und nun…, ständig ist mir übel. Und dazu diese Schmerzen…«
»Leg dich mal auf den Rücken, Eva-Maria«, bat Dr. Daniel, dann tastete auch er den Bauch des jungen Mädchens ab, und obwohl es ihm widerstrebte, an Eva-Marias Worten zu zweifeln, mußte er Dr. Scheibler und Dr. Parker recht geben. Die Untersuchung vermittelte nicht den Eindruck, als hätte das junge Mädchen wirklich solche Beschwerden, wie sie es behauptete.
»Tja, mein Kind, ich fürchte, so kommen wir nicht weiter«, erklärte er. »Wir werden gleich für morgen früh eine Magenspiegelung ansetzen.«
Eva-Maria erbleichte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie hatte gedacht, man würde sie einfach zur Beobachtung hierbehalten.
»Das…, das ist aber doch
eine ganz schreckliche Untersuchung«, warf sie ängstlich ein.
»Nun ja, besonders angenehm ist sie nicht«, meinte Dr. Daniel und betrachtete sie dabei sehr aufmerksam. »Sind die Schmerzen denn wirklich so schlimm?«
Eva-Maria wollte schon verneinen, da besann sie sich. Wenn sie jetzt ihrem ganz natürlichen Impuls nachgeben würde, war alles, was sie bis jetzt unternommen hatte, umsonst gewesen. Niemand würde ihr mehr glauben, und sie würde morgen entlassen werden. Sie würde Sàndor nicht mehr sehen…, jedenfalls nicht täglich, und vor allem – wie sollte sie ihm noch in die Augen schauen, wenn sie jetzt der offensichtlichen Lüge überführt würde?
»Ja, Herr Doktor, es tut wirklich furchtbar weh«, behauptete sie leise und schämte sich, daß sie Dr. Daniel belog, doch ihr Wunsch, weiterhin von Sàndor betreut zu werden, war einfach stärker.
Dr. Daniel nickte. »Dann werden wir das morgen früh gleich in Angriff nehmen.« Er griff nach Eva-Marias Hand und drückte sie sanft. »Ich werde versuchen hier zu sein, um dir wenigstens ein bißchen seelischen Beistand zu leisten.«
Wieder bekam Eva-Maria Angst, doch nun war es zu spät, um noch die Wahrheit zu sagen. Sie mußte bei der Version mit den Schmerzen bleiben – gleichgültig, was passierte!
*
Dr. Daniel hatte am nächsten Morgen die Waldsee-Klinik gerade betreten, als die Gynäkologin Dr. Alena Reintaler die Eingangshalle durchquerte. Als sie ihn sah, blieb sie abrupt stehen.
»Robert, gut, daß Sie hier sind«, erklärte sie hastig. »Ich bin gerade auf dem Weg zu Fräulein Klein.«
Dr. Daniel hielt sich nicht mit weiteren Fragen auf, sondern folgte der Gynäkologin ins erste Stockwerk zu dem Zimmer von Brigitte Klein.
»Herr Doktor, helfen Sie mir«, flehte Brigitte mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Es tut so weh…, ich glaube, ich verliere das Baby…«
Rasch trat Dr. Daniel an ihr Bett und schlug die Decke zurück. Alena reichte ihm ein Paar Plastikhandschuhe, die er sich schnell überstreifte.
»Versuchen Sie sich trotz der Schmerzen zu entspannen, Fräulein Klein«, bat er. »Ich muß Sie untersuchen, um festzustellen, was genau los ist.«
Mit zusammengepreßten Lippen nickte Brigitte, doch die heftigen Gebärmutterkontraktionen ließen keine wirkliche Entspannung zu. Trotzdem gelang es Dr. Daniel, sie gründlich zu untersuchen.
»Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu sehr weh getan«, meinte er. »Aber bei Ihren heftigen Verspannungen ging es leider nicht anders.«
»Sie waren sehr vorsichtig«, entgegnete Brigitte, dann sah sie ihn angstvoll an. »Werde ich eine Fehlgeburt haben?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, Fräulein Klein. Sie haben vorzeitige Wehen, aber der Muttermund ist noch geschlossen. Sie werden das Baby nicht verlieren, wenn wir gegen die Wehen etwas unternehmen.«
Brigitte berührte ihren Bauch, dem man die Schwangerschaft noch kaum ansah, dann blickte sie zu Dr. Daniel auf.
»Tun Sie etwas dagegen, Herr Doktor«, bat sie leise. »Ich möchte das Baby nicht verlieren…, jetzt nicht mehr.«
Dr. Daniel lächelte. »Das freut mich.« Er drehte sich zu Alena um und sprach kurz mit ihr. Die junge Ärztin nickte, verließ dann den Raum und kam wenig später mit einem Infusionsständer zurück, an dem bereits eine Flasche hing.
»Sie bekommen jetzt eine Infusion«, erklärte Dr. Daniel an Brigitte gewandt, deren Gesicht schon wieder vom Schmerz der vorzeitigen Wehen gezeichnet war. »Das Medikament wird rasch wirken.«
»Hoffentlich«, flüsterte Brigitte, dann sah sie Dr. Daniel an. »Kommt es denn oft vor, daß Schwangere vorzeitige Wehen haben?«
»Ja, es passiert immer wieder, allerdings nur selten mit einer solchen Heftigkeit, wie es bei Ihnen der Fall ist.«
Brigitte seufzte. »Ich habe das Gefühl, als wäre bei mir alles schwierig.«
Diesen Eindruck hatte Dr. Daniel auch, doch das sprach er natürlich nicht aus, um Brigitte nicht noch mehr zu entmutigen. Die ganze Situation mußte für sie schon schlimm genug sein.
Dr. Daniel griff nach dem Infusionsbesteck und beugte sich über Brigittes linken Arm.
»Das Einführen der Kanüle wird ein bißchen weh tun«, warnte er die junge Frau, und sie zuckte auch tatsächlich ein bißchen zusammen, als der Arzt in die Vene einstach.
»Schon vorbei«, beruhigte Dr. Daniel sie, während er die Nadel zurückzog und die Kanüle weiter in die Vene vorschob. Dann fixierte er sie mit Klebeband, schloß die Infusion an und regelte die Tropfgeschwindigkeit. »Die Wehen werden jetzt bald weniger schmerzhaft sein und schließlich ganz aufhören.«
»Danke, Herr Doktor.« Brigitte sah ihn sehr ernst an. »Seien Sie ehrlich…, werde ich das Baby bis zum Geburtstermin tragen können?«
Dr. Daniel zögerte, dann schüttelte er den Kopf. »Wahrscheinlich nicht. So, wie ich es bis jetzt sehe, müssen wir mit einer Frühgeburt rechnen, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit Kaiserschnitt erfolgen muß.«
Brigitte nickte, als hätte sie genau diese Antwort erwartet.
»Wissen Sie, Herr Doktor, Oliver und ich haben uns immer Kinder gewünscht…, noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren.« Sie schwieg kurz. »Nach den Erfahrungen dieser Schwangerschaft…, ich meine…, wird es bei mir auch später immer so schwierig sein?«
»So etwas läßt sich schwer vorhersagen«, entgegnete Dr. Daniel. »Aber es ist durchaus möglich, daß bei Ihnen jede Schwangerschaft in dieser Art verlaufen wird.«
»Sie würden mir also von einem weiteren Kind abraten«, folgerte Brigitte.
Doch Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, das nun auch wieder nicht. Ihr Gesundheitszustand und auch der des Babys müssen nur unbedingt gründlich überwacht werden.« Er schwieg kurz. »Damit bin ich auch gleich bei dem Thema, das ich in den nächsten Tagen ohnehin noch angesprochen hätte. Wie ich vorhin sagte, müssen wir mit einer Frühgeburt rechnen. Gerade bei Diabetes besteht die Gefahr einer Plazentainsuffizienz, die gegen Ende der Schwangerschaft auftreten kann. Das bedeutet, daß Ihr Baby dann nicht mehr optimal versorgt werden würde. Wir müssen den Kaiserschnitt also möglichst durchführen, bevor eine solche Situation eintritt, aber Ihr Kind wird zu diesem Zeitpunkt noch sehr klein sein und wahrscheinlich eine Frühgeborenen-Intensivstation benötigen. Über die verfügt die Waldsee-Klinik allerdings nicht.«
Brigitte nickte. »Ich muß also in ein großes Krankenhaus nach München.« Plötzlich stiegen Tränen in ihre Augen. »Warum ist das denn alles nur so kompliziert? Ich hätte so gern hier…, bei Ihnen entbunden.«
Tröstend griff Dr. Daniel nach ihrer Hand. »Wenn Sie es möchten, dann kann ich den Kaiserschnitt selbst durchführen. Mein Freund hat sicher nichts dagegen. Dr. Georg Sommer – der Name ist Ihnen vielleicht schon bekannt.«
»Der Mikrochirurg?«
»Genau der«, nickte Dr. Daniel. »Allerdings ist seine Klinik nicht nur auf diesem Gebiet führend. Dr. Sommer verfügt auch über eine ganz ausgezeichnete Entbindungsstation und
eine Frühgeborenen-Intensivstation mit einem Spezialisten, dessen Namen man in München und Umgebung kennt. Dort wüßte ich Sie und das Baby in den besten Händen, und wie gesagt – den Kaiserschnitt kann ich selbst durchführen, wenn Sie es möchten.«
»Ja, Herr Doktor, es würde mich wirklich beruhigen, wenn Sie mein Baby holen könnten. In welcher Klinik ich dann liege, ist mir egal. Hauptsache, für mein Kind wird alles getan.«
»Das ist in der Sommer-Klinik bestimmt der Fall«, versprach Dr. Daniel, dann tätschelte er beruhigend die Hand der jungen Frau. »Sie werden sehen, es kommt noch alles in Ordnung.«
*
»Ich glaube, wir können nicht mehr länger warten«, meinte Dr. Scheibler. »Anscheinend wurde Dr. Daniel aufgehalten.«
Offene Angst stand in Eva-Marias Augen. Sie fürchtete sich so schrecklich vor der anstehenden Magenspiegelung, und am liebsten hätte sie jetzt noch einen Rückzieher gemacht und zugegeben, daß das mit den Magenschmerzen überhaupt nicht stimme…, daß sie es lediglich behauptet hatte, um noch nicht entlassen zu werden. Nur die Tatsache, daß Sàndor sie dann für eine Lügnerin gehalten und wohl nie wieder angeschaut hätte, hielt sie davon ab.
Aufmerksam sah Dr. Scheibler sie an. Er erkannte, welche Angst in der jungen Patientin steckte, und mittlerweile glaubte auch er nicht mehr daran, daß sie tatsächlich simulierte. Wer würde sich schon freiwillig einer so unangenehmen Untersuchung unterziehen?
»Soll ich eine Schwester holen?« wollte er wissen. »Bianca hat Sie oben in der Gynäkologie versorgt. Sie könnte Ihre Hand halten und…«
Eva-Maria schluckte schwer. »Schwester Bianca ist sehr nett, aber in letzter Zeit…, ich meine…, meistens hat sich der junge Pfleger um mich gekümmert…, Sàndor…«
Es erstaunte Dr. Scheibler ein wenig, daß Eva-Maria gerade jetzt nach einem Mann verlangte, der nicht nur jung, sondern auch noch ausgesprochen gutaussehend war. Im ersten Moment hatte der Oberarzt gedacht, Eva-Maria wäre vielleicht in Sàndor verliebt, doch er verwarf diesen Gedanken rasch wieder. Wäre sie das tatsächlich, dann würde sie sich ihm nicht gerade in einer solchen Situation zeigen, die mehr Schwächen als Stärken widerspiegeln könnte. Auch junge Mädchen wollten dem Mann ihres Herzens doch schließlich imponieren.
»Wenn Sie zu Sàndor genügend Vertrauen haben, werde ich ihn gern holen«, meinte Dr. Scheibler.
Eva-Maria nickte nur, weil ein dicker Kloß in ihrem Hals zu stecken schien, der ihr kein Wort erlaubte. Es gefiel ihr nicht besonders, sich gerade vor Sàndor eine solche Blöße zu geben, andererseits wußte sie, daß ihr die ruhige Sicherheit, die der junge Mann zu vermitteln verstand, gerade jetzt sehr guttun würde.
Sàndor war auch wirklich sofort zur Stelle, und in seinen Augen entdeckte Eva-Maria etwas, das reine Sympathie bei weitem überstieg. Ihr Herz machte ei-
nen Luftsprung. Sollte Sàndor tatsächlich ähnlich fühlen wie sie?
»So, Eva-Maria«, meinte Dr. Scheibler und benutzte dabei absichtlich ihren Vornamen, um ihr ein gewisses Gefühl der Geborgenheit zu geben. »Sàndor wird Ihre Hand halten, und von Dr. Parker bekommen Sie eine Spritze. Damit wird die Untersuchung für Sie nicht ganz so unangenehm.«
Eva-Maria fühlte den feinen Stich und umklammerte Sàndors Hand impulsiv ein wenig fester. Das Gesicht des jungen Mannes begann sich vor ihren Augen zu drehen. Sie hatte das eigenartige Gefühl, hier im Untersuchungsraum zu liegen und gleichzeitig unendlich weit weg zu sein. Sie fühlte einen glatten, runden Gegenstand in ihrem Mund und mußte würgen, dann glitt sie in eine tiefe Benommenheit.
»Merkt sie davon denn gar nichts?« fragte Sàndor, der mit wachsendem Unbehagen zusah, wie Dr. Scheibler den gleitfähig gemachten Gummischlauch in Eva-Marias Mund schob. Das Mädchen würgte, und ihre Hände zuckten, als wolle sie den Schlauch herausziehen, doch ihre Bewegungen waren zu unkoordiniert.
»Sie spürt, daß sie etwas in den Mund geschoben bekommt, aber das Beruhigungsmittel, das Dr. Parker ihr gespritzt hat, ist so stark, daß sie es nicht als unangenehm empfindet«, antwortete Dr. Scheibler, während er den Schlauch weiter in die Speiseröhre schob und dabei auf dem Monitor den Weg des Gastroskops verfolgte.
»Sàndor, erschrecken Sie nicht, wenn die Kleine noch mal würgen muß«, erklärte Dr. Scheibler. »Ich erreiche jetzt gleich den Mageneingang, da ist das ein ganz natürlicher Reflex.«
Unwillkürlich begann Sàndor Eva-Marias Hand zu streicheln, obwohl er wußte, daß sie das ebensowenig spüren würde wie die Magenspiegelung.
»Das gibt’s doch nicht«, murmelte Dr. Scheibler, während er das Bild verfolgte, das ihm aus Eva-Marias Magen gesendet wurde.
Sàndor erschrak. »Ist es etwas Ernstes?«
Doch der Oberarzt schüttelte den Kopf. »Eben nicht. Ich kann überhaupt nichts finden. Kein Geschwür, keine Entzündung – nichts.«
In diesem Moment kam Dr. Daniel atemlos herein. »Es tut mir leid, Gerrit, aber ich mußte dringend zu einer Patientin mit vorzeitigen Wehen.«
»Nicht so tragisch«, meinte Dr. Scheibler, dann lächelte er. »Mit Sàndors Hilfe hat Eva-Maria die Beruhigungsspritze ganz gut überstanden, und abgesehen von dem unangenehmen Würgegefühl merkt sie nichts von der Untersuchung.«
»Und?« wollte Dr. Daniel wissen. »Was ist jetzt mit ihrem Magen?«
»Nichts«, antwortete Dr. Scheibler achselzuckend. »Es ist der schönste Magen, den ich seit langem gesehen habe.«
Dr. Daniel runzelte unwillig die Stirn. »Hat sie etwa doch simuliert?«
»Sieht so aus, wenn ich mir auch nicht vorstellen kann, aus welchem Grund sie das tun sollte.« Er schwieg kurz. »Tatsache ist außerdem, daß sie sich zweimal übergeben mußte.«
Dr. Daniel dachte über diese Worte nach. »War jemand dabei?«
Erstaunt sah der junge Oberarzt ihn an. »Wie meinen Sie das, Robert?«
»Nun ja, eventuell könnte sie das Erbrechen auch irgendwie herbeigeführt haben. Immerhin haben sämtliche Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, ergeben, daß sie völlig gesund ist.«
Zügig, aber dennoch mit der gebotenen Vorsicht zog Dr. Scheibler den Schlauch heraus, dann wandte er sich Sàndor zu. »Bringen Sie die Patientin wieder auf ihr Zimmer. Ich werde dann gleich nach ihr sehen.«
»Nicht nötig«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich bleibe bei ihr, bis sie wieder zu sich kommt.«
Das dauerte nur wenige Minuten.
»Ist es… vorbei?« flüsterte Eva-Maria.
Dr. Daniel nickte. »Ja, mein Kind, du hast es überstanden, allerdings sind wir dem Grund für deine Schmerzen damit leider keinen Schritt nähergekommen.« Er bemerkte die leichte Röte, die über Eva-Marias Gesicht huschte. »Nach den Untersuchungsergebnissen kannst du eigentlich weder von Magenschmerzen noch von Übelkeit geplagt sein. Du bist vollkommen gesund, Eva-Maria.«
»Aber ich mußte mich übergeben«, beharrte das junge Mäd-chen. »Ich hatte kaum gegessen, da kam alles wieder hoch.«
Dr. Daniel wurde erneut unsicher. Eva-Maria brachte das alles mit solcher Sicherheit hervor, daß er versucht war, ihr zu glauben. Andererseits sprachen die Untersuchungsergebnisse ja für sich.
»Wir haben dich von Kopf bis Fuß durchgecheckt«, meinte Dr. Daniel, dann kam ihm plötzlich eine Idee. »Heute abend kannst du wieder etwas zu essen bekommen. Ich werde dir dabei Gesellschaft leisten.«
Eva-Maria erschrak. Wenn Dr. Daniel bei ihr bleiben würde, würde er schnell merken, daß ihr keineswegs übel wurde.
Irgend etwas muß mir einfallen, dachte sie verzweifelt. Wenn ich in den nächsten Tagen wieder alles vertragen kann, dann wird man das meiner fortschreitenden Genesung zuschreiben, aber wenn Dr. Daniel erkennt, daß meine ganze Krankheit nur erfunden war, dann…, dann wird sich Sàndor von mir abwenden. Ein Mann wie er will bestimmt keine Lügnerin zur Freundin haben.
*
»Herr Doktor, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich?«
Dr. Daniel drehte sich um und sah sich Sàndor gegenüber.
»Natürlich habe ich Zeit für dich«, erklärte er lächelnd. »Worum geht’s denn?« Er wurde ernst. »Du fühlst dich hier in
der Klinik doch hoffentlich wohl, oder?«
Sàndor nickte. »Die Arbeit macht mir sogar großen Spaß, und die Ärzte und Schwestern sind furchtbar nett. Darum geht es auch gar nicht.« Er zögerte einen Moment, dann gestand er: »Wissen Sie, ich…, ich glaube, ich habe mich verliebt.«
Dr. Daniel bemerkte, daß Sàndors Blick an ihm vorbei zu einer bestimmten Zimmertür ging.
»In Eva-Maria«, vermutete er.
Sàndor errötete ein wenig, dann nickte er. »Sie hat mich vom ersten Augenblick an bezaubert. Ich kann sie einfach nicht vergessen.« Verlegen senkte er den Kopf. »Der Chefarzt hat mir schon am ersten Tag klipp und klar gesagt, daß er es nicht gern sieht, wenn Personal und Patienten…, na ja, Sie wissen schon.« Er seufzte. »Deshalb habe ich es auch noch nicht gewagt, Eva-Maria meine Gefühle zu gestehen, aber jetzt…, ich halte es einfach nicht länger aus. Deshalb dachte ich, wenn ich mit Ihnen sprechen würde…, ich bin nicht auf ein Abenteuer aus. Das mit Eva-Maria sitzt viel tiefer.«
»Du kennst sie doch noch gar nicht«, wandte Dr. Daniel ein.
»Das ist richtig«, gab Sàndor zu. »Trotzdem spielt mein Herz vollkommen verrückt, wenn ich nur in ihrer Nähe bin. Heute, bei der Magenspiegelung…, am liebsten hätte ich die ganze Prozedur über mich ergehen lassen, nur um sie ihr zu ersparen. Sie hat mir so leid getan, und wenn ihr irgend etwas Ernsthaftes fehlen würde…« Er beendete den Satz nicht, doch Dr. Daniel verstand auch so, was er sagen wollte.
»Im Augenblick sieht es aus, als würde ihr überhaupt nichts fehlen«, meinte er. »Ich habe sogar den starken Verdacht, daß Eva-Maria lügt – aus welchem Grund auch immer.«
Heftig schüttelte Sàndor den Kopf. »Das glaube ich nicht. Sie ist so zart und unschuldig…, sie könnte doch überhaupt nicht lügen.«
Dr. Daniel spürte, wie enttäuscht Sàndor sein würde, wenn sich herausstellen würde, daß er mit seinem tiefen Glauben an Eva-Maria falsch lag.
»Vielleicht hast du recht«, räumte er ein, obwohl er nicht daran glaubte. Andererseits – welchen Grund sollte Eva-Maria haben, so hartnäckig zu lügen?
In diesem Moment fiel es Dr. Daniel wie Schuppen von den Augen. Sàndor! Nur er konnte der Grund für alles sein! Ihre Übelkeit und die angeblichen Magenschmerzen hatten angefangen, als von Entlassung aus der Klinik die Rede gewesen war. Aber allem Anschein nach wollte Eva-Maria gar nicht entlassen werden, und das lag sicher nicht daran, daß sie sich in der Waldsee-Klinik inzwischen so heimisch fühlte.
»Sàndor, du entschuldigst mich bitte einen Moment«, erklärte Dr. Daniel. »Ich muß mich mit Dr. Scheibler unterhalten.«
Der junge Mann nickte, warf noch einen Blick zu der Tür, hinter der er Eva-Maria wußte, und sah dann Dr. Daniel wieder an. »Was soll ich jetzt tun?«
»Im Augenblick überhaupt nichts«, riet Dr. Daniel ihm. »Behalte deine Gefühle vorerst noch für dich, Sàndor. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Eva-Maria fehlt, und wenn sich mein Verdacht bewahrheitet…« Er lächelte geheimnisvoll. »Ich denke, morgen kann ich dir mehr darüber sagen.«
*
Dr. Scheibler saß grübelnd über der Akte von Eva-Maria Neubert, als Dr. Daniel ins Ärztezimmer trat.
»Ich komme einfach auf keinen grünen Zweig«, seufzte er. »Nach den Untersuchungsergebnissen ist sie gesund – trotzdem kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, daß wir irgend etwas übersehen haben.«
»Wir haben auch etwas übersehen«, meinte Dr. Daniel lächelnd. »Etwas sehr Wichtiges sogar – die Liebe.«
Verständnislos starrte Dr. Scheibler ihn an. »Wie bitte?« fragte er entgeistert.
»Aus Liebe will sie hier Patientin bleiben«, erklärte Dr. Daniel. »Und zwar aus Liebe zu Sàndor.«
Nachdenklich fuhr sich Dr. Scheibler durch das dichte dunk-le Haar. »Daran habe ich auch schon mal gedacht…, zwar nicht unbedingt in diesem Zusammenhang, aber als die Magenspiegelung anstand, verlangte sie nach Sàndor als seelische Stütze. Ich verwarf den Gedanken an eine Verliebtheit aber, weil ich dachte, daß sie sich in einem solchen Fall doch nicht gerade von ihrer schwächsten Seite zeigen würde.«
»Das hätte sie wohl auch nicht getan, wenn ich dagewesen wäre«, vermutete Dr. Daniel. »Es ist ihr sicher nicht leichtgefallen, sich Sàndor ausgerechnet in dieser Situation zu zeigen.«
»Und Sie sind sicher, daß Sie sich nicht irren?« wollte Dr. Scheibler wissen.
»Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, und noch heute abend werde ich sie damit konfrontieren. Ich bin gespannt, was sie darauf sagen wird.«
Eva-Maria war schlicht sprachlos, als Dr. Daniel ihr die Wahrheit geradewegs ins Gesicht sagte.
»Nein«, stammelte sie nach den ersten Schrecksekunden. »Nein, das ist nicht wahr. Ich bin krank. Ich bin wirklich krank. Und ich kann auch nichts essen. Mir wird schon übel, wenn ich das Essen nur sehe.«
Das war nun nicht einmal gelogen. Bei Dr. Daniels Worten war tatsächlich Übelkeit in ihr aufgestiegen, allerdings rührte diese nicht vom Magen, sondern eher vom Herzen her. Wenn Dr. Daniel die Wahrheit wußte und Sàndor davon erfahren würde…
»Eva-Maria, das alles hat doch keinen Sinn«, erklärte Dr. Daniel ruhig. »Sag die Wahrheit, solange du es noch kannst. Je länger du auf deiner angeblichen Krankheit beharrst, um so schwieriger wird es für dich, da wieder herauszukommen. Jetzt wird deine Liebe zu Sàndor noch als Entschuldigung gelten, aber wenn du weiterlügst, läufst du Gefahr, diese Liebe tatsächlich zu verspielen.«
Eva-Maria schluchzte auf. »Das habe ich doch schon! Wenn Sàndor erfährt, daß alles nur gelogen war… Er hatte solches Mitleid mit mir.« Sie vergrub das Gesicht in den Händen. »Er saß bei mir und hat mich getröstet, weil ich vor der Magenspiegelung Angst hatte. Wenn er erfährt, daß das alles gar nicht nötig gewesen wäre… daß ich vollkommen gesund bin…, Er muß sich doch ausgenutzt und für dumm verkauft vorkommen.«
»Nicht, wenn du ihm erklärst, warum du das getan hast«, erwiderte Dr. Daniel, dann griff er nach Eva-Marias Hand. »Sàndor hat das alles nicht nur aus Mitleid getan. Ich bin sicher, daß er Verständnis haben wird.« Er schmunzelte. »Vielleicht sogar mehr als das. Immerhin muß es für ihn doch recht schmeichelhaft sein, wenn er erfährt, was du alles auf dich genommen hast, nur um in seiner Nähe zu sein.«
Doch so wollte Eva-Maria es nicht sehen. Für sie stand eindeutig fest, daß sie Sàndors Liebe verloren hatte, bevor sie ihr jemals richtig gehört hatte.
Dr. Daniel bemerkte ihre Verzweiflung.
»Soll ich zuerst mit Sàndor sprechen?« fragte er, doch Eva-Maria schüttelte heftig den Kopf.
»Nein! Nein, er darf es niemals erfahren!« rief sie mit sich überschlagender Stimme.
»Eva-Maria, du steigerst dich da in eine Aufregung hinein, die gar nicht nötig ist«, meinte Dr. Daniel, doch nicht einmal seine ruhige Stimme vermochte noch etwas zu bewirken. Eva-Maria schien wie besessen von dem Gedanken zu sein, daß Sàndor sie für ihre Lüge hassen müßte.
Kurzerhand stand Dr. Daniel auf und beauftragte Schwester Bianca, ein Beruhigungsmittel zu bringen.
»Versuch dich zu entspannen, Eva-Maria«, meinte er. »Du wirst nur einen kleinen Pieks spüren. Das Medikament wird dich ein paar Stunden ruhig schlafen lassen, und dann sieht die Welt schon wieder ein bißchen anders aus. Morgen früh, wenn Sàndor zum Dienst kommt, kannst du dich mit ihm unterhalten.«
»Nein! Nein!« weinte Eva-Maria und wimmerte auf, als sie den feinen Stich spürte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sie ruhiger wurde und schließlich ein-schlief.
Dr. Daniel betrachtete sie noch einen Moment und fragte sich dabei, wie sie sich nur in eine solche Panik hatte hineinsteigern können.
»Junge Mädchen«, seufzte er. »Was in ihren Köpfen nur alles vorgehen mag?«
Dann verließ er leise das Zimmer und fuhr nach Hause. Gleich morgen früh würde er noch einmal nach Eva-Maria sehen. Bis dahin würde sie sicher schlafen.
Darin täuschte sich Dr. Daniel allerdings gehörig. Eva-Maria wurde von einem wirren Traum geplagt, der sie gegen drei Uhr morgens plötzlich aufwachen ließ. Schweißgebadet lag sie in ihrem Bett, fühlte sich benommen und verwirrt und hörte dabei immer noch die Worte, die Sàndor in ihrem Traum gesprochen hatte… harte, lieblose Worte.
»Eine Lügnerin verdient meine Liebe nicht!«
Eva-Maria schluchzte auf, dann versuchte sie, aus ihrem Bett zu steigen, was ihr aber nur recht und schlecht gelang, weil das Beruhigungsmittel, das Dr. Daniel ihr gespritzt hatte, noch immer wirkte. Das Nachthemd klebte an ihrem verschwitzten Körper, doch Eva-Maria registrierte es überhaupt nicht. Noch ein wenig torkelnd verließ sie ihr Zimmer und tastete sich an der Wand entlang zur Treppe.
Barfuß tapste sie hinunter, durchquerte die Eingangshalle und verließ die Klinik durch den rückwärtigen Ausgang, der zum Klinikpark führte. Normalerweise hätte sie die Klinik nicht so ohne weiteres verlassen können, doch der diensthabende Arzt und die Nachtschwester waren durch einen Unfall aufgehalten worden.
Feiner Nieselregen empfing Eva-Maria, als sie noch immer benommen von dem Beruhigungsmittel, durch den Park ging. Der kalte Wind jagte ihr Schauer über den Körper, trotzdem ging sie immer weiter – ziellos, einfach nur hinein in die rabenschwarze Nacht.
*
Als Sàndor um sieben Uhr am Morgen seinen Dienst antrat, führte ihn sein erster Weg zu Eva-Maria. Auf dem Flur begegnete ihm Schwester Bianca, und ihrem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, daß etwas passiert sein mußte.
»Eva-Maria ist verschwunden«, platzte sie sofort heraus. »Als ich die Betten machen wollte, bemerkte ich, daß sie weg ist. Wir haben schon die ganze Klinik auf den Kopf gestellt…«
Sàndor erschrak zutiefst. »Aber…, das ist doch nicht möglich…«
»Ich habe keine Ahnung, wie sie aus der Klinik kommen konnte«, fiel Bianca ihm ins Wort. »Ich muß sofort Dr. Daniel benachrichtigen.«
»Ich mache mich inzwischen auf die Suche nach ihr«, beschloß Sàndor spontan.
»Warte!« rief Bianca ihm noch nach, doch er hörte sie gar nicht mehr. Wie von Furien gehetzt, rannte er die Treppe hinunter, zögerte einen Moment und schlug dann den Weg zum Klinikpark ein.
Der Regen war in den vergangenen Stunden stärker geworden, und Sàndor hatte in der Eile seine Jacke vergessen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sein Hemd völlig durchnäßt war, doch das bemerkte er gar nicht. Die Sorge um Eva-Maria trieb ihn an.
Der Klinikpark war unübersichtlich, und so mußte Sàndor länger suchen, als er gedacht hatte. Der Wind fuhr eisig durch sein nasses Hemd, und für einen Moment kam ihm der Gedanke, daß er zurückgehen und sich passender kleiden sollte, doch er wollte nicht unnötig Zeit verlieren. Vor ihm tauchte der Wald auf, und Sàndor fühlte Übelkeit aufsteigen, als er an den tiefen, eisig kalten Waldsee dachte, der dort vorn idyllisch zwischen den hoch aufragenden Tannen lag. Wenn der See Eva-Marias Ziel gewesen war, dann würde jede Hilfe für sie zu spät kommen. Der kristallklare See würde unweigerlich ihren Tod bedeuten.
Nahezu zwei Stunden brauchte Sàndor, um Eva-Maria zu finden. Zitternd und frierend lehnte sie an einem Baum unweit des idyllischen Waldsees.
»Eva-Maria, um Himmels willen, was hast du dir denn nur dabei gedacht?« fragte Sàndor mit leisem Vorwurf, aber auch un-überhörbarer Besorgnis in der Stimme.
Eva-Maria sah zu ihm auf, dann brach sie in Tränen aus. Beschämt vergrub sie das Gesicht in den Händen.
»Geh!« brachte sie unter Schluchzen hervor. »Ich…, ich…«
Sàndor wartete nicht, bis sie Worte fand, sondern nahm sie kurzerhand auf die Arme, um sie zur Klinik zurückzutragen. Eva-Maria wollte sich zuerst wehren, doch Nässe und Kälte hatten ihre Gelenke steif werden lassen. Schließlich gab sie auf und lehnte ihren Kopf an Sàndors Schulter. Dabei wurde ihr zarter Körper noch immer von heftigem Schluchzen geschüttelt.
Der Weg war weit und beschwerlich, denn der unaufhörliche Regen verwandelte den Waldboden in tiefen Morast. Nun war Eva-Maria für Sàndor zwar keine allzu schwere Last, aber dennoch war er heilfroh, als der hufeisenförmige weiße Bau endlich in Sichtweite kam.
Dr. Daniel, der inzwischen natürlich ebenfalls informiert worden war, und Schwester Bianca nahmen sie am hinteren Eingang in Empfang. Die Krankenschwester kümmerte sich sofort um Eva-Maria und brachte sie wieder auf ihr Zimmer.
»Du hättest auf mich warten sollen, Sàndor«, meinte Dr. Daniel mit leisem Tadel in der Stimme, dann schüttelte er den Kopf. »Einfach abzuhauen – und das auch noch in so ungenügender Kleidung.«
»Ich hatte doch nur Angst um Eva-Maria«, verteidigte sich Sàndor.
Dr. Daniel nickte. »Das ist auch die einzige Entschuldigung, die ich dafür gelten lasse. Trotzdem hättest du warten sollen. Mit deinem überstürzten Handeln hast du uns zum Abwarten gezwungen. Wir wußten ja nicht, wohin du dich gewandt hast, konnten also praktisch nichts unternehmen. Gerrit, Wolfgang, Jeff und ich haben zwar den Park durchsucht, aber recht viel weiter wagten wir uns nicht von der Klinik weg.«
»Bitte, Herr Doktor, schimpfen Sie nicht mehr mit mir«, bat Sàndor zerknirscht.
Dr. Daniel seufzte. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht – um euch beide.« Er legte dem jungen Mann eine Hand auf die Schulter, dann erschrak er. »Meine Güte, Sàndor, du bist ja naß bis auf die Haut. Komm, ich fahre dich nach Hause, damit du dich umziehen kannst.«
Der junge Mann nickte. »Danke, Herr Doktor, aber ich kann mich ja hier auch umziehen und dann meinen Dienst…«
»Das wirst du schön bleiben lassen«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Willst du denn unbedingt krank werden? Ich fahre dich jetzt nach Hause, dann wirst du ein heißes Bad nehmen und dich ins Bett legen.«
Doch davon wollte Sàndor nichts hören. Er ließ sich von Dr. Daniel zwar nach Hause fahren, zog sich dort aber nur um und kehrte dann in die Klinik zurück.
»Du bist schon ein unverbesserlicher Dickkopf«, schimpfte Dr. Daniel, als er mittags sah, daß der junge Mann seinen Dienst versah, als wäre überhaupt nichts passiert.
»Ich weiß«, entgegnete Sàndor. »Keine Sorge, Herr Doktor, das halte ich schon aus. Zu Hause würde mir die Sorge um Eva-Maria doch keine Ruhe lassen.« Er wurde sehr ernst. »Hoffentlich hat ihr nächtlicher Ausflug kein Nachspiel.«
»Ich fürchte schon. Sie war naß bis auf die Haut und entsprechend unterkühlt.« Er sah Sàndor an. »Du allerdings auch, und ich fürchte, in spätestens zwei Tagen wirst du eine empfindliche Erkältung ausgebrütet haben.«
Sàndor schüttelte den Kopf. »Ich bin zäh, Herr Doktor.«
*
Brigitte Klein hatte von dem Tumult, der an diesem Morgen in der Klinik stattgefunden hatte, nicht das geringste mitbekommen, daher wunderte sie sich auch, als Dr. Daniel zu ganz ungewöhnlicher Stunde zu ihr kam.
»Wie geht es Ihnen?« wollte er wissen.
»Soweit ganz gut«, antwortete sie. »Die Wehen haben aufgehört, aber sonst…, ich habe ein bißchen Angst, Herr Doktor.«
»Dazu besteht im Moment kein Grund«, entgegnete Dr. Daniel. »Wir haben den Diabetes im Griff, und Ihr Baby entwickelt sich auch ausgezeichnet. In ein paar Wochen wäre es bereits außerhalb des Mutterleibs lebensfähig – das heißt, daß dann wenigstens die Sorge um eine Fehlgeburt von uns genommen wäre, wenn wir natürlich auch weiter versuchen werden, Ihr Baby so lange wie möglich dort zu halten, wo es um diese Zeit noch hingehört.« Er schwieg kurz. »Allerdings sollten wir die Verlegung in die Sommer-Klinik nun nicht mehr allzu lange hinauszögern. Ich würde Ihnen vorschlagen, daß wir das noch in dieser Woche durchziehen.«
Brigitte nickte. »Wie Sie meinen, Herr Doktor. Ich vertraue da ganz auf Ihr Urteil. Was Sie sagen, ist sicher richtig.«
Dr. Daniel lächelte. »Gut, dann werde ich alles Nötige in die Wege leiten.« Er wurde wieder ernst. »Wie sieht es denn jetzt in finanzieller Hinsicht aus, wenn ich so indiskret sein darf, das zu fragen.«
»Natürlich dürfen Sie«, bekräftigte Brigitte sofort, doch dann wurde ihr Gesichtsausdruck traurig. »Ich fürchte, wir werden verkaufen müssen. Baby und Haus sind wohl nicht unter einen Hut zu bringen. Oliver und ich haben uns ohne großes Überlegen für das Kind entschieden. Vielleicht klappt es ja später einmal mit einem eigenen Haus.«
Doch Dr. Daniel merkte ihr an, wie schwer ihr und Oliver dieser Entschluß gefallen sein mußte. Wenn man schon einmal den Rohbau des eigenen Hauses vor sich sah und dann doch darauf verzichten mußte, war das sicher nicht ganz leicht zu verschmerzen.
»Das mit dem Haus ist unter Dach und Fach.«
Dr. Daniel und Brigitte blickten überrascht zur Tür, wo eine lächelnde Sarina von Gehrau stand. Jetzt sah sie Dr. Daniel an.
»Ich werde meinen Dienst in der Praxis sofort wieder antreten, aber ich mußte Brigitte jetzt einfach die gute Nachricht überbringen.« Mit wenigen Schritten war sie beim Bett und griff nach den Händen der jungen Frau. »Ich habe nach meinem ersten Besuch bei dir meine Eltern aufgesucht und ihnen geschildert, in welcher Misere Oliver und du stecken. Für meinen Vater gab es da natürlich kein Halten mehr, und erstaunlicherweise hatte auch meine Mutter nichts dagegen einzuwenden, einem bürgerlichen Paar zu helfen.« Sie grinste schelmisch. »Erstaunlich, wenn man bedenkt, welchen Standesdünkel die Gräfin Henriette von Gehrau…, meine hochverehrte Frau Mama normalerweise hat. Kurz und gut, mein Vater hat das gesamte Darlehen samt Zinsen getilgt, und er läßt dir und Oliver so viel Zeit, wie ihr braucht, um dieses Darlehen nun an ihn zurückzuzahlen.«
Aus weit aufgerissenen Augen starrte Brigitte sie an.
»Von Gehrau…, die gräfliche Familie…, das bist du?« stammelte sie, dann sah sie Dr. Daniel an. »Haben Sie das gewußt?«
Dr. Daniel schmunzelte. »Ja, Fräulein Klein, ich weiß, daß meine tüchtige Sprechstundenhilfe es eigentlich gar nicht nötig hätte zu arbeiten, weil sie eine waschechte Komteß von Gehrau ist, aber sie ist viel zu bescheiden, um mit diesem Titel anzugeben.«
Sarina errötete auch jetzt, weil sie ihren gräflichen Stand eigentlich gar nicht liebte, doch in diesem Fall war sie sogar froh, aus einer mehr als wohlhabenden Familie zu stammen. Nur so war es ihr möglich gewesen, Brigitte zu helfen.
»Ob nun Komteß oder nicht – wichtig ist doch nur, daß Brigitte und Oliver jetzt weiterbauen können«, meinte sie.
Da richtete sich Brigitte auf und umarmte die junge Komteß spontan.
»Meine Güte, Sarina, ahnst du überhaupt, was das für uns bedeutet?« flüsterte sie gerührt. »Du und deine Eltern…, ihr schenkt uns eine gesicherte Zukunft. Wie sollen wir das jemals wiedergutmachen.«
»Werdet glücklich«, meinte Sarina schlicht.
*
Eva-Maria erwachte mit einem fürchterlichen Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen und einem eigenartigen Stechen in der Lunge – vor allem, wenn sie hustete. Dr. Scheibler diagnostizierte eine beginnende Lungenentzündung, leitete eine Antibiotika-Therapie ein und informierte dann Dr. Daniel.
»War es das wirklich wert?« wollte der von Eva-Maria wissen. »Einfacher und vor allem schmerzloser wäre es gewesen, wenn du mit Sàndor gesprochen hättest. Er liebt dich – hast du das denn noch immer nicht gemerkt?«
Beschämt senkte Eva-Maria den Kopf. »Ich weiß selbst nicht, was mit mir los war. Ich hatte einen schrecklichen Traum, und…« Sie zuckte die Schultern, dann sah sie Dr. Daniel an. »Sàndor war heute schon bei mir, aber… er hat kein Wort über das alles verloren.« Mit traurigen Augen sah sie Dr. Daniel an. »Ich glaube nicht, daß er mich liebt. Ich habe gelogen, bin bei Nacht und Nebel aus der Klinik geflüchtet…, wie sollte er für eine Person wie mich da jemals etwas empfinden?«
»Das fragst du ihn am besten selbst«, riet Dr. Daniel ihr, doch Eva-Maria schüttelte verzagt den Kopf.
»Dazu habe ich nicht genügend Mut«, entgegnete sie. »Wenn er meinen Verdacht bestätigen würde…, wenn er sagen würde, daß er mich nicht liebt…, diese Worte aus seinem Mund zu hören – das könnte ich nicht ertragen.«
*
Nicht nur Eva-Maria litt unter den Folgen ihres nächtlichen Ausflugs, auch Sàndor spürte bereits am nächsten Tag den beginnenden Schnupfen. Auch Halsschmerzen und ein harter, trockener Husten ließen nicht lange auf sich warten.
»Bleiben Sie die nächsten zwei oder drei Tage zu Hause im Bett«, riet Dr. Metzler ihm, doch Sàndor winkte ab.
»Ich bin nicht der Typ, der sich wegen ein bißchen Husten und Schupfen gleich ins Bett legt. Hier wartet doch haufenweise Arbeit auf mich.«
In Wahrheit war es seine Sehnsucht nach Eva-Maria, die ihn Tag für Tag wieder in die Klinik zog, und jedesmal nahm er sich vor, ihr seine Liebe zu gestehen, doch er konnte die Warnung des Chefarztes nicht vergessen, und so begnügte er sich damit, so oft wie möglich zu ihr zu gehen, um zu sehen, ob er etwas für sie tun könnte. Dabei spürte er, daß Eva-Maria für ihn das gleiche fühlte, aber wohl aus irgendeinem Grund ebenfalls Hemmungen hatte, sich ihm zu offenbaren. Vielleicht, weil er sie in ihrer Schwäche gesehen hatte…, vielleicht auch, weil sie noch so jung war…, weil sie beide noch so jung waren.
»Fräulein Neubert hat eine Lungenentzündung«, wandte Dr. Metzler ein und holte Sàndor damit in die Wirklichkeit zurück. »Ich will nicht, daß Sie diese vorerst noch recht harmlose Erkältung verschleppen und dann auch in der Klinik landen – aber als Patient.«
Doch Sàndor nahm die Warnung nicht ernst, und auch als Dr. Daniel ihm ähnliches sagte wie der Chefarzt, entgegnete er nur: »Ich bin schon nicht so leicht unterzukriegen.«
Seufzend schüttelte Dr. Daniel den Kopf. »Warum könnt ihr jungen Leute denn einfach nicht auf einen guten Rat hören? Aber schön, mein Junge, tu, was du nicht lassen kannst. Dein Körper wird dir die Rechnung für deinen Leichtsinn schon präsentieren. Aber wehe, du beklagst dich dann.«
An diese Worte wurde Sàndor bereits wenige Tage später erinnert. Während dieser Zeit hatten die Halsschmerzen immer mehr zugenommen. Mittlerweile war es so schlimm, daß Sàndor kaum noch einen Bissen zu sich nehmen konnte, und seine Hausapotheke half da auch nicht mehr. Dazu kamen der schmerzhafte Husten und ein entsetzliches Stechen in der Lunge. Sàndor mußte kein Arzt sein, um zu wissen, was das bedeutete, und ihm war natürlich auch klar, daß er in diesem speziellen Fall unbedingt Antibiotika gebraucht hätte, doch er wagte es nicht, sich an den Chefarzt oder an Dr. Daniel zu wenden, weil er die Vorwürfe der Ärzte fürchtete.
So behielt Sàndor seine körperlichen Beschwerden für sich und hoffte, daß die Krankheit von selbst ausheilen würde. Allerdings wurde der Dienst für ihn von Tag zu Tag beschwerlicher.
»Sàndor, jetzt ist Schluß«, erklärte Dr. Daniel, als ihm der junge Mann über den Weg lief. »Ich schaue mir das nicht mehr länger an. Du bist so krank, daß du dich fast nicht mehr auf den Beinen halten kannst.«
»Es ist nur ein bißchen Schnupfen und Halsweh…«
»Bißchen Schnupfen und Halsweh ist gut«, unterbrach Dr. Daniel ihn. »Komm, setz dich mal da hin.«
Sàndor gehorchte nur widerwillig, doch er wußte, daß sich Dr. Daniel nicht davon abbringen lassen würde, ihn zu untersuchen.
»So, und jetzt mach deinen Mund auf«, befahl der Arzt, dann betrachtete er den geröteten Rachen und schüttelte fassungslos den Kopf. »Das reicht, mein Junge.« Er sah Sàndor ernst an.
»Ein bißchen Halsweh«, wiederholte er, dann fragte er ganz unvermittelt: »Was hast du heute gegessen?«
Sàndor war so perplex, daß er die Wahrheit sagte: »Nichts.«
»Das dachte ich mir. Es würde ja auch höllisch weh tun.« Er ging zur Tür und bat die vorbeieilende Schwester, den Chefarzt herzuschicken. »Anschließend könnten Sie ein Zimmer für unseren Herrn Zivildienstleistenden herrichten. Er muß mit Sicherheit stationär aufgenommen werden.«
Es dauerte nicht lange, bis Dr. Metzler den Raum betrat, und Dr. Daniel informierte ihn in knappen Worten.
»Damit hatte ich schon lange gerechnet«, urteilte Dr. Metzler, betrachtete ebenfalls Sàndors geröteten Rachen und holte schließlich aus dem Arznei-schrank ein kleines Fläschchen.
»Muß das sein?« fragte Sàndor und wich unwillkürlich zurück.
»Bleiben Sie nur hier«, befahl Dr. Metzler. Sàndor mußte die unangenehme Prozedur über sich ergehen lassen.
»Na, sehen Sie, Sie sind ja noch am Leben. So, und jetzt marsch ins Bett. Schwester Alexandra wird Ihnen etwas zu essen bringen. Eine Suppe dürfte selbst mit diesem Rachen eingermaßen schmerzfrei hinunterzubringen sein.«
Sàndor sah ein, daß er jetzt gehorchen mußte. Im Grunde war er froh, daß seine Krankheit nun endlich behandelt wurde. Er fühlte, daß er hohes Fieber hatte, und auch die Schmerzen in seiner Lunge wurden immer unerträglicher.
Er warf Dr. Daniel einen unsicheren Blick zu, dann sah er Dr. Metzler an.
»Herr Chefarzt, ich glaube…, ich glaube, ich habe eine Lungen-entzündung«, gestand er leise.
Völlig fassungslos starrte Dr. Metzler ihn an, und auch Dr. Daniel schien wirklich entsetzt zu sein.
»Und damit gehst du Tag für Tag zur Arbeit?« fragte er entgeistert. »Ja, bist du denn verrückt geworden? An so einer Krankheit kann man sterben, Sàndor!«
Auch Dr. Metzler hatte sich von seinem ersten Schock erholt und befahl streng: »Los, ziehen Sie Ihr Hemd aus.«
Sàndor gehorchte, dann hörte Dr. Metzler sehr gewissenhaft Herz und Lunge ab. Kopfschüttelnd sah er den jungen Mann danach an.
»So etwas von Leichtsinn ist mir in meiner ganzen bisherigen Laufbahn noch nicht untergekommen.« Er kontrollierte Sàndors Temperatur und schüttelte dann wieder den Kopf. »Fast vierzig Fieber. Meine Güte, wenn ich Ihr Vater wäre, dann könnten Sie sich auf etwas gefaßt machen.«
Dr. Metzler verließ den Raum, während Dr. Daniel Sàndor beim Arm nahm und ihn in das Zimmer begleitete, das Schwester Alexandra schon für ihn hergerichtet hatte.
»Leg dich ins Bett, Sàndor«, erklärte Dr. Daniel, dann ließ er sich von der Schwester ein Infusionsbesteck bringen.
»Was geschieht jetzt mit mir?« fragte Sàndor leise.
»Du mußt vorerst Infusionen bekommen«, meinte Dr. Daniel, während er sich schon über Sàndors linken Arm beugte, um den Zugang zu legen. »Das Einführen der Kanüle wird ein bißchen weh tun.«
»Au«, entfuhr es Sàndor da auch schon.
Dr. Daniel warf ihm einen kurzen, ungewöhnlich strengen Blick zu. »Beklag’ dich bitte nicht. Daß du in diese Situation geraten bist, ist ganz allein deine eigene Schuld.«
Sàndor schluckte schwer. So barsch hatte sich Dr. Daniel ihm gegenüber noch nie gegeben. Jetzt trat Dr. Metzler herein und schloß die Infusion an, ohne mit Sàndor auch nur ein Wort zu wechseln. Er sprach lediglich mit Dr. Daniel und bedankte sich bei ihm für seine Hilfe. Erst dann wandte er sich Sàndor zu.
»So, mein Freund, das wär’s fürs erste. Für ein paar Wochen werden Sie jetzt hier festsitzen.«
Beschämt senkte Sàndor den Kopf. »Es tut mir leid.«
»Das glaube ich Ihnen sogar«, meinte Dr. Metzler, dann wies er auf das Tablett, das Schwester Alexandra auf dem fahrbaren Nachttischchen abgestellt hatte. »Sie können jetzt essen, und anschließend wird geschlafen. Haben wir uns verstanden?«
Sàndor nickte. »Ja, Herr Chefarzt.«
Trotz des Ernstes der Lage mußte Dr. Daniel nun doch schmunzeln. »Erstaunlich, wie brav du sein kannst – wenn man dir keine andere Wahl läßt.«
Dr. Metzler nickte zustimmend, was Sàndor wieder verlegen machte.
»Es tut mir wirklich leid, daß ich nicht auf Sie gehört habe«, beteuerte er.
Dr. Daniel fuhr ihm durch die dichten Locken. »Das wird schon wieder, mein Junge. In ein paar Wochen wird das alles der Vergangenheit angehören.«
*
Eva-Maria erfuhr noch am selben Tag, wie krank Sàndor war.
»Ich glaube, er würde sich sehr freuen, wenn du ihn besuchen würdest«, meinte Dr. Daniel.
Eva-Marie zögerte.
»Ich bin ja auch noch nicht gesund«, wandte sie dann ein, doch diese Ausrede klang nicht sehr glaubwürdig.
Dr. Daniel lächelte. »Du bist aber nicht ans Bett gefesselt, Eva-Maria.« Er griff nach ihrer Hand. »Glaub mir doch endlich. Sàndor liebt dich.«
Eva-Maria preßte die Lippen zusammen. Wenn sie nur nicht so viel Angst davor gehabt hätte, vom ihm abgewiesen zu werden.
»Er hat sich die ganze Zeit so lieb um mich gekümmert«, erklärte sie leise. »Da bin ich ihm wohl eigentlich einen Besuch schuldig.«
»Das meine ich aber auch«, stimmte Dr. Daniel zu. Bereitwillig begleitete er Eva-Maria in die Chirurgie hinüber bis zu dem Zimmer, in dem Sàndor lag.
»Hineingehen mußt du schon allein«, meinte er.
Eva-Maria nickte, dann atmete sie tief durch, klopfte und trat schließlich ein. Sàndor lag im Bett, und im ersten Moment dachte Eva-Maria, er würde schlafen, doch bei ihrem Eintreten wandte er den Kopf und richtete sich mit einem strahlenden Lächeln auf.
»Eva-Maria!«
Es war das erste Mal, daß er sie beim Vornamen nannte, und der Klang seiner Stimme traf das junge Mädchen mitten ins Herz. Sollte Dr. Daniel tatsächlich recht haben? Die Antwort auf diese Frage lag in Sàndors dunklen Augen. Jetzt streckte er die rechte Hand aus. Eva-Maria zögerte noch sekundenlang, dann ergriff sie seine Hand und setzte sich auf die Bettkante. Plötzlich wurde ihr bewußt, was sie da tat, und voller Verlegenheit ließ sie seine Hand wieder los.
»Es ist meine Schuld, daß du hier liegst«, meinte sie und bemerkte dabei gar nicht, daß sie ihn ganz selbstverständlich duzte.
Sàndor schüttelte den Kopf. »Nein, das ist schon meine eigene Schuld. Hätte ich auf Dr. Daniel und Dr. Metzler gehört, dann wäre ich sicher mit einer harmlosen Erkältung davongekommen.«
Er zögerte einen Moment, dann berührte er sehr behutsam ihr Gesicht. Erschrocken zuckte Eva-Maria zusammen. Für einen Moment trafen sich ihre Augen, dann senkte das junge Mädchen verwirrt den Blick. Noch immer wagte sie nicht zu glauben, was doch ganz offensichtlich der Fall war.
»Ich kann es nicht mehr länger für mich behalten«, platzte Sàndor plötzlich heraus. »Eva-Maria, ich liebe dich. Als ich dich das erste Mal sah, habe ich mich bereits in dich verliebt, aber bis jetzt…, ich hatte Angst, es dir zu sagen. Dr. Metzler…, der Chefarzt…, er hat gesagt, er würde es nicht gern sehen, wenn Personal und Patienten…« Er tastete nach ihrer Hand. Sanft, aber dennoch fest schlossen sich seine Finger darum, und er spürte, wie Eva-Maria zitterte. »Wir kennen uns kaum…, eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht, trotzdem bin ich sicher, daß ich in dir die wahre Liebe gefunden habe…, und gegen die kann auch Dr. Metzler nichts einzuwenden haben.«
Obwohl sie sich nach seiner Berührung immer gesehnt hatte, entzog Eva-Maria ihm jetzt ihre Hand.
»Ich habe gelogen.«
Die Worte standen im Raum, als wollten sie das junge Mäd-chen erdrücken.
»Ich weiß«, antwortete Sàndor nach einer Zeit, die Eva-Maria wie eine Ewigkeit erschien. Er sah ihr in die Augen. »Sagst du mir auch den Grund dafür?«
Diesmal hielt Eva-Maria seinem Blick stand. Sie wußte, daß sie jetzt ebenso ehrlich sein mußte, wie Sàndor es gewesen war.
»Du warst der Grund«, antwortete sie leise, aber deutlich. »Ich wollte nicht aus der Klinik entlassen werden, weil ich Angst hatte, dich dann nicht mehr zu sehen.« Mit einer fahrigen Handbewegung strich sie ihr langes blondes Haar zurück. »Ich habe nicht damit gerechnet, daß man mich so gründlich untersuchen würde…, irgendwie dachte ich, man würde mich nur zur Beobachtung hierbehalten. Ich dachte, du würdest weiterhin zu mir kommen und meinen Blutdruck und Puls kontrollieren. Es waren so kleine, kaum wahrnehmbare Berührungen, aber ich freute mich jeden Tag aufs neue darauf, und der Gedanke, auf deine sanften Hände verzichten zu müssen… Es war mir einfach unerträglich.« Wieder strich sie ihre Haare zurück. »Dann flog meine Lüge auf, und ich geriet in Panik. Ich dachte, ein Mann wie du könnte keine Lügnerin lieben. Der Traum, den ich hatte, bestätigte mich noch darin.« Erst jetzt wich sie seinem Blick aus. »Deshalb bin ich weggelaufen. Ich dachte, ich könnte dir nie wieder in die Augen sehen.«
Sàndor hatte dieser langen Beichte gelauscht, ohne Eva-Maria auch nur ein einziges Mal zu unterbrechen. Jetzt nahm er ihre Hände und zog sie zu sich heran. Zärtlich küßte er sie auf die Stirn.
»Etwas anderes darf ich jetzt nicht«, meinte er und schenkte ihr dabei ein liebevolles Lächeln. »Ich bin nämlich nicht ganz sicher, ob das, was ich habe, ansteckend ist.«
Auch auf Eva-Marias Gesicht schlich sich nun ein Lächeln.
»Egal«, murmelte sie. »Ich habe doch dasselbe…, wenn es bei mir auch schon fast vorbei ist.«
Sie zögerte noch sekundenlang, dann beugte sie sich zu ihm hinunter und küßte ihn.
»Ich liebe dich, Sàndor«, gestand sie leise.
»Ich liebe dich auch, Eva-Maria. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt.«
*
Dr. Daniel war natürlich der erste, der erfuhr, daß sich Eva-Maria und Sàndor nun endlich zu ihrer Liebe bekannt hatten.
»Dann war die Krankheit ja wenigstens am Ende noch für etwas gut.«
Sàndors schwere Lungenentzündung brauchte noch eine geraume Zeit, bis sie wirklich ausgeheilt war, doch Eva-Maria wich kaum einmal von seiner Seite, was den langwierigen Genesungsprozeß für den jungen Mann natürlich sehr viel angenehmer machte.
Damit hatte Dr. Daniel nun wenigstens eine Sorge weniger, doch die Arbeit ging ihm damit natürlich nicht aus. In der zweiunddreißigsten Schwangerschafts-woche, also zwei Monate zu früh, ließ sich Brigitte Kleins Baby nicht länger im Mutterleib halten.
Schon einige Wochen zuvor war sie in die Sommer-Klinik nach München überstellt worden, und von dort erreichte Dr. Daniel nun der alarmierende Anruf.
»Robert, steig in dein Auto und komm sofort her«, erklärte Dr. Georg Sommer am Telefon. »Deine Patientin hat eine vorzeitige Plazentalösung. Wir müssen das Baby holen.«
Eine halbe Stunde später standen Dr. Daniel und Dr. Sommer schon am OP-Tisch. Das Baby, das sie mit Kaiserschnitt holten, war noch sehr klein, aber immerhin schon kräftig genug, um allein zu atmen. Der Spezialist für Frühgeborene, Dr. Senge, nahm sich des winzigen Wesens an.
»Und? Was ist mit dem Kind?« wollte Dr. Daniel wissen, kaum daß er den Kaiserschnitt zu Ende gebracht hatte.
Dr. Senge lächelte. »Er hat den Diabetes seiner Mutter gut überstanden. Im Moment kann man zwar noch kein endgültiges Urteil riskieren, aber ich denke nicht, daß es größere Probleme geben wird.«
Mit Dr. Senges Erlaubnis nahm Dr. Daniel den fahrbahren Brutkasten mit in den Aufwachraum, damit Brigitte Klein ihr Baby gleich sehen könnte, wenn sie aus der Narkose erwachte.
Dr. Daniel war gerade ein paar Minuten bei ihr, als ihre Lider zu flattern begannen, dann schlug sie die Augen auf. Ihr erster Blick fiel auf Dr. Daniel, der sich lächelnd über sie beugte.
»Herzlichen Glückwunsch, junge Mami«, erklärte er.
»Ist es… gesund?« brachte Brigitte mühsam hervor. Die Nachwirkungen der Narkose machten ihr das Sprechen noch etwas schwierig.
Dr. Daniel nickte. »Sie haben einen kräftigen kleinen Jungen zur Welt gebracht, der Ihre Zuckerkrankheit gut überstanden hat. Der Frühgeborenen-Spezialist rechnet mit keinen weiteren Problemen.«
Jetzt trat Dr. Daniel zur Seite und schob den Inkubator näher an Brigittes Bett. Langsam, weil es ihr noch schwerfiel, koordinierte Bewegungen durchzuführen, wandte sie den Kopf und betrachtete das winzige Baby.
»Er ist so… klein. Ist das… normal?«
Wieder nickte Dr. Daniel. »Der Kleine ist für sein Alter sogar sehr gut entwickelt. Immerhin hätte er bis zum regulären Geburtstermin noch zwei Monate Zeit gehabt.« Er lächelte. »Da müssen Sie es ihm schon zugestehen, daß er ein wenig kleiner ist als andere Babys. Aber warten Sie ein paar Monate, dann wird er sich in nichts mehr von anderen Kindern seines Alters unterscheiden.«
Ein glückliches Leuchten flog über Brigittes Gesicht.
»Wissen Sie schon, wie er heißen soll?« fragte Dr. Daniel.
Brigitte nickte. »Oliver und ich haben gesagt, wenn es ein Junge wird, dann soll er Bernhard heißen – nach Sarinas Vater. Schließlich verdanken wir es nur Graf Bernhard von Gehraus Großzügigkeit, daß wir uns trotz des Babys den Hausbau leisten können.«
Dr. Daniel nickte. »Ich glaube, Ihr kleiner Bernhard wird einmal sehr stolz auf seinen Namen sein.«
Noch einmal betrachtete Brigitte ihr Baby, und mit Dr. Daniels Hilfe gelang es ihr sogar, durch eines der seitlich angebrachten Eingriffslöcher den kleinen Bernhard zu streicheln. Das Lächeln, das dabei auf ihrem Gesicht lag, bewies mehr als jedes Wort, wie glücklich sie war.
»Sie hatten recht, Herr Doktor«, flüsterte sie. »Es ist alles gut geworden. Wenn nun mein Diabetes auch noch vergeht…«
»Da bin ich ganz sicher, Fräulein Klein«, meinte Dr. Daniel.
*
Es zeigte sich, daß Dr. Daniel recht behalten sollte. Als Brigitte Klein entlassen werden konnte, war ihr Stoffwechsel bereits wieder so normal, wie er es auch vor der Schwangerschaft gewesen war. Knapp zwei Monate später durfte dann auch endlich der kleine Bernhard die Klinik verlassen, und wenige Wochen später fand in der Pfarrkirche St. Benedikt in Steinhausen nicht nur die Hochzeit von Brigitte Klein und Oliver Horvath statt, sondern auch die Taufe ihres Sohnes.
Graf Bernhard von Gehrau hatte sich mit Freuden bereit erklärt, als Taufpate seines kleinen Namensvetters zu fungieren, und als Dr. Daniel, der natürlich ebenfalls zu den geladenen Gästen gehörte, nun die freudestrahlende Familie sah, konnte er wieder einmal rundherum zufrieden sein. Wie grau und düster hatte die Zukunft für Brigitte, Oliver und den kleinen Bernhard noch vor kurzem ausgesehen – und nun gingen sie einem Leben voller Glück und Liebe entgegen. Was wollte man mehr?
– E N D E –