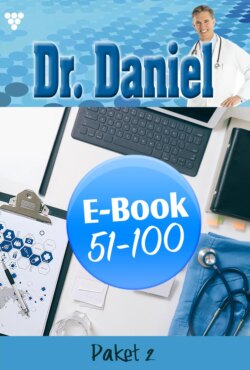Читать книгу Dr. Daniel Paket 2 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNiedergeschlagen kam Annemarie Demel nach Hause und ließ sich kraftlos auf das kleine Sofa fallen. Nahezu fünf Wochen war es her, seit sie von München weg aufs Land gezogen war. Fünf Wochen, in denen sie vergeblich nach Arbeit gesucht hatte.
Dabei war sie eigentlich eine reiche junge Frau – sie hatte nur nichts davon. Ihr Vater hatte ihr bei seinem Tod nur eine kleine Summe hinterlassen, das restliche Vermögen war bis zu Annemaries dreißigstem Geburtstag fest angelegt. Sie würde also erst in neun Jahren darüber verfügen können.
Sie seufzte tief auf. Noch immer konnte sie nicht verstehen, warum ihr Vater das getan hatte. Sie war nicht verschwenderisch, vermutlich weil sie in finanzieller Hinsicht noch nie verwöhnt worden war. Ihr hätte es ja genügt, so unabhängig zu sein, daß sie nicht so verzweifelt auf eine Arbeitsstelle angewiesen gewesen wäre, doch ohne ihren eigenen Verdienst konnte sie sich höchstens noch drei oder vier Monate über Wasser halten.
Sie hörte, wie sich der Schlüssel im Schloß drehte und dann die vertraute männliche Stimme ertönte.
»Annemie?«
Ein glückliches Lächeln huschte über Annemaries Gesicht, als sie aufstand und aus dem Wohnzimmer ging, um ihren Freund zu begrüßen.
»Franzl.« Sie umarmte und küßte ihn, als hätte sie ihn wochenlang nicht gesehen, dabei trafen sie sich fast täglich.
»Du siehst ziemlich geschafft aus«, stellte Franz Baumgartner fest, als er Annemarie prüfend musterte.
Sie nickte. »Das bin ich auch.« Mit einem tiefen Seufzer lehnte sie sich gegen ihren Freund. »Vielleicht hätte ich doch in München bleiben sollen. Manchmal kommt es mir vor, als hätten alle, die an den umliegenden kleinen Kliniken arbeiten, eine Stellung auf Lebenszeit.«
Zärtlich streichelte Franz über ihr langes, dunkelblondes Haar. »Du warst in München schon ein halbes Jahr arbeitslos.« Aufmunternd lächelte er sie an. »Hab Geduld, Liebes, du wirst bestimmt wieder Arbeit finden.«
»Ja, aber wann?« Annemarie schüttelte traurig den Kopf. »Heute war ich im hiesigen Kreiskrankenhaus. Der Chefarzt war sehr nett, aber er konnte mir auch keine Hoffnungen auf eine bald freiwerdende Stelle machen. Das gesamte Münchner Umland habe ich schon abgegrast…« Sie zuckte die Schultern. »Es ist hoffnungslos.«
»Warst du schon in der Waldsee-Klinik?« wollte Franz wissen. »Die hat einen erstklassigen Ruf.« Er lächelte. »Ich selbst habe da noch keine Erfahrungen sammeln können, weil ich glücklicherweise noch nie so krank war, daß ich ein Krankenhaus benötigt hätte.«
Annemarie lächelte ihn an. »Sei froh.« Dann schüttelte sie wieder den Kopf. »In der Waldsee-Klinik ist bestimmt keine Stelle frei. Eine Freundin von mir arbeitet dort – Bianca Behrens. Wir haben zusammen unsere Ausbildung gemacht und sogar zwei Jahre am gleichen Krankenhaus in München gearbeitet, aber dann wurde die Waldsee-Klinik gebaut, und Bianca hat sich sofort dort beworben.« Sie seufzte. »Ich schätze, sie hat den Absprung rechtzeitig geschafft, und ich muß es jetzt büßen, weil ich damals ein großes Krankenhaus der Waldsee-Klinik vorgezogen habe.«
»Ich glaube nicht, daß du es so sehen kannst«, entgegnete Franz. »Die Kündigung, die dich und etliche andere Krankenschwestern getroffen hat, kam allgemein sehr überraschend. Niemand konnte damit rechnen…« Er stockte, griff an seinen Kopf und taumelte ein wenig.
Erschrocken sah Annemarie ihn an. »Was hast du, Franzl? Ist dir nicht gut?«
»Ich weiß nicht recht«, murmelte er. »In letzter Zeit scheint mein Kreislauf ein bißchen labil zu sein.« Er winkte ab. »Wahrscheinlich brüte ich nur eine Erkältung aus. Die halbe Firma ist ja schon krank.« Er lächelte Annemarie an. »Jedenfalls ist es nichts, worüber du dir Sorgen machen müßtest.«
Aufmerksam betrachtete Annemarie ihn. »Du siehst tatsächlich ein bißchen blaß aus.« Sanft streichelte sie sein Gesicht. »Was hältst du davon, wenn du dich hinlegst und so richtig von mir verwöhnen läßt?«
Franz grinste. »Aha, jetzt muß ich also deine Arbeitslosigkeit ausbaden. Weil du keine Patienten zu versorgen hast, nimmst du mich als Ersatz.«
»Quatschkopf«, murmelte Annemarie zärtlich. »Ich spiele hier nicht die Krankenschwester, sondern spreche als Freundin, Fast-Verlobte und Ehefrau in spe zu dir.«
»Meine Güte!« lachte Franz. »So viel bist du schon für mich?« Er nahm sie in die Arme und küßte sie liebevoll. »Ich glaube, da müssen wir einiges ändern. Vielleicht sollten wir die Freundin vergessen und aus der Fast-Verlobten eine wirkliche Verlobte machen.«
»Du bist verrückt«, urteilte Annemarie. »Gerade jetzt, wo ich arbeitslos bin…«
»Das ist ja nun wirklich kein Grund, die Verlobung ausfallen zu lassen«, fiel Franz ihr ins Wort. »Weißt du was, wir beide gehen am Samstag ganz fein aus und feiern eine stille Verlobung. Und wenn du weiterhin keine Arbeit findest, heiraten wir, und ich mache dich zur Mutter. Damit hättest du sicher einen Beruf, der dich voll und ganz ausfüllen würde.«
Glücklich schmiegte sich Annemarie an ihn. »Du weißt genau, wie du Träume wahr werden lassen kannst.« Dann seufzte sie. »Allerdings wird es nicht ganz so einfach sein. Nur mit deinem Verdienst…«
Behutsam legte Franz ihr einen Finger auf den Mund. »Geld ist nicht das Wichtigste im Leben.«
»Wenn man es hat«, ergänzte Annemarie trocken, dann lehnte sie sich wieder an Franz. »Manchmal verstehe ich wirklich nicht, weshalb mir mein Vater kein bißchen finanzielle Sicherheit verschafft hat. Er hätte die Möglichkeit dazu gehabt, und er wußte auch, daß ich das Geld niemals sinnlos verpraßt hätte.«
»In neun Jahren sieht alles ganz anders aus«, tröstete Franz sie, dann grinste er wieder. »Warte nur, da lasse ich mich dann von dir aushalten.«
Annemarie mußte lachen. »Dazu wärst du genau der Richtige. Seit wir zusammen sind, hast du mich nicht ein einziges Mal bezahlen lassen, wenn wir ausgegangen sind, dabei gab es Zeiten, in denen ich besser verdiente als du.«
Da nahm Franz sie zärtlich in die Arme. »Geld ist mir nicht wichtig. Wichtig bist bloß du.« Er küßte sie. »Wann heiraten wir?« raunte er ihr ins Ohr, lachte leise und fügte hinzu: »Auf diese Weise würden wir immerhin schon eine Miete sparen.«
Annemarie lächelte zu ihm hinauf. »Optimist.«
»Aus deinem Mund klingt das fast wie eine Beleidigung«, meinte Franz und küßte sie, dann wurde er wieder ernst. »Ich weiß genau, wie unsere finanzielle Lage nach einer Hochzeit zumindest in den ersten Jahren aussehen würde, aber es wäre durchaus zu schaffen. Meine Wohnung in Steinhausen ist günstiger als diese hier.«
»Ja, aber auch kleiner«, entgegnete Annemarie. »Wenn du gleich an eine Familie denkst, wird es da bald ziemlich eng werden.« Sie schüttelte den Kopf. »Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, Franz, ich muß zuerst wieder eine Arbeit finden. Wir sind jung, haben also genügend Zeit. Wenn wir ein bißchen was auf der hohen Kante haben, ist es noch früh genug um zu heiraten und Kinder zu haben. Auf das Erbe meiner Eltern will ich nicht warten. An meinem dreißigsten Geburtstag möchte ich lieber schon Mutter sein, als dann erst mit dem Kinderkriegen anzufangen.«
Zärtlich stupste Franz sie an der Nase. »Das ist wieder mal meine umsichtige und vernünftige Annemie. Ich wäre impulsiver… leichtsinniger. Ich würde dich zuerst heiraten und dann darüber nachdenken, wie alles weitergehen soll.«
Annemarie seufzte. »Es hat gelegentlich seine Vorteile, wenn man so sein kann.« Sie lächelte. »Aber auf diese Weise ergänzen wir uns doch ideal. Du ziehst vorwärts, und ich bremse – so finden wir immer den goldenen Mittelweg.«
*
In den folgenden Wochen ging es mit Franz Baumgartners Gesundheitszustand rapide bergab. Wie so oft in letzter Zeit war er auch heute wie erschlagen, als er von der Arbeit nach Hause kam. Er fühlte sich ausgelaugt und müde, hatte zunehmende Gliederschmerzen und immer wieder Kreislaufprobleme. Jeden Abend kostete es ihn mehr Überwindung, in das wenige Kilometer entfernte Geising zu fahren, um sich mit Annemarie zu treffen.
Auch jetzt war Franz nahe daran, seine Verlobte anzurufen und ihr zu sagen, daß er nicht kommen würde, doch dann war seine Sehnsucht nach Annemarie stärker als seine Müdigkeit. Ohne Appetit aß er ein paar Happen, bevor er sich ins Auto setzte und losfuhr. Sein Kopf begann zu dröhnen, der Druck wurde schier unerträglich, und Franz hatte das Gefühl, als würde die Straße vor ihm mit den am Rand stehenden Bäumen verschmelzen. Er nahm den Fuß vom Gas und fuhr sich mit einer Hand über die Augen. Der Druck im Kopf war jetzt so stark, daß Franz glaubte, er müsse jeden Moment platzen. In diesem Augenblick fühlte er etwas Warmes, Feuchtes aus seiner Nase laufen. Noch bevor er die Hand hinhielt, wußte er schon, daß es Blut war.
»Verdammt, schon wieder«, murmelte er, doch im Grunde war er sogar erleichtert. Das Nasenbluten würde den unerträglichen Druck im Kopf leichter werden lassen. Das war in den vergangenen Tagen immer so gewesen. Mit einer Hand suchte er in seiner Jacke nach der Packung Papiertaschentücher, die er immer bei sich hatte. Er wußte, daß er eigentlich anhalten sollte, aber er war ja praktisch allein auf der Straße, konnte also niemanden gefährden.
Das Nasenbluten war diesmal stärker als sonst, und zu seiner eigenen Überraschung fühlte Franz nun auch im Mund Blutgeschmack. Er lenkte seinen Wagen gerade noch an den Straßenrand, aber bevor er anhalten konnte, wurde ihm bereits schwarz vor Augen. Instinktiv trat er auf die Bremse, rutschte aber ab und fühlte, wie der Wagen beschleunigte, doch er schaffte es nicht mehr, den Fuß vom Gas zu nehmen. Dann verlor er das Bewußtsein und bekam auf diese Weise nicht mit, wie der führerlos umherschlingernde Wagen eine mächtige Eiche rammte.
*
Der Tag war für Annemarie Demel wieder nicht besonders gut gelaufen, dabei hatte es schon
so vielversprechend ausgesehen. Entgegen aller Befürchtungen war auf ihre Bewerbung bei einer kleinen Privatklinik im Münchner Osten eine positive Antwort gekommen. Man hatte Annemarie zu einem Vorstellungsgespräch gebeten, aber als es soweit war, gab sich der Direktor dieser Klinik plötzlich sehr kühl und sachlich mit dem Ergebnis, daß sie die freie Stelle nun doch nicht bekam. Der Grund dafür lag auf der Hand, denn Annemarie sah noch, wie nach ihr eine junge Frau ihres Alters das Büro des Direktors betrat, ihn umarmte und zärtlich Onkel Willi nannte. Höchstwahrscheinlich würde sie die Stelle bekommen, weil sie über beste Beziehungen zum Klinikdirektor verfügte.
Niedergeschlagen war Annemarie heimgekommen, und nur der Gedanke, daß Franz in ein paar Stunden da sein würde, konnte sie noch aufmuntern. Doch es wurde Abend, und Franz kam nicht. Zuerst dachte Annemarie noch an Überstunden, doch je weiter die Zeit voranschritt, um so größer wurde ihre Sorge. Ein paarmal rief sie bei Franz an, doch niemand meldete sich – ein deutliches Zeichen, daß er unterwegs sein mußte. Schließlich stand sie nur noch am Fenster, starrte in die Dunkelheit und bekam bei jedem sich nähernden Scheinwerferlicht Herzklopfen, doch die wenigen Autos, die den Weg durch das winzige Geising fanden, fuhren vorbei.
Mittlerweile machte sich Annemarie keine Sorgen mehr um Franz, sondern vibrierte innerlich vor Angst, daß ihm etwas zugestoßen sein könnte. In den vergangenen Wochen war er ihr überhaupt recht seltsam vorgekommen, doch auf ihre besorgten Fragen hin hatte er locker reagiert und behauptet, es wäre nur eine harmlose Erkältung, die ihn heimgesucht hätte und die er nicht los würde, weil er sich im Betrieb immer wieder von neuem anstecke. Annemarie hatte ihm geglaubt, weil es ihr manchmal ähnlich ergangen war, als sie noch gearbeitet hatte.
Schließlich hielt Annemarie es nicht länger aus. Sie trat zum Telefon und wählte die Nummer von Dieter Krause, Franz’ bestem Freund.
»Dieter, hier ist Annemarie«, gab sie sich zu erkennen und versuchte nicht einmal, die Angst in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Ich warte seit über zwei Stunden auf Franz. Weißt du, wo er stecken könnte?«
»Tut mir leid, Annemarie«, entgegnete Dieter bedauernd. »Ich habe ihn seit letzter Woche nicht mehr gesehen.«
»Ich habe solche Angst«, gestand Annemarie. »Wenn ihm etwas passiert ist… er war in letzter Zeit überhaupt ein bißchen komisch. Angeblich eine Erkältung, aber… vielleicht hatte er auch Kreislaufprobleme…«
»Immer mit der Ruhe, Annemarie«, versuchte Dieter sie zu beruhigen. »Vielleicht ist er bei der Heimfahrt vom Betrieb in einen Stau geraten.« Er zögerte kurz. »Weißt du was, ich komme zu dir, dann können wir gemeinsam überlegen, was wir unternehmen.«
Annemarie war erleichtert. »Danke, Dieter.«
»Das ist doch ganz selbstverständlich«, meinte er, verabschiedete sich und legte auf, dann verließ er das kleine Häuschen, das er mit seiner verwitweten Mutter und seiner jüngeren Schwester bewohnte, und fuhr los. Kurz entschlossen schlug er den kleinen Umweg über Steinhausen ein.
Er hatte den idyllischen Vorgebirgsort gerade ein paar Kilometer hinter sich gelassen, als ihm ein weißes Auto am Straßenrand auffiel. Beim Näherkommen erkannte er das Nummernschild im Scheinwerferlicht und hielt seinen Wagen mit heftig klopfendem Herzen an.
Er stieg aus und trat zu dem Auto, das sich mit der mächtigen Eiche verkeilt hatte. Zusammengesunken und blutüberströmt saß Franz hinter dem Steuer. Dieter zögerte kurz, dann öffnete er die Autotür und beugte sich zu dem jungen Mann hinunter.
»Franz«, sprach er ihn an. Doch keine Reaktion erfolgte. Franz war bewußtlos, was vermutlich auf den hohen Blutverlust zurückzuführen war. Dieter zögerte kurz, dann schlug er die Autotür wieder zu und kehrte zu seinem Wagen zurück. Er ließ den Motor an und fuhr los, dabei lag ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht.
Wie der Zufall doch so spielte! Da versuchte er seit Jahren, Franz seine Freundin auszuspannen, doch ohne Erfolg. Gegen die Liebe der beiden war er machtlos gewesen, dabei war es ja weniger Annemarie selbst, die ihn reizte, sondern vielmehr das Geld, das sie an ihrem dreißigsten Geburtstag bekommen würde. Und nun hatte es ihm das Schicksal so leicht gemacht. Die Straße zwischen Steinhausen und Geising war kaum befahren. Vermutlich würde Franz längst verblutet sein, wenn ihn jemand finden würde.
»Ich muß nur noch den zuverlässigen Freund spielen, die arme Annemarie über den tragischen Tod ihres geliebten Freundes hinwegtrösten und mich in dieser Zeit unentbehrlich machen«, sagte Dieter zu sich selbst. »Und in ein paar Jahren gehört das Demel-Vermögen dann mir – dafür werde ich sorgen.«
*
Der Notruf erreichte die Waldsee-Klinik gegen elf Uhr abends. Der Oberarzt, Dr. Gerrit Scheibler, hatte Nachtschicht und nahm den Anruf entgegen. Aufgrund der Beschreibung des aufgeregten Mannes mußte es ein schlimmer Unfall sein, so daß sich der Oberarzt entschloß, im Krankenwagen mitzufahren. Er informierte nur noch den Chefarzt, der heute Bereitschaftsdienst hatte, dann stieg er mit den beiden Sanitätern in den bereitstehenden Wagen.
Keine fünf Minuten später hatten sie die Unfallstelle erreicht, und Dr. Scheibler kümmerte sich sofort um den blutüberströmten Mann, der besinnungslos hinter dem Steuer saß. Er wurde auf eine fahrbare Trage gelegt und im Laufschritt zum Krankenwagen gebracht. Dr. Scheibler stieg hinten mit ein, die Türen wurden zugeschlagen, dann brauste der Wagen zur Klinik zurück.
Währenddessen verschaffte sich Dr. Scheibler schon einen ersten Überblick über die Verletzungen des jungen Mannes und stellte erstaunt fest, daß der enorme Blutverlust von heftigem Nasenbluten verursacht worden war und offensichtlich gar nichts mit dem Unfall an sich zu tun hatte.
In der Klinik bestätigte sich Dr. Scheiblers Verdacht. Die Verletzungen, die durch den Unfall entstanden waren, beschränkten sich auf Hautabschürfungen und eine kleine Platzwunde am Kopf, die zwar genäht werden mußte, aber eigentlich nicht weiter schlimm war.
»Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe«, ordnete er an, und die OP-Schwester Petra Dölling, die von der Nachtschwester alarmiert worden war, kam seiner Aufforderung sofort nach.
Der junge Mann bekam Bluttransfusionen und wurde auf die Intensivstation gebracht. Hier wurden ein Katheder und ein Temperaturfühler gelegt, und als Dr. Scheibler diesen kontrollierte, stellte er fest, daß sein Patient leichtes Fieber hatte.
»Er kommt zu sich, Herr Oberarzt«, erklärte Schwester Petra.
Dr. Scheibler beugte sich über den jungen Mann, dessen Lider sich jetzt langsam öffneten.
»Nicht erschrecken«, bat der Oberarzt mit ruhiger Stimme. »Sie sind im Krankenhaus. Wissen Sie, was passiert ist?«
Der junge Mann nickte schwach. »Das Auto… ich wollte bremsen… bin abgerutscht und auf das Gaspedal…« Er stockte. »Annemie… sie weiß nicht…«
»Ihre Frau?« hakte Dr. Scheibler nach.
»Meine… Verlobte…«
»Ich werde mich darum kümmern«, versprach Dr. Scheibler. »Können Sie mir Ihren Namen sagen?«
»Baumgartner«, flüsterte er. »Franz Baumgartner.« Mühsam hob er eine Hand und griff nach Dr. Scheiblers weißem Kittel. »Ich… ich muß… auf die Toilette.«
Der Oberarzt schüttelte den Kopf. »Der Reiz wird von dem Katheder verursacht, und der Druck des Temperaturfühlers ist sicher auch nicht angenehm.« Er wandte sich der Schwester zu und gab eine kurze Anweisung. Wenig später bekam er eine vorbereitete Spritze gereicht und injizierte sie Franz direkt in die Vene.
»Das Medikament wird Ihre unangenehme Situation ein bißchen erträglicher machen«, versprach er, dann setzte er sich auf die Bettkante. »Ich weiß, daß Sie sehr müde sind, aber ein paar Fragen müssen Sie mir schon noch beantworten. Seit wann haben Sie dieses heftige Nasenbluten?«
»Seit ein paar Tagen«, antwortete Franz. Jedes Wort fiel ihm schwer. Er hatte das Gefühl, als würden ihm Lippen und Zunge nicht mehr gehorchen.
»Haben Sie auch noch andere Beschwerden?« hakte Dr. Scheib-ler nach.
Franz hatte Mühe, die Augen offenzuhalten. »Gliederschmerzen… Müdigkeit… ich könnte immerzu schlafen…«
»Das dürfen Sie jetzt auch«, meinte Dr. Scheibler und stand auf. »Sagen Sie mir nur noch den Namen Ihrer Verlobten, damit ich sie benachrichtigen kann.«
»Annemie…«, flüsterte er. »Annemie…« Mit dem letzten Wort auf den Lippen schlief er ein.
»Das ist nicht viel«, meinte Schwester Petra.
Dr. Scheibler nickte seufzend. »Ich hätte ihn gleich nach Namen und Adresse seiner Verlobten fragen sollen, aber das andere war mir noch wichtiger.«
Mitleidig betrachtete Schwester Petra den jungen Mann, dann sah sie den Oberarzt an.
»Er ist sehr krank, nicht wahr?«
Dr. Scheibler nickte. »Ich fürchte, ja.«
Spontan zog die Schwester einen Stuhl an das Bett. »Ich bleibe bei ihm, bis er wieder aufwacht. Vielleicht kann er mir dann ja den Namen seiner Verlobten sagen. Sie wird sich wahrscheinlich schon Sorgen machen.«
»Wenn er auf dem Weg zu ihr war, mit Sicherheit«, stimmte Dr. Scheibler zu, überlegte kurz und fuhr dann fort: »Ich werde mir seine persönlichen Sachen ansehen. Möglicherweise finde ich einen Anhaltspunkt.«
Doch die Durchsicht von Brieftasche und Geldbörse ergab nichts. Dr. Scheibler fand zwar das Foto einer hübschen jungen Frau mit langen, dunkelblonden Haaren, und er war sicher, daß es sich bei dieser Frau um besagte Annemie handeln müsse, doch ein vollständiger Name oder gar eine Adresse waren nicht enthalten.
»Wozu auch?« murmelte sich der Oberarzt zu. »Er weiß das ja alles, und einen anderen gehen diese Dinge normalerweise nichts an.«
»Er ist kurz aufgewacht.«
Dr. Scheibler drehte sich um und sah sich Schwester Petra gegenüber.
»Annemarie Demel heißt seine Verlobte«, fuhr die junge Krankenschwester fort. »Sie wohnt in Geising drüben. Soll ich sie anrufen, oder möchten Sie das lieber selbst machen?«
Dr. Scheibler nickte. »Das wird wohl das Beste sein.« Er überlegte kurz. »Nehmen Sie dem Patienten in der Zwischenzeit Blut ab, und bringen Sie es gleich ins Labor. Ebenso eine Urinprobe.« Wieder zögerte er, dann fügte er hinzu: »Und bereiten Sie alles für eine Knochenmarkbiopsie vor.«
Schwester Petra erschrak. »Leukämie?«
Dr. Scheibler nickte. »Es spricht leider alles dafür.«
Dabei mußte er unwillkürlich daran denken, wie er selbst damals von dieser schrecklichen Krankheit heimgesucht worden war. Daß er überlebt hatte, war nur dem Mut und der Risikobereitschaft seines Freundes und Schwagers Dr. Wolfgang Metzler, dem hiesigen Chefarzt, zu verdanken gewesen.
Dr. Scheibler versuchte, diese Gedanken abzuschütteln, doch wie immer, wenn er mit Leukämie konfrontiert wurde, stand die Erinnerung an die Todesangst, die er durchlitten hatte, und an die schmerzvolle Behandlung wieder vor ihm, und er hoffte inständig, daß es ihm gelingen würde, den jungen Mann, der jetzt auf der Intensivstation lag, zu retten.
*
Annemarie war nur noch ein Nervenbündel, als Dieter bei ihr eintraf.
»Wir müssen die Polizei benachrichtigen!« stieß sie hervor. »Ich fühle, daß Franz etwas passiert ist.«
»Langsam, Annemarie«, entgegnete Dieter und legte einen Arm um ihre Schultern. »Noch wissen wir doch gar nicht…«
Es gelang ihm nicht, den Satz zu beenden, denn in diesem Moment klingelte das Telefon. Hastig riß Annemarie den Hörer an ihr Ohr.
»Franz?« Sie schrie seinen Namen beinahe.
»Fräulein Demel?« fragte eine männliche Stimme zurück, wartete Annemaries bejahende Antwort ab und fuhr dann fort: »Hier ist Dr. Scheibler von der Wald-see-Klinik in Steinhausen. Bitte erschrecken Sie nicht. Ihr Ver-
lobter hatte einen Autounfall, aber ihm ist nicht viel passiert. Nur ein paar Hautabschürfun-
gen und eine kleine Platzwunde am Kopf.«
»Ich komme sofort!« rief Annemarie, knallte den Hörer auf die Gabel und starrte Dieter dann aus angstvoll geweiteten Augen an. »Franz hatte einen Unfall. Er liegt in der Waldsee-Klinik.«
»O Gott.« Dieter spielte den Erschrockenen perfekt, dabei verfluchte er insgeheim das Schicksal, das es zugelassen hatte, daß Franz doch noch rechtzeitig gefunden worden war. »Ich fahre dich natürlich hinüber.«
Eine knappe halbe Stunde später hielt er vor der Doppeltür der Klinik an und ließ Annemarie aussteigen.
»Ich komme nach, sobald ich den Wagen am Parkplatz abgestellt habe!« rief er ihr noch nach, doch sie hatte es schon gar nicht mehr gehört. Wie gehetzt rannte sie in die Eingangshalle und wurde dort von einem Mann Ende Dreißig erwartet, dessen weißer Kittel ihn als Arzt auswies.
»Fräulein Demel, ich bin Dr. Scheibler, der Oberarzt hier«, stellte er sich vor.
»Wo ist Franz?« stieß Annemarie hastig hervor.
»Er liegt im Moment auf der Intensivstation«, antwortete Dr. Scheibler, »aber…«
»Am Telefon sagten Sie doch, er wäre nicht schwer verletzt!« fiel Annemarie ihm ins Wort. »Warum ist er dann auf Intensiv?«
Überrascht sah der Oberarzt sie an. Die Ausdrucksweise der jungen Frau ließ darauf schließen, daß ihr der Krankenhausbetrieb durchaus vertraut war.
»Ich habe Sie nicht belogen«, entgegnete Dr. Scheibler ruhig. »Ihr Verlobter hat bei dem Unfall keine schweren Verletzungen davongetragen, unglücklicherweise aber sehr viel Blut verloren, weshalb sein Gesamtzustand äußerst labil ist. Er bekommt Bluttransfusionen und wird aus diesem Grund intensiv überwacht.«
»Wenn er nicht schwer verletzt war, wie konnte er dann so viel Blut verlieren?« wollte Annemarie wissen.
Dr. Scheibler zögerte. Er wollte über Franz Baumgartners Krankheit nicht sprechen, bevor er alle Untersuchungen durchgeführt hatte.
»Er hatte starkes Nasenbluten«, antwortete er daher nur.
Annemarie runzelte die Stirn. »Nasenbluten? Einfach so?«
»Das muß noch geklärt werden«, wich der Oberarzt aus. »Im Augenblick ist nur wichtig, den Kreislauf zu stabilisieren.«
»Wäre es nicht noch wichtiger, die Ursache für so heftiges Nasenbluten herauszufinden?« gab Annemarie zurück. »Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß von Bianca Behrens, daß Sie ein erstklassiger Arzt sind, aber in diesem Punkt… ich habe irgendwie das Gefühl, als würden Sie zu zögernd vorgehen.«
»Sie sind vom Fach, habe ich recht?« wollte Dr. Scheibler wissen.
»Wie man’s nimmt. Ich bin Krankenschwester, im Moment allerdings arbeitslos.«
Dr. Scheibler nickte. Er wußte, daß er hier vorsichtig sein mußte. Zum einen wollte er über Franz Baumgartners Krankheit nicht sprechen, bis alle Ergebnisse vorlagen und er sich mit dem Patienten selbst darüber unterhalten hatte, zum anderen wollte er auch nicht den Eindruck erwecken, er würde als Arzt zu nachlässig mit seinen Patienten umgehen.
»Keine Sorge, Fräulein Demel, ich gehe im Fall Ihres Verlobten nicht zu zögernd vor«, erklärte Dr. Scheibler schließlich. »Als er hier eingeliefert wurde, war die Erstversorgung zunächst am wichtigsten. Durch den hohen Blutverlust, der im Moment noch ausgeglichen wird, war und ist er sehr geschwächt. In diesem Zustand wäre es verantwortungslos, wenn ich ihn irgendwelchen Untersuchungen unterziehen würde, die sich vielleicht erübrigen würden, wenn er ansprechbar ist und meine Fragen beantworten kann.«
Annemarie äußerte sich nicht dazu, weil sie nicht sicher war, ob der Oberarzt tatsächlich nachlässig handelte oder ob er die nötigen Untersuchungen vielleicht längst durchgeführt hatte und ihr das Ergebnis aus irgendeinem Grund verschwieg – wenn auch nur deshalb, weil sie mit Franz nicht verheiratet, sondern erst verlobt war.
»Darf ich ihn sehen?« fragte sie jetzt.
Dr. Scheibler nickte ohne zu zögern. »Selbstverständlich, Fräulein Demel.«
Er begleitete Annemarie zur Intensivstation. Die junge Frau erschrak, als sie Franz zwischen all den Schläuchen und Apparaten liegen sah, doch dann ging ihr geübter Blick zur Temperaturanzeige hinüber.
»Er hat Fieber«, stellte sie fest, und der Blick, mit dem sie Dr. Scheibler anschaute, war zwingend. »Was ist mit Franz?«
»Er ist erkältet«, antwortete Dr. Scheibler und sagte damit auch die Wahrheit. Er verschwieg lediglich, wo diese Infektanfälligkeit herrührte.
Annemarie atmete tief durch, dann wandte sie sich ab und trat zu Franz, der offensichtlich schlief. Sehr sanft berührte sie sein blasses Gesicht und war in diesem Augenblick nur noch liebende Frau. Ihr ganzes Wissen wurde hinter die Sorge um Franz zurückgedrängt.
»Liebling«, flüsterte sie zärtlich.
Franz’ Lider begannen zu flattern, dann öffneten sich seine Augen langsam.
»Annemie.« Seine Stimme klang schwach. Er versuchte, eine Hand zu heben, was ihm nur mit großer Mühe gelang.
Annemarie griff danach, legte seine Hand einen Moment lang an ihre Wange und küßte sie dann liebevoll.
»Annemie.« Kaum hörbar kam der geliebte Name noch einmal über seine Lippen, dann schlief er wieder ein.
Annemarie schluchzte leise auf. »Franzl.« Dann sah sie mit tränenfeuchten Augen zu Dr. Scheibler auf. »Sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Was ist mit ihm?«
Dr. Scheibler rang mit sich. Er wußte genau, daß es nur eine Frage der Zeit war, bis Annemarie schon allein aufgrund ihrer Ausbildung dahinterkommen würde, was mit ihrem Verlobten tatsächlich los war.
»Ich kann es Ihnen nicht sagen«, antwortete er ehrlich. »Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.«
»Aber es ist ernst«, vermutete Annemarie.
Dr. Scheibler nickte. »Ja.«
Minutenlang forschte sie in seinem Gesicht.
»Mag sein, daß die Untersuchungen wirklich noch nicht abgeschlossen sind«, erklärte sie schließlich. »Trotzdem wissen Sie jetzt schon Bescheid.«
Doch Dr. Scheibler schüttelte den Kopf.
»Ich habe nur einen konkreten Verdacht«, räumte er ein. »Aber den werde ich nicht äußern, bis ich endgültig Gewißheit habe.«
Wieder betrachtete Annemarie den Arzt eine Weile, dann wanderte ihr besorgter Blick zu Franz.
»Ich glaube, er hatte Glück, daß er hierhergekommen ist«, meinte sie, während sie sich Dr. Scheibler wieder zuwandte. »Bianca hatte recht. Sie sind ein guter und vor allem verantwortungsbewußter Arzt.«
*
Annemarie kehrte in die Eingangshalle zurück, wo Dieter schon ungeduldig auf sie wartete. Ihn interessierte im Augenblick nur eines: Würde Franz überleben?
»Seine Verletzungen sind glücklicherweise nur leicht«, erzählte Annemarie. »Aber… ich fürchte, er ist sehr krank.«
»Was soll das heißen?« fragte Dieter zurück und versuchte, nicht zu viel von seinen wahren Gedanken und Hoffnungen preiszugeben, was ihm auch ausgezeichnet gelang.
Annemarie seufzte. »Ich weiß es nicht.« Sie legte eine Hand auf Dieters Schulter. »Fahr nach Hause. Es ist unsinnig, wenn du dir auch noch die Nacht um die Ohren schlägst. Ich rufe dich an, sobald ich etwas Neues erfahre.«
Dieter zögerte, doch als Annemarie ihn erneut drängte zu fahren, gab er nach.
»Bist du sicher, daß du es allein schaffst?« fragte er, und niemand hätte ihm angemerkt, daß er seine Besorgnis nur spielte.
Annemarie nickte. »Ich werde versuchen, so viel Zeit wie möglich bei Franz zu verbringen, und in die Intensivstation würde man dich ohnehin nicht hineinlassen. Geh nur, Dieter. Ich werde mich dann bei dir melden.«
Die ganze restliche Nacht über blieb Annemarie in der Klinik und bekam dadurch natürlich mit, daß Franz aus der Intensivstation in den Operationssaal gefahren wurde. Rasch sprang sie auf und eilte zu Dr. Scheibler.
»Was machen Sie mit ihm?« wollte sie wissen.
Der Oberarzt zögerte und stellte dann zuerst eine Gegenfrage. »Wir haben nichts über eventuelle Verwandte von Herrn Baumgartner herausgefunden. Wissen Sie etwas darüber?«
Annemarie hielt seinem prüfenden Blick problemlos stand. »Er hat niemanden außer mir.« Sie schwieg kurz. »Er wurde unehelich geboren, und seine Mutter starb, als er gerade acht war. Er kam dann zu seinen Großeltern, doch die sind auch schon seit Jahren tot. Franz ist allein – genau wie ich. Wir haben nur uns beide.«
Dr. Scheibler atmete tief durch. »Wenn das so ist…« Wieder zögerte er einen Moment, dann beantwortete er endlich Annemaries erste Frage. »Das Ergebnis der Blutuntersuchung macht eine Knochenmarkbiopsie nötig.«
Annemarie taumelte wie unter einem Schlag. Als Krankenschwester wußte sie genau, was das bedeutete.
»Nein«, flüsterte sie. »Nicht Leukämie.«
Spontan griff Dr. Scheibler nach ihrem Arm, um sie zu stüt-zen, dann begleitete er sie zu der Kunststoffbank zurück, auf der sie vorhin gesessen hatte. Er wußte nicht, wie er sie trösten sollte… vermutlich gab es gar keinen Trost. Die Knochenmarkbiopsie würde nur noch bestätigen, was für Dr. Scheibler eigentlich schon klar war. Franz Baumgartner litt an akuter Leukämie. Es käme einem Wunder gleich, wenn die Biopsie ein anderes Ergebnis bringen würde. Normalerweise wür-de Dr. Scheibler den ohnehin schon geschwächten Patienten gar nicht mehr mit dieser Untersuchung quälen, aber er beabsichtigte, Franz in die Thiersch-Klinik
zu überweisen, und Professor Thiersch bestand grundsätzlich auf der Vollständigkeit der Unterlagen – vor allem, um mögliche Fehldiagnosen zu vermeiden.
»Ich werde für Ihren Verlobten tun, was ich kann«, versprach Dr. Scheibler leise. Es war das einzige, was er Annemarie guten Gewissens zusichern konnte.
Aus brennenden Augen sah sie ihn an. »Hier?«
Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Ich nehme nur die nötigen Untersuchungen vor. Die Behandlung muß in der Thiersch-Klinik durchgeführt werden. Professor Thiersch ist führend, wenn es um Krebserkrankungen geht.«
Hoffnungslos schüttelte Annemarie den Kopf. »Ich kenne die Thiersch-Klinik und weiß, wie gut sie ist, aber… die Wartelisten sind endlos lang.«
»Das ist richtig«, stimmte Dr. Scheibler zu, dann brachte er ein kaum sichtbares Lächeln zustande. »Ich habe beste Beziehungen zur Thiersch-Klinik, weil ich früher als Stationsarzt dort gearbeitet habe. Aber auch wenn das nicht so wäre… einen dringenden Fall würde Professor Thiersch niemals abweisen – mögen die Wartelisten auch noch so lang sein.«
»Hoffentlich«, flüsterte Annemarie, dann griff sie nach Dr. Scheiblers Hand und drückte sie, während in ihrem Gesicht offene Verzweiflung stand. »Franz darf nicht sterben. Ich habe doch nur ihn.«
Der Oberarzt fühlte grenzenloses Mitleid, und am liebsten hätte er ihr versprochen, daß Professor Thiersch ihren Verlobten retten würde, doch als verantwortungsbewußter Arzt durfte er das nicht tun. Er durfte ihr keine Hoffnungen machen, die sich wahrscheinlich nicht erfüllen würden.
*
Franz Baumgartner war wach, als Dr. Scheibler den Operationssaal betrat.
»Was haben Sie mit mir vor?« fragte er, und seine Stimme bebte ein wenig. Instinktiv fühlte er, daß sein andauernder schlechter Zustand einen ernsten Grund haben mußte.
»Ich muß eine Knochenmarkbiopsie vornehmen«, antwortete Dr. Scheibler. »Wissen Sie, was das ist?«
Franz schüttelte den Kopf.
»Sie bekommen von Dr. Parker eine Vollnarkose«, erklärte der Oberarzt. »Dann werde ich mit einer speziellen Spritze aus ihrem Brustbein ein bißchen Knochenmark ansaugen, das ich anschlie-ßend im Labor untersuchen muß.«
Franz schluckte schwer. »Was… was ist mit mir?«
»Das wird die Untersuchung ergeben«, wich Dr. Scheibler aus. Das dringend nötige Gespräch mit seinem Patienten wollte er nicht unbedingt im Operationssaal führen.
Der Anästhesist Dr. Jeffrey Parker, den der Oberarzt für diese Untersuchung mitten in der Nacht aus dem Bett gescheucht hatte, leitete jetzt die Narkose ein, dann sah er Dr. Scheibler an.
»Auf Dauer werden Sie um die Wahrheit doch nicht herumkommen«, meinte er.
»Das weiß ich, Jeff«, erwiderte Dr. Scheibler ernst. »Aber es muß ja nicht hier sein. Ich finde, er hat ein Recht darauf, die schreckliche Nachricht wenigstens in einer annehmbaren Atmosphäre zu erfahren.«
»Sie denken dabei an das, was Sie selbst durchlitten haben«, vermutete Dr. Parker.
Erstaunt sah der Oberarzt ihn an. »Woher wissen Sie das? Als ich Leukämie hatte, waren Sie doch noch gar nicht an der Klinik.«
»Man hört so dies und das«, entgegnete der junge Anästhesist.
Sinnend blickte Dr. Scheibler durch ihn hindurch.
»Diese Krankheit und die Liebe zu meiner Frau haben das aus mir gemacht, was ich heute bin«, erzählte er, und Dr. Parker hatte das Gefühl, als würde der Oberarzt dabei zu sich selbst sprechen. »Ich war karrieresüchtig und immer oberflächlich in meinen Gefühlen… ein Casanova, der hinter jedem Rock her war – bis ich Steffi kennenlernte und an Leukämie erkrankte. Da habe ich gemerkt, wie wertvoll das Leben wirklich ist und wie sinnlos das Streben nach Karriere. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, Freunde zu haben… Menschen, auf die man sich blind verlassen kann.« In diesem Moment war es, als würde er aus einem Traum erwachen. Er schüttelte den Kopf. »Meine Güte, was rede ich denn da?«
Er griff nach einer Hohlnadel und führte sie in den Knochen des Brustbeins ein, dann schob er ein Stilett durch die Nadel und bohrte es mit kurzen, drehenden Bewegungen durch die Knochenrinde. Dabei arbeitete er mit einer ruhigen Gelassenheit, der man nicht hätte anmerken können, wie angespannt er war… wie er sich der unsinnigen Hoffnung hingab, die Biopsie könnte ein anderes Ergebnis bringen als das von ihm erwartete. Er entfernte nur das Stilett und saugte das Knochenmark mit Hilfe einer Spritze ab.
»So, das war’s«, murmelte er. »Sie können ihn wieder auf Intensiv bringen, Jeff.«
Dr. Parker nickte, dann hielt er den Oberarzt, der jetzt das OP verlassen wollte, zurück.
»Gerrit, ich bin nicht schlecht im Labor«, erklärte er. »Ich meine… wenn die Belastung für Sie zu groß ist… wenn Sie zu sehr an Ihre eigene Krankheit erinnert werden…«
Dr. Scheibler mußte lächeln. »Danke, Jeff. Ich weiß Ihre Sorge um mich zu schätzen, aber derartige Untersuchungen gehören nun mal zu meinem Beruf. Keine Angst, ich schaffe das schon.«
»Das weiß ich«, entgegnete Dr. Parker schlicht, dann brachte er Franz zur Intensivstation, blieb bei ihm, bis er das erste Mal zu sich kam, und überließ ihn schließlich der Obhut der Nachtschwester. Er wußte, daß er jetzt wieder nach Hause fahren und weiterschlafen könnte, doch statt dessen fand er den Weg zum Labor. Er wollte gerade die Tür öffnen, als Dr. Scheibler heraustrat. Sein ernstes Gesicht beantwortete eigentlich jede Frage.
»Wie sieht’s aus?« wollte Dr. Parker dennoch wissen.
»Böse«, antwortete der Oberarzt. »Akute lymphoblastische Leukämie.« Er schwieg kurz. »Halten Sie sich morgen früh… nein, es ist ja schon heute… also, heute gleich nach Dienstantritt bereit, Jeff. Ich muß zur Sicherung der Diagnose noch eine Lumbalpunktion vornehmen.«
»Der arme Kerl«, urteilte Dr. Parker.
Dr. Scheibler seufzte. »Ich muß das machen. Wenn ich sie ihm erspare, bekomme ich von Professor Thiersch gehörig den Kopf gewaschen, und Herr Baumgartner müßte die Punktion in der
Thiersch-Klinik über sich ergehen lassen.«
Aufmerksam sah der junge Anästhesist ihn an. »Wann werden Sie es ihm sagen?«
»Jetzt«, antwortete Dr. Scheibler. »Die Punktion wird an der grundsätzlichen Diagnose Leukämie nichts ändern.«
»Wenn es nun nicht die lymphoblastische, sondern die myeloblastische ist?« wollte Dr. Parker wissen.
»Dann stehen seine Überle-benschancen noch ein paar Prozent schlechter«, antwortete Dr. Scheibler finster.
»Hat er denn überhaupt eine Chance? Ich meine… sein Allgemeinzustand ist ja schon bedenklich genug.«
Dr. Scheibler nickte. »Das ist richtig, aber in der Thiersch-Klinik hat er eine Chance, weil der Professor die größte Erfahrung auf diesem Gebiet besitzt.« Er nickte Dr. Parker verabschiedend zu. »Seien Sie bitte pünktlich, Jeff. Ich möchte nach der Lumbalpunktion sofort nach München fahren.«
»Sie sind verrückt, Gerrit«, entfuhr es dem Anästhesisten. »Sie hatten Nachtdienst und…« Er schwieg, denn Dr. Scheibler hatte ihm gar nicht mehr zugehört, sondern war einfach gegangen.
Dr. Parker seufzte, dann sah er auf die Uhr. In eineinhalb Stunden würde sein regulärer Dienst beginnen. Es lohnte sich also nicht mehr, nach Hause zu fahren.
»Herr Oberarzt, Sie haben mich mit Erfolg um meinen Schlaf gebracht«, murmelte er, dann legte er sich im Ärztezimmer auf die Untersuchungsliege, doch die Sorge um Franz Baumgartner ließ auch ihn keine Ruhe finden.
*
Als Dr. Scheibler die Intensivstation betrat, saß Annemarie an Franz’ Bett.
»Ich muß mit Ihnen sprechen«, begann der Oberarzt, und sein ernstes Gesicht verriet bereits, daß es kein angenehmes Gespräch werden würde. Er sah, wie Franz die Hand seiner Verlobten fester umklammerte. Die Frage, ob Annemarie hierbleiben durfte, erübrigte sich daher.
»Ich habe keine guten Nachrichten«, gestand Dr. Scheibler, während er auf der anderen Sei-te von Franz’ Bett Platz nahm. »Die Untersuchung hat bestätigt, daß Sie an akuter Leukämie leiden.«
Franz biß sich auf die Lippen, konnte ein schmerzvolles Aufstöhnen aber trotzdem nicht unterdrücken. Aus den Tiefen seiner Erinnerungen kehrte das schreckliche Wort zurück, und nun betraf es ihn selbst.
Er schloß die Augen, seine Lippen zitterten.
»Nein«, flüsterte er heiser. »O Gott, nein…«
Impulsiv griff Dr. Scheibler nach der anderen Hand seines Patienten und hielt sie fest, so wie auch Annemarie eine Hand ihres Verlobten hielt.
»Herr Baumgartner, Leukämie muß heute kein Todesurteil mehr sein«, erklärte er eindringlich. »Ich werde sofort veranlassen, daß Sie in die Thiersch-Klinik verlegt werden. Professor Thiersch ist der absolut Beste auf diesem Gebiet.«
Langsam öffneten sich Franz’ Augen. Er sah Dr. Scheibler an, und der Oberarzt erkannte die schreckliche Hoffnungslosigkeit darin.
»Meine Mutter…«, flüsterte Franz. »Sie starb an Leukämie… ich war damals erst acht Jahre alt, aber… ich erinnere mich noch an ihren Leidensweg, als wäre es erst gestern gewesen… an ihre Schmerzen… ihre Schreie… Herr Doktor, ich habe Angst. Ich will nicht sterben… nicht jetzt schon und nicht so… nicht auf diese grauenhafte Art und Weise…«
Dr. Scheibler wußte genau, wie es jetzt in dem jungen Mann aussah. Er durchlitt Franz’ Leid, als wäre es wieder sein eigenes.
»Professor Thiersch wird alles menschenmögliche für Sie tun«, versicherte er, doch seine Stimme klang etwas heiser. Nur zu gut erinnerte er sich an die Machtlosigkeit des Professors angesichts der aggressiven Form von Leukämie, an der er selbst gelitten hatte. Und doch hatte Professor Thiersch ihm letztlich das Leben gerettet… er und Dr. Metzler, der Chefarzt der Waldsee-Klinik, hatten es getan, indem sie das gefährliche Risiko eingegangen waren, ihn mit einem noch nicht zugelassenen Medikament zu behandeln.
Wieder hatte der Oberarzt Mühe, diese Gedanken abzuschütteln. Plötzlich war alles wieder so gegenwärtig, und es nützte auch überhaupt nichts, wenn er sich einzureden versuchte, daß Franz Baumgartners Leukämie nicht zwangsläufig so aggressiv sein müßte. Es war, wie er vorhin zu ihm gesagt hatte – Leukämie war heutzutage durchaus heilbar. Warum konnte nur er selbst nicht daran glauben?
*
Dr. Robert Daniel, der hiesige Gynäkologe und Direktor der Waldsee-Klinik, lag noch im Bett, als ihn das Klingeln des Telefons unsanft aus dem Schlaf riß.
»Meine Güte, was ist denn jetzt los?« murmelte seine Frau Manon, die neben ihm hochschreckte.
Dr. Daniel tastete in der Dunkelheit nach dem Telefonhörer, dann meldete er sich.
»Parker«, gab sich der Anrufer zu erkennen. »Tut mir leid, wenn ich Sie aus den Federn gescheucht habe, Robert, aber ich glaube, Ihre Anwesenheit in der Klinik wäre jetzt nicht ganz verkehrt.«
Schlagartig war Dr. Daniel hellwach. »Ist etwas passiert, Jeff?«
»Gerrit hatte Nachtdienst«, erzählte Dr. Parker hastig. »Es kam zu einem Verkehrsunfall, der zunächst ganz harmlos aussah, doch dann stellte sich heraus, daß der Patient Leukämie hat. Ich glaube, Gerrit könnte ein bißchen Unterstützung brauchen, und von Ihnen nimmt er sie sicher auch an.«
»Ich bin schon unterwegs«, versprach Dr. Daniel, warf einen kurzen Blick auf die Uhr und stellte fest, daß es erst kurz nach fünf war.
»Ich denke, daß ich bis zur Sprechstunde wieder hier sein werde«, sagte er zu seiner Frau, während er bereits in Hemd und Hose schlüpfte. Duschen mußte im Moment ausfallen; dazu war später sicher noch Zeit. Er küßte Manon flüchtig, dann verließ er das Schlafzimmer und Sekunden später auch seine Villa.
Als er die Klinik erreichte, wurde er dort von Dr. Parker bereits erwartet.
»Was tun Sie eigentlich um diese Zeit schon hier?« wollte Dr. Daniel wissen, als er dem jungen Anästhesisten zur Intensivstation folgte.
»Gerrit hat mich vor gut zwei Stunden wegen der Knochenmarkbiopsie aus dem Bett geworfen«, erzählte Dr. Parker. »Ich habe mich danach für ein paar Minuten auf die Untersuchungsliege im Ärztezimmer gelegt, aber an Schlaf war wirklich nicht mehr zu denken.« Er schwieg kurz. »Der Junge ist vielleicht fünfundzwanzig und hat Leukämie. Ich bin zwar kein Krebsspezialist, aber ich weiß, was diese Diagnose bedeuten kann… was sie sogar mit grausamer Sicherheit bedeuten wird. Der Allgemeinzustand des Patienten ist verheerend, und Gerrit weiß das. Deshalb hat er es ja mit den Untersuchungen so eilig, aber ich fürchte, daß er sich selbst damit auch noch schadet. Sie wissen besser als ich, was er während seiner Krankheit durchgemacht hat. Die seelische Belastung, die jetzt zu der Sorge um seinen Patienten noch dazukommt, ist nicht zu unterschätzen.«
Dr. Daniel nickte. »Ich werde mich darum kümmern.« Er legte Dr. Parker sekundenlang eine Hand auf die Schulter. »Es war gut, daß Sie mich angerufen haben.«
Dann betrat er eiligst die Intensivstation, während der junge Anästhesist zurückblieb. Wieder sah er auf die Uhr. Eine knappe Stunde würde er sich noch ausruhen können, ehe er sich für die anstehende Lumbalpunktion bereit machen mußte.
*
Auf der Intensivstation herrschte eisiges Schweigen. Dr. Scheibler fühlte sich ausgelaugt und am Ende seiner Kraft. Er war nicht mehr imstande, den beiden jungen Menschen Trost zu spenden, ganz abgesehen davon, daß es in einer solchen Situation ohnehin keinen Trost gab.
Franz steckte in seinen Erinnerungen fest, die das Bild seiner leidenden Mutter heraufbeschworen. Er konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß sein Leben auch so enden würde – geprägt von Leid und Schmerz. Seine Mutter war zu jener Zeit nur drei Jahre älter gewesen, als er es jetzt war. Achtundzwanzig… in der Blüte ihres Lebens… sie hatte gekämpft wie eine Löwin, doch der Tod war stärker gewesen… er hatte sie mit unerträglichen Schmerzen bezwungen.
Unwillkürlich schluchzte Franz auf. Annemarie, die noch immer seine Hand hielt, zuckte erschrocken zusammen. Seit Dr. Scheibler die schreckliche Diagnose ausgesprochen hatte,
herrschte in ihrem Kopf nur noch Leere. Sie konnte nichts denken und nichts fühlen… nicht einmal Tränen brachte sie heraus. Da war nur ein dumpfer, pochender Schmerz, der von ihrem Herzen aus immer höher stieg, bis er ihren Kopf erreichte. Es war wie eine Explosion. Annemarie bäumte sich auf, ihre Hände fuhren an die Schläfen, dann sackte sie bewußtlos zu Boden.
Erschrocken sprang Dr. Scheib-ler auf, und genau in diesem Moment trat auch Dr. Daniel herein. Er stellte keine einzige Frage, sondern kniete sofort neben der ohnmächtigen jungen Frau nieder, tastete nach ihrem Puls und hob sie schließlich hoch.
Inzwischen hatte Dr. Scheibler schon eine fahrbare Trage gebracht, auf die Dr. Daniel die junge Patientin legte.
»Was ist mit Annemie?« fragte Franz, und seine besorgte Stimme überschlug sich beinahe.
»Keine Sorge, Herr Baumgartner, wir kümmern uns um sie«, versprach Dr. Scheibler, doch als er mit Dr. Daniel hinausgehen wollte, hielt dieser ihn zurück. »Bleiben Sie bei Ihrem Patienten, Gerrit. Ich glaube, gerade jetzt sollte er nicht allein sein.«
Dann schob er die fahrbare Trage in den nächsten Untersuchungsraum, doch während er noch Blutdruck und Reflexe kontrollierte, kam Annemarie schon wieder zu sich. Hastig wollte sie sich aufrichten, doch Dr. Daniel hielt sie fest.
»Bleiben Sie noch liegen«, bat er. »Ihr Kreislauf hat den Belastungen nicht mehr standgehalten.«
Annemaries Hände zitterten, ihr ganzer Körper begann wie im Schüttelfrost zu beben. Fürsorglich breitete Dr. Daniel eine Decke über sie, dann nahm er ihre Hände und hielt sie fest. Die Sicherheit, die diese Berührung vermittelte, ließ Annemarie spürbar ruhiger werden.
»Wer sind Sie?« wollte sie schließlich wissen.
»Robert Daniel«, stellte er sich vor. »Ich bin…« Er unterbrach sich, weil Annemarie in einer Art und Weise nickte, als wüßte sie bereits genau, wen sie vor sich hatte.
»Ich wohne erst seit ein paar Wochen drüben in Geising«, erklärte sie. »Aber während dieser Zeit habe ich nur Gutes über Sie gehört.«
Dr. Daniel lächelte. »Das freut mich.« Dann wurde er wieder ernst. »Hatten Sie derartige Zusammenbrüche schon öfter?« Er schwieg kurz. »Wissen Sie, es ist natürlich möglich, daß Sie aufgrund der schlimmen Nachricht, die Dr. Scheibler Ihnen und Ihrem Verlobten mitteilen mußte, überreagiert haben, aber falls Sie häufiger derartige Kreislaufprobleme haben, sollte man der Sache auf den Grund gehen.«
Mit einem Schlag war alles wieder da, was Annemarie für Minuten verdrängt hatte.
»Franz hat Leukämie«, flüsterte sie, und dann brach auf einmal ein nicht versiegen wollender Tränenstrom aus ihr heraus. Annemarie hatte das Gefühl, als würde sie von den vielen Tränen weggespült.
Väterlich nahm Dr. Daniel die junge Frau in die Arme und ließ sie sich ausweinen.
»Wenn Franzl stirbt«, schluchzte sie. »Was bin ich denn ohne ihn? Ich liebe ihn… brauche ihn…«
»Leukämie muß heutzutage kein Todesurteil mehr sein«, entgegnete Dr. Daniel in beruhigendem Ton. »Dr. Scheibler und ich werden veranlassen, daß Ihr Verlobter noch heute in die Thiersch-Klinik kommt. Der Professor ist der Beste auf seinem Gebiet.«
Annemarie nickte an Dr. Daniels Schulter, dann löste sie sich von ihm.
»Es tut mir leid«, murmelte sie verlegen. »Ich hätte mich nicht so gehenlassen dürfen.«
»Warum denn nicht?« fragte Dr. Daniel zurück. »Es war doch eine ganz natürliche Reaktion.« Prüfend sah er Annemarie an. »Sie haben meine Frage von vorhin aber noch nicht beantwortet.«
Die junge Frau seufzte tief auf. »Seit ein paar Wochen habe ich öfter Kreislaufprobleme, aber meine ganze Situation ist im Moment auch sehr unerfreulich. Ich bin seit über einem halben Jahr arbeitslos. Vor ein paar Wochen bin ich von München nach Geising gezogen, weil ich hoffte, außerhalb der Stadt eher eine Stellung zu finden, aber…« Sie zuckte hilflos die Schultern. »Wenigstens sind die Mieten hier etwas niedriger.«
»Was sind Sie denn von Beruf?« wollte Dr. Daniel wissen.
»Krankenschwester«, antwortete Annemarie, dann seufzte sie wieder. »Ich hätte es so machen sollen wie Bianca. Sie hat den Absprung aus München noch rechtzeitig geschafft.«
»Sie kennen unsere Schwester Bianca?« fragte Dr. Daniel, dann schüttelte er den Kopf. »In diesem Fall wundert es mich, daß Sie bei Ihrer Suche nach einer Stellung den Weg zur Waldsee-Klinik nicht gefunden haben. Vom Kreiskrankenhaus abgesehen, wäre sie doch von Geising aus die nächstliegende Klinik.«
Annemarie nickte. »Das weiß ich, aber… Bianca hat mehrfach erwähnt, daß hier lauter gute Schwestern arbeiten und keine von ihnen beabsichtigt, in nächster Zeit zu kündigen.«
»Ihr Gedankengang war vielleicht nicht ganz richtig«, erwiderte Dr. Daniel. »Es stimmt zwar, daß wir durchweg über gu-tes Personal verfügen, und das Arbeitsklima ist wirklich so gut, daß vermutlich niemand freiwillig gehen würde. Andererseits hat die Waldsee-Klinik gerade in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen. In unseren beiden Bereichen Chirurgie und Gynäkologie betreuen wir derzeit mehr Patienten, als es in den vergleichbaren Abteilungen des Krankenhauses der Fall ist.«
Unwillkürlich hielt Annemarie den Atem an.
»Wollen Sie damit sagen… Sie wären… interessiert?« fragte sie, und man merkte ihr die Anspannung deutlich an.
Dr. Daniel nickte. »Eine gute Krankenschwester wäre uns herzlich willkommen, allerdings müssen wir das nicht hier und jetzt erörtern.« Er lächelte. »Obwohl ich Direktor dieser Klinik bin, nehme ich Einstellungen grundsätzlich nicht ohne das Einverständnis des Chefarztes vor. Ich würde also vorschlagen, daß wir uns zu gegebener Zeit zu dritt darüber unterhalten sollten. Das muß nicht heute oder morgen sein. Lassen Sie sich noch etwas Zeit.« Dabei wurde er wieder ernst. »Sie sollten Ihre Kreislaufprobleme nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mag sein, daß Ihre schwierige momentane Situation das Problem verstärkt, trotzdem sollten Sie sich bei nächster Gelegenheit einmal untersuchen lassen.«
Annemarie nickte. »Das werde ich bestimmt tun, Herr Direktor.« Sie zögerte. »Kann ich da zu Ihnen kommen? Sie sind zwar Gynäkologe, aber… ich kenne hier noch keine Ärzte, und zu Ihnen hätte ich Vertrauen.«
»Selbstverständlich werde ich diese Untersuchung gern vornehmen«, stimmte Dr. Daniel zu, während er Annemarie half, von der fahrbaren Trage herunterzusteigen, auf der sie noch immer lag. »Sie können sich aber auch hier in der Klinik im Rahmen der Einstellungsformalitäten vom Chefarzt untersuchen lassen oder von meiner Frau, die ihre Allgemeinpraxis mit meiner gynäkologischen zusammengelegt hat.«
Annemarie stand jetzt neben der fahrbaren Trage, doch als Dr. Daniel sie losließ, fühlte sie erneut einen leichten Schwindel, der sie taumeln ließ. Mit einer Hand hielt sie sich fest, dann war das Gefühl der Benommenheit wieder vorbei.
»Sie scheinen bei meiner Einstellung hier keine Probleme zu sehen«, stellte sie fest. »Dennoch denke ich, daß ich nicht so lange warten sollte. Ich werde zu Ihnen in die Praxis kommen, sobald ich weiß, wie es um Franz steht.«
Dr. Daniel nickte. »Tun Sie das.« Er begleitete Annemarie in die Intensivstation hinüber.
Franz war noch wach und richtete sich bei ihrem Eintreten sofort ein wenig auf.
»Annemie.« Seine Stimme klang besorgt.
Rasch eilte sie zu ihm und legte ihre Hände um sein Gesicht.
»Mit mir ist alles in Ordnung, Liebling«, versicherte sie. »Nur der Kreislauf hat nicht mehr ganz mitgespielt.« Sie küßte ihn zärtlich. »Ich liebe dich, Franzl.«
»Ich liebe dich auch«, flüsterte er heiser.
Dr. Scheibler, der sich diskret im Hintergrund gehalten hatte, wartete das Ende der innigen Umarmung ab, ehe er zu Annemarie trat und sie behutsam am Arm berührte.
»Ich muß Sie leider bitten, für einen Moment hinauszugehen«, erklärte er, dann nahm er die junge Frau beiseite, ehe er fortfuhr: »Ich muß noch eine wichtige Untersuchung durchführen. Normalerweise hätte ich jetzt dazu Gelegenheit gehabt, doch Herr Baumgartner war einfach zu unruhig. Er machte sich große Sorgen um Sie, ließ mich aber nicht gehen, um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Er hat es nicht direkt gesagt, aber seine Angst vor dem Alleinsein klang allzu deutlich durch.«
Annemaries Augen brannten. Sie fühlte schon wieder, wie nahe sie den Tränen war. Mit überraschender Kraft griff sie nach Dr. Scheiblers Hand.
»Helfen Sie ihm«, flehte sie ihn an. »Bitte, helfen Sie ihm.«
Dr. Scheibler nickte. »Ich werde tun, was ich kann.« Dabei fühlte er sich nach den körperlichen, vor allem aber auch psychischen Anstrengungen der vergangenen Nacht ebenfalls am Ende seiner Kräfte.
Das bemerkten Dr. Parker, der sich für die anstehende Lokal-anästhesie bereitmachte, und Dr. Daniel sofort. Letzterer trat zu dem Oberarzt und nötigte ihn mehr oder weniger dazu, mit ihm auf den Flur hinauszugehen.
»Sie gehören nach Hause und ins Bett«, erklärte Dr. Daniel
energisch. »Seit fast zwei Stunden ist Ihr Dienst bereits beendet.«
Doch Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Ich muß die Lumbalpunktion noch vornehmen, und zu mir hat der Patient Vertrauen gefaßt. Ich kann mich jetzt nicht plötzlich vom Chefarzt ablösen lassen, auch wenn Wolfgang darin mindestens ebensoviel Erfahrung hat wie ich.«
Dr. Daniel nickte. »Das sehe ich ein, aber nach dieser Punktion ist für Sie endgültig Zapfenstreich.«
Wieder schüttelte der Oberarzt den Kopf. »Ich muß mit Professor Thiersch sprechen und…«
»Nein«, fiel Dr. Daniel ihm mit Bestimmtheit ins Wort. »Den Professor überlassen Sie mir. Ich muß heute ohnehin nach München, weil meine Tochter ihre Assistentenstelle in der Thiersch-Klinik antritt und ich ihr versprochen habe, sie zu begleiten. Also kann ich die Unterlagen über Herrn Baumgartner mitnehmen und mit dem Professor diesen Fall besprechen.«
»Aber ich muß…«
»Sie müssen in erster Linie ins Bett.« Zum zweiten Mal fiel Dr. Daniel dem jungen Oberarzt ins Wort. »Zumindest für ein paar Stunden. Während dieser Zeit werde ich mit Professor Thiersch alles klären, und am frühen Nachmittag können Sie Ihren Patienten dann in die Thiersch-Klinik begleiten.«
Dr. Scheibler kapitulierte – weniger aus Überzeugung, sondern weil er einfach zu müde und zu ausgelaugt war, um diese Diskussion weiter fortzusetzen. Im übrigen war Dr. Daniels Argumentation ja auch schwerlich beizukommen.
»In Ordnung, Robert, Sie haben gewonnen«, murmelte er, dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging in die Intensivstation zurück.
»Wir können anfangen, Jeff«, wandte er sich Dr. Parker zu, dann beugte er sich zu Franz hinunter. »Ich habe Ihnen vorhin ja schon erklärt, worum es geht. Drehen Sie sich bitte auf die linke Seite.«
Franz gehorchte. Er spürte, wie Dr. Scheibler das Klinikhemd zur Seite schob und dann zwei Finger auf eine Stelle an seiner Lendenwirbelsäule legte.
»In diesen Bereich etwa muß ich einstechen und etwas Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit entnehmen«, erklärte er. »Wichtig ist dabei, daß Sie ganz ruhig liegen. Dr. Parker wird die Stelle örtlich betäuben, so daß Sie von der eigentlichen Flüssigkeitsentnahme nichts spüren werden. Nur den Einstich, den Dr. Parker für die Lokalanästhesie vornehmen muß, werden Sie spüren, und er wird weh tun.«
Franz schluckte. »Sie sind erschreckend ehrlich.«
Dr. Scheibler suchte seinen Blick. »Ich will, daß Sie mir gut vertrauen, und dazu gehört nun einmal Ehrlichkeit. Wenn ich Sie belüge, können Sie ja kein Vertrauen zu mir haben.« Er richtete sich auf, legte eine Hand an Franz’ Hinterkopf und übte leichten Druck aus.
»Pressen Sie das Kinn, so fest es geht, an die Brust«, bat er. »Und ziehen Sie die Knie an. Ihr Rücken muß ganz rund sein.«
Franz gehorchte, obwohl er gerade in dieser Stellung den Katheder und den Temperaturfühler als schrecklich störend empfand. Auch die Infusionsschläuche, über die er noch immer Blut und Kochsalzlösung zugeführt bekam, waren ihm überall im Weg. Das alles machte ihm erst so richtig bewußt, wie elend er eigentlich dran war. Er spürte Dr. Scheiblers Hände, die seinen Kopf nach unten und seine Knie gegen den Bauch drückten. Seine Hände begannen zu zittern, während er auf den schmerzhaften Einstich wartete, den Dr. Scheibler ihm prophezeit hatte.
Dr. Parker hatte in der Zwischenzeit die Spritze mit dem Lokalanästhetikum vorbereitet und trat nun zu dem Patienten. Die örtliche Betäubung an der Wirbelsäule verlangte von dem Anästhesisten große Erfahrung, aber über die verfügte Dr. Parker ja, und sein Gesicht spiegelte die Konzentration wider, mit der er zu Werke ging. Mit einem Alkolholtupfer reinigte er die Einstichstelle und spürte dabei, wie Franz zusammenzuckte.
Dr. Parker warf dem Oberarzt einen Blick zu, mit dem er signalisierte, daß sich der Patient jetzt völlig ruhig halten mußte. In diesem Moment gab Dr. Scheibler ihm ein Zeichen, daß er warten solle. Der Oberarzt hatte nämlich bemerkt, wie Franz’ Schultern zu zucken begannen, und als er ihn jetzt losließ, fing sein ganzer Körper vor verhaltenem Schluchzen an zu beben.
»Weinen Sie nur, Franz«, riet Dr. Scheibler ihm und gebrauchte dabei absichtlich den Vornamen seines Patienten, um ihm etwas Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Ganz sanft berührte er Franz’ Schulter, während er mit der anderen Hand die Decke hochzog, um dem jungen Mann die Peinlichkeit seiner untersuchungsbedingten Blöße zu ersparen, deren er sich gerade in dieser Situation besonders bewußt sein mußte. »Weinen Sie sich aus. Das erleichtert.«
Mit beiden Händen bedeckte Franz sein Gesicht, während er hilflos zu schluchzen begann. Er schämte sich ganz entsetzlich vor den beiden Ärzten, schaffte es aber nicht, seinen Tränen Einhalt zu gebieten.
Dr. Parker und Dr. Scheibler tauschten einen Blick, dann ging der junge Anästhesist hinaus, während sich der Oberarzt zu seinem Patienten hinunterbeugte.
»So ist es gut, Franz«, meinte er. »Weinen Sie nur. Wir lassen Sie jetzt ein bißchen allein, damit Sie ungestört sind.«
»Nein!« Mit tränenüberströmtem Gesicht blickte Franz auf, dann griff er mit beiden Händen nach Dr. Scheiblers Arm. »Nicht alleinlassen. Bitte nicht.« Sein Körper wurde von Schluchzen geschüttelt. »Herr Doktor, ich habe Angst! Vor dieser Untersuchung… vor den Schmerzen… vor dem Tod! Ich habe solche Angst! Ich will noch nicht sterben!«
Spontan setzte sich Dr. Scheibler zu ihm aufs Bett und nahm ihn wie ein kleines Kind in die Arme.
»Es muß noch nicht zu spät sein, mein Junge.« Die Stimme des Oberarztes klang sanft und tröstend. »Professor Thiersch wird alles menschenmögliche für Sie tun.«
Doch Franz schüttelte den Kopf. »Ich will nicht weg von Ihnen. Ich will, daß Sie mich behandeln. Zu Ihnen habe ich Vertrauen.«
Da legte Dr. Scheibler ihm eine Hand unter das Kinn und zwang ihn damit, ihn anzusehen. Dabei krampfte sich das Herz des Arztes vor Mitleid zusammen, als er in die verweinten Augen seines jungen Patienten blickte.
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Franz«, erklärte er eindringlich. »Mir fehlt einfach die Erfahrung des Professors. Aber ich verspreche Ihnen, daß ich mich um Sie kümmern werde, auch wenn Sie in der Thiersch-Klinik liegen.«
Wieder schüttelte Franz den Kopf. »Sie werden mich schon morgen vergessen haben. Ich bin doch hier nur einer von vielen Patienten, die Sie zu untersuchen und behandeln haben.«
»Glauben Sie das wirklich?«
Franz zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht.«
Dr. Scheibler schwieg einen Moment, dann meinte er: »Ich habe gesagt, daß ich mir Ihr Vertrauen durch Ehrlichkeit verdienen will, also werde ich auch weiterhin ehrlich zu Ihnen sein. Natürlich erinnere ich mich nicht mehr an jeden Patienten, der hier durch meine Hände gegangen ist. Das wäre bei der Vielzahl der Kranken, die ich schon behandelt habe, auch unmöglich. Aber einen Patienten, um den ich mir so viele Sorgen mache… mit dem ich leide und um den ich Angst habe… den vergesse ich nicht.«
Die Kehle wurde Franz eng bei diesen Worten, und er fühlte schon wieder Tränen aufsteigen.
»Lassen Sie es heraus«, meinte Dr. Scheibler, der genau wußte, was in Franz vorging. »Weinen Sie sich aus.«
»Annemie«, stieß Franz hervor. »Sie wird Angst haben… weil es so lange dauert…«
Doch Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Dr. Parker hat ihr bereits Bescheid gesagt.«
»Sie haben doch gar nicht mit ihm gesprochen«, wandte Franz ein.
Da lächelte der Oberarzt ein wenig. »Mit einigen meiner Kollegen kann ich mich auch durch Blicke verständigen. Seien Sie unbesorgt, Franz, Ihre Annemie weiß wirklich Bescheid.«
Dankbarkeit lag in den Augen des jungen Mannes, dann wischte er mit einer energischen Handbewegung die Tränen ab.
»Sie können die Untersuchung jetzt machen, Herr Doktor.«
»Gerrit«, verbesserte der Oberarzt. »Ich glaube, wir beide sind an einem Punkt angelangt, wo man sich Förmlichkeiten sparen kann.« Aufmerksam betrachtete er seinen Patienten. »Sind Sie wirklich bereit, Franz?«
Der nickte tapfer. »Ja, Gerrit.« Der Vorname des Arztes kam ihm zwar noch ein bißchen schwer über die Lippen, trotzdem fühlte er sich plötzlich sicherer.
Dr. Scheibler holte den Anästhesisten zurück, und in der Zwischenzeit hatte sich Franz schon wieder auf die Seite gelegt, das Kinn auf die Brust gedrückt und die Knie angezogen. Wie vorhin griff der Oberarzt unterstützend zu, während Dr. Parker erneut das Lokalanästhetikum vorbereitete und die Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer säuberte.
»Nicht erschrecken, Herr Baumgarnter«, betonte er. »Ich muß Sie jetzt stechen.«
Franz fühlte die Nadel schmerzhaft in seinen Rücken dringen und stöhnte leise auf.
»Das war’s schon«, meinte Dr. Parker beruhigend, stand auf und übernahm Dr. Scheiblers Platz. Der Oberarzt wartete noch, bis die örtliche Betäubung wirkte, dann führte er vorsichtig eine Hohlnadel in der Mitte zwischen den Dornfortsätzen des ersten und zweiten Lendenwirbels ein und schob sie schrittweise so weit vor, bis bei Überprüfung helle, bernsteingelbe Flüssigkeit abtropfte.
Dr. Scheibler entnahm soviel Flüssigkeit, wie er für die Untersuchung benötigte, dann zog er die Nadel vorsichtig zurück und legte einen sterilen Verband an.
»Sie haben’s überstanden, Franz«, erklärte er. »Wie fühlen Sie sich?«
»Ich habe Kopfschmerzen«, antwortete der junge Mann. »Aber das kommt wahrscheinlich von meiner Angst und der Aufregung von vorhin.«
Dr. Scheibler schüttelte den Kopf. »Nein, das ist eine ganz normale Reaktion auf die Punktion. Die Kopfschmerzen werden bald wieder vergehen.« Er lächelte Franz an. »Ich schicke Ihre Verlobte jetzt wieder herein.« Er schwieg einen Moment, dann fuhr er fort: »Wenn ich im Labor fertig bin, muß ich ein paar Stunden schlafen, aber Sie können sicher sein, daß ich Sie persönlich nach München begleiten werde.«
Dankbar griff Franz nach seiner Hand. »Ich… ich weiß nicht, was ich sagen soll, Gerrit… ich… danke.«
»Schon gut«, erwiderte der Oberarzt leise und wünschte dabei, er könnte mehr für ihn tun… viel mehr.
*
Unruhig hatte Annemarie in der Eingangshalle gewartet. Der junge Anästhesist hatte ihr gesagt, daß es länger dauern würde als geplant, weil Franz mit seiner Beherrschung am Ende sei. Am liebsten wäre Annemarie sofort zu ihm geeilt, doch Dr. Parker hatte ihr versichert, daß sich der Oberarzt ganz rührend um ihn kümmern würde.
Annemarie war nicht vollends beruhigt gewesen, wollte sich andererseits aber auch nicht einmischen. Vielleicht würde sich Franz vor ihr zu sehr genieren, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Nervös war sie in der Eingangshalle auf und ab gegangen, bis sie die Telefonzelle entdeckt hatte.
Es war inzwischen beinahe neun Uhr morgens. Annemarie zögerte einen Moment, dann betrat sie die Telefonzelle, hob den Hörer ab und steckte ihre Karte in den Schlitz, bevor sie Dieters Nummer wählte.
Wie erwartet war Dieter um diese Zeit noch zu Hause, und Annemarie fragte sich wieder einmal, woher er eigentlich das viele Geld hatte, mit dem er so bedenkenlos um sich werfen konnte. Angeblich hatte er vor ein paar Jahren eine große Erbschaft gemacht, doch bei den Unsummen, die er Tag für Tag ausgab, konnte davon eigentlich nicht mehr viel übrig sein.
»Dieter, hier ist Annemarie«, gab sie sich zu erkennen und hatte plötzlich wieder Mühe, die Tränen zurückzuhalten. »Tut mir leid, daß ich erst jetzt anrufe, aber…« Sie schluchzte auf. »Franz… er… er… hat… Leukämie!«
»Meine Güte.« Dieter spielte den Betroffenen, dabei hätte er sich am liebsten vor Freude die Hände gerieben. Nach der Enttäuschung darüber, daß Franz noch rechtzeitig im Auto gefunden worden war, standen seine Chancen nun doch nicht so schlecht. Er würde zwar noch ein bißchen warten müssen, bis Franz das Zeitliche gesegnet hatte, aber dann…
»Ich komme sofort, Annemarie«, versprach er jetzt. »Mach dir keine Sorgen, ich werde meine ganzen Beziehungen spielen lassen, damit Franz die beste Behandlung bekommt, die…«
»Nicht nötig, Dieter«, fiel Annemarie ihm ins Wort. »Es ist lieb von dir, aber… Franz bekommt noch heute einen Platz in der Thiersch-Klinik. Der Professor ist der Beste auf seinem Gebiet.«
Dieter biß vor Ärger die Zähne zusammen. Natürlich kannte auch er den erstklassigen Ruf des Professors, deshalb hätte er es vorgezogen, Franz in einem anderen Krankenhaus zu wissen… dort, wo man nach Möglichkeit noch nicht über die neuesten Behandlungsmethoden informiert war.
»Das ist gut«, zwang er sich zu sagen. »Trotzdem komme ich sofort in die Waldsee-Klinik – wenn auch nur, um dir beizustehen.«
»Danke, Dieter.« Annemaries Worte kamen von Herzen. Sie war froh, daß sie und Franz in Dieter einen so ehrlichen Freund hatten. Wie hätte sie auch ahnen können, daß sich in Dieter mit den Jahren immer mehr Haß auf Franz aufgestaut hatte? Schon in der Schule hatte Franz immer die besseren Zeugnisse gehabt, er hatte seinen Abschluß mit Auszeichnung bestanden, und nicht einmal der Tod seiner Mutter und später der geliebten Großeltern hatte ihn aus der Bahn werfen können. Franz war ein durch und durch gefestigter Charakter, während sich Dieter von seinen Launen und seiner Labilität hatte leiten lassen. Von zwei Privatschulen war er verwiesen worden, hatte drei Lehrstellen nach jeweils wenigen Monaten sausen lassen und schließlich in einem zwielichtigen Club zu arbeiten begonnen – eine Tatsache, von der niemand etwas wußte. Offiziell gab er sich als selbständig aus und handelte, wie er erzählte, mit Computern, dabei hatte er ein solches Gerät höchstens mal im Geschäft gesehen. Franz dagegen hatte eine Stellung, in der er ganz ordentlich verdiente, während Dieter schon längst weit über seine Verhältnisse lebte und beinahe in dem Schuldenberg erstickte, der sich mittlerweile angesammelt hatte. Vor allen Dingen aber hatte Franz die schöne Annemarie, die in neun Jahren über ein immenses Vermögen verfügen würde, und nicht zuletzt aus diesem Grund wünschte Dieter seinem Freund alles erdenklich Schlechte.
»Leukämie«, murmelte er jetzt, als er den Hörer aufgelegt hatte, dann lehnte er sich mit einem bösartigen Lächeln in seinem Sessel zurück. »Ich denke, deine Tage sind gezählt, alter Junge.« Er runzelte die Stirn, als er an die Thiersch-Klinik dachte. Das war der einzig wunde Punkt an der Sache. Thiersch hatte einfach zu viele Heilerfolge. Er war die Kapazität schlechthin, wenn es um Krebserkrankungen ging. Doch schließlich siegte Dieters Optimismus. Er würde Franz schon soweit bekommen, daß er die Thiersch-Klinik vorzeitig verlassen würde. »Dann, mein treuer Freund, gehört deine Annemarie endgültig mir.«
*
Dr. Daniel hatte dafür gesorgt, daß Dr. Scheibler sein Versprechen hielt und sich wirklich ins Bett legte, dann hatte er die Unterlagen über Franz Baumgartner an sich genommen und war zu seiner Villa zurückgekehrt. Seine Empfangsdame Gabi Meindl hatte für diesen Tag nur einige wichtige Termine angenommen, weil sie gewußt hatte, daß ihr Chef noch am Vormittag seine Tochter nach München bringen würde.
Karina Daniel hatte ihr Examen bestanden und würde
nun das Angebot, das Professor Thiersch ihr bereits vor einigen Jahren gemacht hatte, annehmen und an seiner Klinik die Assistenzzeit absolvieren.
»Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einläßt«, meinte Dr. Daniel, als er mit seiner Tochter losfuhr. »Professor Thiersch ist grob, unfreundlich und mehr als streng.«
Karina lächelte. »Er verbirgt unter seiner extrem rauhen Schale aber auch ein sehr weiches Herz. Das hast du selbst oft genug gesagt, und ich habe es ganz deutlich gemerkt, als Manon damals so krank war und er nicht mehr wußte, wie er ihr noch helfen sollte. Im übrigen hast du deine Assistenzzeit in der Thiersch-Klinik ja auch überlebt.«
»Das ist richtig«, stimmte Dr. Daniel zu. »Aber der gute Professor hat mir die zwei Jahre gelegentlich schon zur Hölle gemacht.« Er sah seine Tochter kurz an, bevor er sich wieder auf den Verkehr konzentrierte. »Du wirst eine weit härtere Assistenzzeit haben als dein Bruder.«
»Glaubst du?« Karina schüttelte den Kopf. »Wolfgang ist zwar nicht grob und unfreundlich, aber genauso streng wie der Professor. Stefan hat gelegentlich ganz schön gejammert, weil Wolfgang ihn so hart gehalten hat.« Sie grinste. »Seit Stefan bei Onkel Schorsch seinen Facharzt macht, fühlt er sich fast wie im siebten Himmel.«
Dr. Daniel mußte lachen. »Das glaube ich gern. Stefan müßte es schon ganz bunt treiben, damit Schorsch seinem geliebten Patensohn mal die Leviten lesen würde.«
Langsam fuhr Dr. Daniel nun in den Parkplatz, der zur Thiersch-Klinik gehörte, und hielt seinen Wagen an. Karina stieg aus und blieb einen Augenblick lang vor dem wuchtigen Bau stehen.
»Du wirst es nicht glauben, Papa, aber ich freue mich sogar auf die Zeit, die ich hier verbringen werde«, meinte sie.
»Du wirst jedenfalls viel lernen«, erklärte Dr. Daniel, dann betrat er zusammen mit seiner Tochter die Klinik und steuerte das Büro des Chefarztes an.
Dabei wurde Karina bewußt, wie sehr sich die Thiersch-Klinik von der Waldsee-Klinik unterschied – und das nicht nur an Größe. Die Flure der Waldsee-Klinik waren hell und freundlich, hier dagegen wirkte alles sehr düster… fast furchteinflößend.
»Daniel! Was wollen Sie denn hier?«
Unwillkürlich zuckte Karina zusammen, als die wie immer äußerst barsche Stimme des Professors erklang. Sie hatte den kleinen, untersetzten Mann gar nicht kommen sehen. Dr. Daniel selbst schien dagegen nicht überrascht zu sein, als Professor Thiersch wie aus dem Boden gewachsen plötzlich vor ihm stand.
»Ich habe meine Tochter herbegleitet«, antwortete Dr. Daniel jetzt.
Die buschigen Augenbrauen schoben sich über dem Rand der dicken Hornbrille zusammen und verliehen dem Professor ein noch strengeres Aussehen. Karina hatte er bis jetzt keines Blickes gewürdigt, aber das war auch nicht weiter ungewöhnlich.
»Glauben Sie vielleicht, ich würde Ihr Herzblatt umbringen, wenn es sich allein hier hereinwagen würde?« herrschte er Dr. Daniel an.
»Nein«, entgegnete dieser gelassen. Der ruppige Ton des Professors konnte ihm längst keine Angst mehr einjagen. Immerhin kannte er ihn nun schon seit mehr als fünfundzwanzig Jahren. Und dann wiederholte er die Worte, die Karina vorhin gesagt hatte. »Ich habe meine Assistenzzeit bei Ihnen ja auch überlebt.«
Professor Thiersch grummelte etwas Unverständliches, dann sah er Karina an.
»Ich halte nicht viel von langen Einführungsgesprächen«, erklärte er rundheraus. »Sie werden hier hart arbeiten und viel lernen. Melden Sie sich bei Kreis. Er ist Leitender Oberarzt der Notaufnahme.« Er schwieg kurz und betrachtete Karina dabei sehr kritisch. »Ich sage es Ihnen gleich: Es wird ein Sprung ins kalte Wasser sein, aber wenn Sie die Notaufnahme überstehen, dann überstehen Sie auch alles weitere hier.«
Karina verabschiedete sich rasch von ihrem Vater, dann machte sie sich auf den Weg zur Notaufnahme. Besorgt blickte Dr. Daniel ihr nach, bevor er sich dem Professor wieder zuwandte.
»Gleich am ersten Tag in die Notaufnahme…«,begann er, doch sehr viel weiter kam er nicht, denn Professor Thiersch fuhr ihn grob an: »Behalten Sie Ihre Meinung für sich! Ihre Tochter ist ab sofort Assistenzärztin hier, und ich schone meine Ärzte nicht – auch dann nicht, wenn sie Daniel heißen.« Er warf einen demonstrativen Blick auf seine Uhr. »Sie haben Ihre Tochter hier abgeliefert, jetzt können Sie gehen.«
Dr. Daniel schluckte. Der Gedanke, daß Karina die nächsten zwei Jahre unter der Fuchtel des ungehobelten Professors stehen würde, machte ihm schwer zu schaffen, und da nützte es auch nichts, sich an seine eigenen Assistenzzeit zu erinnern und daran, wieviel er bei Professor Thiersch gelernt hatte. Karina tat ihm jetzt schon leid, und fast wünschte er, sie hätte sich doch nicht für die Thiersch-Klinik entschieden.
»Ich bin nicht nur wegen meiner Tochter hier«, erwiderte Dr. Daniel nun und zwang sich, seine Gedanken auf die Unterlagen zu konzentrieren, die er in der Hand hielt. »Es geht um einen jungen Mann, der seit heute nacht in der Waldsee-Klinik liegt.«
Professor Thiersch nickte knapp. »Kommen Sie mit.« Mit kurzen, energischen Schritten ging er voran in sein Büro und setzte sich, hielt es aber nicht für nötig, auch Dr. Daniel einen Platz anzubieten.
»Der Patient leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie«, führte Dr. Daniel aus und reichte dem Professor die Unterlagen, die Dr. Scheibler gewissenhaft zusammengestellt hatte.
Professor Thiersch blätterte die dünne Akte durch, während Dr. Daniel schweigend zusah. Er wußte aus langjähriger Erfahrung, daß der Professor beim Aktenstudium nicht gestört werden wollte.
»Sieht böse aus«, urteilte er schließlich und blickte auf, dann lehnte er sich zurück. »Eigentlich habe ich nicht mal eine Luftmatratze frei geschweige denn ein Bett, aber in diesem Fall… ich fürchte, es eilt ganz gewaltig.«
Dr. Daniel nickte. »Dieser Meinung ist Dr. Scheibler auch. Deshalb hat er die nötigen Untersuchungen noch in der Nacht und heute früh durchgeführt.«
»Um den beneide ich Sie, Daniel«, knurrte Professor Thiersch.
Dr. Daniel mußte ein wenig schmunzeln und konnte sich dabei eine Bemerkung nicht verkneifen. »Sie hatten die Chance, Herr Professor. Hätten Sie Dr. Scheibler zum zweiten Oberarzt gemacht, anstatt ihn aus der Klinik zu werfen…«
»Werden Sie bloß nicht unverschämt, Daniel!« fiel Professor Thiersch ihm grob ins Wort. »Damals hatte ich meine Gründe, und später haben Scheibler und ich den ganzen Unfrieden aus der Welt geschafft, allerdings war er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr dazu zu bewegen, von
der Waldsee-Klinik zurück zur Thiersch-Klinik zu wechseln, wo-für ich auch Verständnis hatte und habe.« Er hob den Zeigefinger. »Sie haben da einen erstklassigen Arzt, das wissen Sie hoffentlich.«
»Und ob ich das weiß«, bekräftigte Dr. Daniel, dann wies er auf die Akten, die noch immer vor dem Professor lagen. »Kann Dr. Scheibler den Mann heute noch bringen?«
Professor Thiersch nickte knapp. »Wird sich nicht vermeiden lassen, schließlich wollen wir ihm helfen, und da zählt jeder Tag.« Er stand auf. »Jetzt verschwinden Sie endlich. Sie haben meine knapp bemessene Zeit schon lange genug strapaziert.«
Dr. Daniel kam dieser Aufforderung sofort nach und verabschiedete sich. Für einen Moment war er versucht, in die Notaufnahme zu gehen, um zu sehen, wie es Karina ging, doch dann ließ er es schweren Herzens bleiben. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, er würde Karina wie ein rohes Ei behandeln. Dabei gestand er sich nur ungern ein, daß er sich um seinen Sohn in einer vergleichbaren Situation nur halb so viele Sorgen gemacht hätte.
»Väter und Töchter«, murmelte er sich selbst zu. »Irgendwie ist ihr Verhältnis zueinander doch etwas Besonderes, auch wenn man es nicht wahrhaben will.«
*
Dieter Krause hatte sein Versprechen gehalten und war zur Waldsee-Klinik gefahren. Er kam um die Mittagszeit an und heuchelte nun Betroffenheit.
Annemarie war bei seinem Eintreffen noch bei Franz in der Intensivstation gewesen, doch eine Schwester hatte sie herausgeholt. Wäre Franz wach gewesen, hätte Annemarie ihn nicht allein gelassen, doch er war schon eine halbe Stunde zuvor völlig erschöpft eingeschlafen.
Als Annemarie auf den Flur trat, bemerkte Dieter sofort die dunklen Schatten unter ihren Augen, doch nicht einmal das rührte ihn. Die tröstende Geste, mit der er einen Arm um ihre Schultern legte, war ebenso Fassade wie alles andere an ihm.
Zusammen gingen sie in die Eingangshalle, und Annemarie erzählte ihm – immer wieder von heftigem Schluchzen unterbrochen – von der schicksalsschweren Diagnose des Oberarztes.
»Das ist ja schrecklich«, urteilte Dieter scheinheilig. »Der arme Franz.«
Er wollte noch etwas sagen, doch da kam ein junger, gutaussehender Arzt durch die Eingangshalle auf ihn und Annemarie zu. Die junge Frau lief ihm sofort entgegen.
»Herr Doktor, ist etwas mit Franzl?« fragte sie ängstlich.
»Keine Sorge, Fräulein Demel«, entgegnete der Arzt. »Franz schläft noch.« Er sah auf die Uhr. »In zehn Minuten werden wir uns auf den Weg nach München machen. Professor Thiersch erwartet uns schon, und ich denke, Sie wollen mitkommen.«
Annemarie nickte eifrig. »Selbstverständlich.«
»Gut. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn Franz im Krankenwagen liegt.«
»Wer war das?« wollte Dieter wissen, als sich der Arzt wieder entfernt hatte.
»Dr. Scheibler, der hiesige Oberarzt«, antwortete Annemarie und schickte ihm einen dankbaren Blick hinterher. »Wenn er nicht gewesen wäre…«
»Na, ich weiß nicht«, entgegnete Dieter abfällig. »Meiner Meinung nach ist er ein bißchen zu jovial. Spricht er von allen seinen Patienten so, als wären sie seine besten Freunde? Ich meine… für einen Oberarzt gehört es sich eigentlich nicht, seine Patienten beim Vornamen zu nennen.«
»Ich habe Dr. Scheibler in diesen schrecklichen Stunden der vergangenen Nacht als einen erstklassigen Arzt und warmherzigen Menschen kennengelernt«, erwiderte Annemarie, und Dieter spürte, daß er gegen den Arzt jetzt nicht allzu viel sagen durfte, wenn er sich ihr Vertrauen nicht verscherzen wollte.
»Nichts für ungut, Annemarie, es war ja nur so ein Eindruck«, meinte er vage, dann legte er wieder einen Arm um ihre Schultern. »Ich weiß nicht, ob du in diese Klinik mitfahren solltest. Du
siehst sehr mitgenommen aus. Wäre es nicht besser, du würdest dich von mir nach Hause bringen lassen?«
Doch Annemarie schüttelte nur den Kopf. »Ich weiche keinesfalls von Franzls Seite. Er braucht mich jetzt, und im umgekehrten Fall würde er für mich dasselbe tun.«
»Also schön«, gab Dieter nach. »Dann bestehe ich darauf, dich zu begleiten, und wenn ich im Krankenwagen nicht mitkommen kann, werde ich eben mit meinem Auto nach München fahren.«
Ein Gefühl der Wärme breitete sich in Annemarie aus.
»Ach, Dieter, ich bin so froh, daß du da bist«, erklärte sie. »Wahrscheinlich hätte ich dich gestern abend gar nicht wegschicken sollen.« Sekundenlang schmiegte sie sich vertrauensvoll an ihn. »Du bist ein wirklicher Freund.«
Jetzt trat Dr. Scheibler wieder in die Eingangshalle, und Annemarie löste sich so abrupt von Dieter, daß sie von einem erneuten Schwindelanfall ergriffen wurde. Sie taumelte, griff haltsuchend um sich und sackte dann zu Boden, weil Dieter nicht rasch genug reagiert hatte und Dr. Scheibler noch zu weit entfernt gewesen war, um sie aufzufangen.
»Annemarie!«
Diesmal war Dieters Besorgnis zumindest teilweise echt, allerdings weniger der jungen Frau als vielmehr des Vermögens wegen, das hinter ihr stand.
Dr. Scheibler zögerte nicht lange, sondern nahm Annemarie auf die Arme und trug sie ins Untersuchungszimmer der Chirurgie.
»Wolfgang!« rief er dem Chefarzt zu, während er die bewußtlose Annemarie in eine stabile Seitenlage brachte und ihre Beine hochlagerte. »Hast du Zeit?«
Der Chefarzt kam im Laufschritt heran, doch zusammen mit ihm erreichte auch Dr. Daniel den Untersuchungsraum. Er war gerade dabei gewesen, die Klinik zu verlassen, um in seine Praxis zurückzukehren, als er gesehen hatte, wie Dr. Scheibler die bewußtlose junge Frau hier hereingetragen hatte.
»Bemüh’ dich nicht, Wolfgang«, meinte er mit einem Blick zur OP-Kleidung des Chefarztes. »Ich nehme an, man erwartet dich im Operationssaal. Um Fräulein Demel kümmere ich mich schon.« Er sah Dr. Scheibler an. »Sie können mit Ihrem Patienten nach München fahren. Notfalls bringe ich Fräulein Demel nach, wenn sie bei ihrem Verlobten sein will. Allerdings läßt sich ihre Untersuchung jetzt nicht mehr länger hinauszögern.« Immerhin war es heute schon die zweite Ohnmacht, die Annemarie erlitten hatte.
»Was ist mit ihr?« wollte Dieter wissen, der in der offenen Tür stehengeblieben war und ratlos auf die Ärzte sah, die Annemarie umringten.
»Wer sind Sie?« wollte Dr. Daniel wissen, während er schon Puls und Blutdruck kontrollierte. Dr. Metzler und Dr. Scheibler verließen inzwischen den Untersuchungsraum.
»Dieter Krause«, antwortete er. »Ich bin ein Freund von Annemarie und Franz.«
Dr. Daniel warf dem jungen Mann einen kurzen prüfenden Blick zu, doch Dieter spielte den Besorgten so überzeugend, daß nicht einmal der erfahrene Arzt Verdacht schöpfte.
»Bitte gehen Sie einstweilen hinaus, Herr Krause«, bat Dr. Daniel. »Wenn ich meine Untersuchungen abgeschlossen habe und Fräulein Demel sich wieder ein wenig erholt hat, können Sie zu ihr kommen.«
Er wartete, bis Dieter draußen war, dann schloß er die Tür, ehe er zu Annemarie zurückkehrte. Ihre Lider begannen bereits zu flattern, dann öffnete sie die Augen und richtete sich sofort auf, was zu einem erneuten Schwindelanfall führte.
»Franzl!« stieß sie hervor.
Sanft drückte Dr. Daniel sie zurück. »Ihr Verlobter ist mit Dr. Scheibler auf dem Weg nach München, Sie können versichert sein, daß er in den besten Händen ist. Aber um Sie mache ich mir jetzt ernstliche Sorgen, Fräulein Demel.«
Annemarie wollte von der Untersuchungsliege herunterklettern. »Mit mir ist alles in Ordnung. Es ist nur die Aufregung… und die Angst um Franz.«
Energisch hielt Dr. Daniel sie zurück. »Ich werde Sie persönlich nach München zu Ihrem Verlobten bringen, aber erst, wenn ich meine Untersuchung abgeschlossen habe, und damit können wir nicht mehr länger warten. Ihr Blutdruck liegt ständig irgendwo bei neunzig zu sechzig, das heißt, Ihre nächste Ohnmacht kann jederzeit erfolgen. Dabei ist das Risiko, daß Sie sich verletzen, zu groß, als daß ich Sie einfach gehen lassen könnte.«
Annemarie seufzte tief auf. »Bitte, Herr Doktor, lassen Sie mich jetzt zu Franz. Ich verspreche Ihnen, daß ich mich untersuchen lassen werde… morgen… oder übermorgen…«
Doch in diesem Punkt ließ Dr. Daniel nicht mit sich reden. »Sie werden sich jetzt sofort untersuchen lassen.«
Ohne sich auf eine weitere Diskussion einzulassen, bereitete Dr. Daniel alles für eine Blutabnahme vor. Unglücklicherweise war Dr. Scheibler, der durch seine mehrjährige Ausbildung bei Professor Thiersch auch im Labor über große Erfahrung verfügte, jetzt nicht mehr im Haus, so daß Dr. Daniel gezwungen war, die Auswertung selbst vorzunehmen. Allerdings war das Ergebnis so eindeutig, daß sich Dr. Daniel fragte, weshalb Annemarie es nicht schon längst selbst bemerkt hat-te.
Sie richtete sich auf, als Dr. Daniel den Untersuchungsraum wieder betrat, und in ihren Augen konnte der Arzt die ganze Unruhe erkennen, die sie empfand. Ihr in dieser Situation eine solche Nachricht beizubringen…
»Herr Doktor, was ist denn jetzt mit mir?« fragte Annemarie ungeduldig und unterbrach damit Dr. Daniels besorgte Gedanken. »Kann ich endlich zu Franz?«
Spontan setzte sich Dr. Daniel auf den Rand der Untersuchungsliege und griff nach Annemaries Hand.
»Ich fürchte, jetzt ist der ungünstigste Zeitpunkt, um Ihnen das zu sagen, aber…« Er zögerte, ehe er fortfuhr: »Sie erwarten ein Baby.«
Annemarie starrte ihn an, als hätte er behauptet, in fünf Minuten würde die Welt untergehen, und für sie war es ja auch beinahe so.
»Ein… Baby?« wiederholte sie fassungslos, dann vergrub sie das Gesicht in den Händen. »O mein Gott… ausgerechnet jetzt…«
Genau das war Dr. Daniel auch durch den Kopf gegangen. Annemarie steckte wirklich in einer ungünstigen Situation. Arbeitslos, schwanger… und niemand konnte vorhersagen, wie es mit ihrem Verlobten weitergehen würde.
»Wann… ist es soweit?« erkundigte sich Annemarie zögernd.
»Um Ihnen das ganz genau zu sagen, müßte ich Sie untersuchen«, antwortete Dr. Daniel. »Außerdem muß ich wissen, wann Sie das letzte Mal Ihre Tage hatten.«
Annemarie schüttelte den Kopf. »Das weiß ich nicht mehr.« Sie errötete ein wenig. »Was müssen Sie jetzt nur von mir denken?« Dann seufzte sie tief auf. »Ich war immer sehr penibel damit… habe mir grundsätzlich das Datum notiert, aber dann… durch die Arbeitslosigkeit… irgendwie geriet mein ganzes Leben durcheinander.«
Dr. Daniel nickte verständnisvoll. »Das kann ich durchaus verstehen. Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn Sie es nicht mehr wissen. Durch eine Ultraschalluntersuchung läßt sich leicht klären, in welcher Schwangerschaftswoche Sie sind.«
Er half Annemarie von der Untersuchungsliege herunter und begleitete sie fürsorglich in die Gynäkologie hinüber. Hier nahm er zuerst eine normale körperliche Untersuchung vor, die zeigte, daß die Schwangerschaft noch nicht allzu weit fortgeschritten sein konnte. Die Gebärmutter hatte sich zwar schon vergrößert, aber nach Dr. Daniels Einschätzung konnte Annemarie höchstens im zweiten Monat schwanger sein.
»Ich muß den Ultraschall in diesem Fall von unten machen«, erklärte er. »Anders ist der Embryo sicher noch nicht zu sehen. Versuchen Sie ganz entspannt zu sein. Die Untersuchung ist nicht schmerzhaft, verursacht aber ein unangenehmes Gefühl.«
So empfand es Annemarie auch, aber der Grund dafür war vermutlich, daß sie es nicht schaffte, sich wirklich zu entspannen. Dazu war die Situation im Moment einfach zu verfahren.
»Es ist, wie ich vermutet habe«, meinte Dr. Daniel, als er mit der Untersuchung fertig war. »Sie sind jetzt etwa in der achten Schwangerschaftswoche. Das heißt, daß Sie in ungefähr sieben Monaten mit Ihrem Baby rechnen müssen.«
Annemarie schluckte. »In sieben Monaten.« Verzweifelt sah sie Dr. Daniel an. »Was soll ich nur tun? Franz liegt in der Thiersch-Klinik, ich bin arbeitslos… was für ein Leben erwartet dieses Kind?«
Da legte Dr. Daniel einen Arm tröstend um ihre Schultern. »Den Krankheitsverlauf Ihres Verlobten müssen Sie abwarten. Professor Thiersch wird alles tun, um ihn zu heilen, aber er ist auch nur ein Mensch, und Tatsache ist, daß Leukämie noch immer eine sehr schwere, in manchen Fällen unheilbare Krankheit ist.« Er schwieg kurz. »Was Ihre Arbeitslosigkeit betrifft, so gilt mein Angebot noch immer. Sie können hier arbeiten.«
Völlig fassungslos starrte Annemarie ihn an. »Obwohl ich schwanger bin? Ich meine… Sie wissen genau, daß ich in einem knappen halben Jahr in Mutterschutz gehen werde, und trotzdem…« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.«
»Doch, Fräulein Demel, es ist mein Ernst«, bekräftigte Dr. Daniel. »Ich bin auch sicher, daß der Chefarzt in diesem Fall keine Schwierigkeiten machen wird. Sie brauchen diese Stelle ganz dringend – auch wenn es nur für ein halbes Jahr ist.«
»Aber… Sie müssen die Stelle für mich freihalten, bis…«
»Auch das weiß ich«, fiel Dr. Daniel ihr ins Wort. »Aber es ändert nichts an meinem Entschluß. Die Stellung in der Waldsee-Klinik ist Ihnen sicher. Wie gesagt, ich werde mich noch mit dem Chefarzt unterhalten, weil ich ihn bei Einstellungen grundsätzlich nicht übergehe, aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, daß er mit meinem Entschluß einverstanden sein wird.«
Da griff Annemarie dankbar nach seinen Händen. »Sie sind ein wundervoller Mensch, Herr Doktor.«
*
Unruhig ging Dieter in der Eingangshalle auf und ab. An den todkranken Franz verschwendete er keine Gedanken, im Grunde auch nicht an Annemarie. Er sorgte sich lediglich um sich selbst und darum, was mit Annemaries Vermögen geschehen würde, wenn ihr etwas Ernstliches fehlen sollte. Aus diesem Grund lief er ihr auch gleich entgegen, als sie in Dr. Daniels Begleitung die Eingangshalle wieder betrat.
»Annemarie, was ist mit dir?« wollte Dieter sogleich wissen.
Sie seufzte leise und berührte unbewußt ihren Bauch. »Krank bin ich zwar nicht, aber wirklich freuen…« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, wirklich freuen kann ich mich im Moment noch nicht.« Sie schwieg kurz. »Ich erwarte ein Baby.«
Die Worte trafen Dieter wie ein Schlag. Stumm starrte er sie an, doch Annemarie bemerkte seine Betroffenheit gar nicht. Dr. Daniel dafür um so mehr, und er fragte sich mit Recht, was wohl der Grund dafür sein mochte. Liebe war es jedenfalls nicht, das sah er an Dieters Augen ganz genau.
»Normalerweise wäre es gar kein Problem«, fuhr die junge Frau nun leise fort. »Franz und ich wollten sowieso heiraten… allerdings noch nicht jetzt gleich.«
Dieter hörte gar nicht richtig hin. Ein Baby… der Erbe des Demel-Vermögens. Dieters Hirn arbeitete wie ein Computer. Er wußte, daß es für ihn nur eine Möglichkeit gab, in neun Jahren an Annemaries Geld zu kommen. Er mußte sie heiraten und dann das Kind irgendwie loswerden…
Dazu mußte er als erstes einmal Franz aus der Thiersch-Klinik herausholen.
Nur wenn Franz nicht mehr am Leben ist, kann ich Annemarie für mich gewinnen, dachte Dieter, und dabei störte es ihn nicht im geringsten, daß er über seinen Freund damit das Todesurteil sprach.
»Dieter, fährst du mich zu Franz?« fragte Annemarie und riß ihn damit aus seinen Gedanken. »Dr. Daniel würde mich sonst hinbringen, aber das kann ich nicht verlangen. Er hat schon so viel für mich getan und sicher noch andere Arbeit, deshalb dachte ich, daß du…«
»Das ist doch selbstverständlich«, bekräftigte Dieter sofort, zögerte und fügte dann hinzu: »Ich will Franz doch auch sehen.« Er lächelte Annemarie an. »Warte hier, ich hole meinen Wagen zum Eingang, damit du in deinem Zustand nicht so weit laufen mußt.«
Sogar Annemarie brachte daraufhin ein Lächeln zustande. »Das ist lieb von dir, Dieter.« Sie wartete, bis er draußen war, dann wandte sie sich Dr. Daniel zu. »Ich bin froh, daß er mir beisteht. Wissen Sie, Dieter und Franz sind seit der Schulzeit die besten Freunde. Er hält vielleicht nicht viel vom Arbeiten, aber er ist der einzige, auf den sich Franz immer blind verlassen konnte.« Ihr Gesicht umschattete sich. »Franz’ Krankheit muß Dieter auch ganz schrecklich treffen.«
Dr. Daniel schwieg dazu. Es fiel ihm trotz aller Menschenkenntnis schwer, den jungen Mann jetzt bereits richtig einzuschätzen. Er wußte nur eines: Dieter Krause war ihm nicht sonderlich sympathisch.
*
Erst auf der Fahrt von Steinhausen nach München erwachte Franz. Er spürte, daß man ihm den Temperaturfühler entfernt hatte, aber der Katheder lag noch, und auch der Infusionsschlauch steckte noch in seinem Unterarm. Langsam wandte er den Kopf und sah Dr. Scheibler an, der neben ihm saß.
»Wo ist Annemie?« fragte er leise.
»Sie wollte mitkommen«, antwortete der Oberarzt. »Aber eine erneute kurze Ohnmacht hat eine Untersuchung notwendig gemacht.«
Franz erschrak zutiefst. »Ist sie krank?«
»Ich weiß es nicht«, gestand Dr. Scheibler. »Vielleicht macht sie sich einfach nur so große Sorgen um Sie, aber das wird Dr. Daniel bestimmt herausfinden. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Franz. Ihre Verlobte ist bei Dr. Daniel in den besten Händen.«
Franz nickte halbherzig. Er machte sich eben doch Sorgen, und er hatte Angst… ganz entsetzliche Angst.
»In einer Viertelstunde etwa werden wir die Thiersch-Klinik erreichen«, erklärte Dr. Scheibler und riß ihn damit aus seinen Gedanken, dann legte er eine Hand auf Franz’ Arm. »Wie fühlen Sie sich?«
»Ich weiß nicht recht«, entgegnete er, zögerte kurz und gab dann offen zu: »Ich habe Angst.« Nervös spielte er mit der Decke, die Dr. Scheibler über ihn gebreitet hatte. »Wenn Sie bei mir bleiben könnten…« Er zuckte die Schultern. »Wissen Sie, ich habe von der Thiersch-Klinik schon gehört, aber irgendwie dachte ich immer… ich dachte, daß ich dieses Krankenhaus niemals von innen sehen würde. Krebs…« Er sah Dr. Scheibler an. »Ist es wirklich sicher? Ich meine… können Sie sich nicht vielleicht geirrt haben?«
Die Worte schnürten Dr. Scheibler förmlich die Kehle zu. »Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre ein Irrtum gewesen.« Er schwieg einen Moment, weil er Mühe hatte, seine Fassung zu behalten. »Professor Thiersch wird alles für Sie tun.« Wieder machte er eine Pause. »In diesem Zusammenhang… ich meine, der Professor hat eine etwas eigene, gewöhnungsbedürftige Art, mit anderen Menschen umzugehen. Meistens gibt er sich grob und ruppig, aber er versteckt hinter seiner rauhen Schale nur einen äußerst weichen Kern, und das Schicksal seiner Patienten liegt ihm sehr am Herzen, auch wenn er es nicht zeigt. Er hat schon vielen Menschen das Leben gerettet – auch mir.«
Überrascht sah Franz ihn an. »Ihnen? Heißt das… Sie hatten auch… Krebs?«
Dr. Scheibler nickte. »Akute Leukämie. Ich verdanke es Professor Thiersch und Dr. Metzler, daß ich noch am Leben bin.«
»Sie sind wieder gesund«, flüsterte Franz, dann huschte der Ansatz eines Lächelns über sein Gesicht. »Danke, daß Sie mir das erzählt haben. Jetzt kann ich auch ein bißchen Hoffnung haben.«
Der Krankenwagen bog in die Einfahrt, die zur Notaufnahme der Thiersch-Klinik gehörte. Dr. Sebastian Kreis, der Leitende Oberarzt, und Karina Daniel nahmen Franz in Empfang.
»Karina.« Dr. Scheibler zeigte sein Erstaunen ganz offen. »Hat man Sie denn schon am ersten Tag in die Notaufnahme verbannt?« Er schüttelte den Kopf. »Der gute Professor geht immer härter mit seinen Assistenzärzten um. Ich hatte damals wenigstens einen Monat Galgenfrist, bevor ich hierher mußte.«
»Hier unten ist wirklich die Hölle los«, gestand Karina lächelnd, während sie mithalf, die fahrbare Trage in die Klinik zu schieben, »und ich frage mich, wie Dr. Kreis da den Überblick behalten kann. Nie hätte ich gedacht, daß es in der Thiersch-Klinik eine solche Menge an Notfällen geben könnte. Man hat ja kaum mal Zeit zum Durchatmen.«
»Ganz anders als in der Waldsee-Klinik, nicht wahr?«
Karina nickte, dann lächelte sie wieder. »Ich bin froh, daß ich mich für die Thiersch-Klinik entschieden habe. Vor einer guten Stunde durfte ich schon meine erste Naht machen, und Dr. Kreis hat gesagt, ich dürfte dabeisein, wenn Ihrem Patienten der zentrale Venenkatheder gelegt wird, obwohl das eigentlich nicht zu den Aufgaben der Notaufnahme-Ärzte gehört. Aber oben auf der Station geht es im Moment anscheinend auch ziemlich rund.«
Dr. Scheibler nickte, dann wandte er sich dem Leitenden Oberarzt zu. »Herr Kollege, Sie stehen hier unten ganz schön im Streß. Wenn Sie sich nicht in irgendeiner Weise auf den Schlips getreten fühlen, dann könnte auch ich den zentralen Venenkatheder legen.«
»Mein lieber Herr Kollege«, entgegnete Dr. Kreis lächelnd. »Hier unten fühle ich mich nie auf den Schlips getreten, wenn mir jemand die Arbeit abnehmen will.« Er sah zu Franz hinüber und erkannte mit geübtem Blick die Angst in dessen Augen. »Ich glaube, Ihr Patient hat zu Ihnen ohnehin das größte Vertrauen.«
Der Leitende Oberarzt wies Dr. Scheibler einen kleinen Operationssaal zu, dann ließ er ihn mit Franz und Karina allein.
»Was geschieht jetzt mit mir?« wollte Franz wissen, doch seine Nervosität war merklich gesunken, seit er wußte, daß Gerrit alles Nötige veranlassen würde.
»Sie bekommen eine leichte Narkose«, erklärte Dr. Scheibler, dann schob er Franz’ Klinikhemd ein bißchen beiseite und wies auf eine Stelle etwas unterhalb des Schlüsselbeins. »Während Sie in Narkose liegen, werde ich hier einen Venenkatheder einführen. Über diesen Katheder bekommen Sie Blut und Medikamente.«
Franz schluckte. Die Angst wollte wieder hochkommen, doch da trat schon ein junger Anästhesist herein, um die Narkose einzuleiten.
Bewundernd sah Karina zu, wie Dr. Scheibler den zentralen Venenkatheder legte, während sie sich bemühte, hilfreich zu assistieren.
»Was glauben Sie, Gerrit, wird er wieder gesund werden?« fragte sie, als der Arzt fertig war.
Dr. Scheibler seufzte. »Das steht in den Sternen.«
*
»Franz hat Leukämie.«
Ohne Bedauern sprach Dieter diese Worte aus, doch seine Mutter bemerkte es gar nicht. Die Tatsache, daß Franz Baumgartner so schwer krank war, hatte sie zu sehr geschockt. Und sofort meldete sich bei ihr das schlechte Gewissen.
»Ich hätte es Conny sagen müssen… schon vor Jahren«, flüsterte sie, und Dieter hörte dabei die Angst aus ihrer Stimme heraus – Angst vor der Wahrheit.
»Wozu?« entgegnete er, weil er wußte, daß er seiner Mutter damit aus dem Herzen sprach. »Conny hält mich für ihren Bruder. Warum soll man sie mit der Wahrheit verunsichern? Sie hat nie eine andere Mutter als dich kennengelernt, und Franz hat keine Ahnung, daß seine kleine Schwester damals nicht gestorben, sondern von dir und Vater adoptiert worden ist. Keinem von beiden fehlt etwas im Leben. Weshalb solltest du also Schicksal spielen und ihre ganze Welt ins Wanken bringen?«
Hedwig Krause seufzte. »Wahrscheinlich hast du recht, Dieter, aber… ich habe eben ein schlechtes Gewissen dabei. Damals, als ich Conny zu mir genommen habe, da wollte ich nur meiner Freundin helfen… na ja, mir selbst wohl auch ein bißchen. Ich konnte keine Kinder mehr bekommen und wollte zu meinem Jungen«, sie streichelte Dieter zärtlich über die Wange, »ich wollte, daß du ein Schwesterchen bekommst.« Sie seufzte wieder. »Allerdings… manchmal denke ich, Conny hätte ein Recht darauf, zu erfahren, daß sie einen leiblichen Bruder hat.«
»Sie hält mich für ihren leiblichen Bruder«, entgegnete Dieter. »Vergiß das nicht, Mama. Conny hat keine Ahnung, daß sie adoptiert wurde, und es hat keinen Sinn, es ihr ausgerechnet jetzt zu sagen. Zu dem Schmerz, wenn sie erfahren müßte, daß du nicht ihre wirkliche Mutter bist, würde auch noch der Kummer über ihren todkranken Bruder kommen.«
Hedwig Krause nickte etwas halbherzig. Sie war nicht restlos überzeugt, das Richtige zu tun. Allerdings hatte Dieter zumindest in einem Punkt recht: Jetzt war wohl der ungünstigste Zeitpunkt, Cornelia die Wahrheit zu sagen. Franz war schwerkrank, und niemand konnte vorhersagen, ob er überhaupt überleben würde.
»Wenn er wieder gesund wird, dann sage ich es ihr«, beschloß Hedwig schließlich. »Ich will nicht, daß Conny leidet, aber sie hat andererseits auch ein Recht zu erfahren, wer sie ist.« Sie schwieg kurz. »Es muß nicht ausgerechnet jetzt sein.«
*
Seit fast drei Monaten arbeitete Annemarie nun schon in der Waldsee-Klinik. Der Dienst war anstrengend, obwohl sie von ihren Kolleginnen tatkräftig unterstützt wurde. Ihre knapp bemessene Freizeit verbrachte sie ausschließlich an Franz’ Bett, was zusätzlich an ihren Kräften zehrte. Dazu kam, daß sie ganz deutlich sah, wie es ihrem Verlobten immer schlechter ging. Über den dicken Katheder, den Dr. Scheibler ihm gelegt hatte, bekam er ständig frisches Blut und Zytostatika. Letztere verursachten Übelkeit und Haarausfall, wie auch die Bestrahlungen. Und die Injektionen, die zur Abtötung der leukämischen Zellen in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit direkt dorthin gegeben wurden, waren äußerst schmerzhaft.
In den Wochen seit seiner Einlieferung in die Thiersch-Klinik hatte Franz fast zehn Kilo Gewicht verloren und sah nun auch so krank aus, wie er es tatsächlich war. Aus diesem Grund hatte sich Annemarie bisher gescheut, ihm etwas von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Franz hatte genug mit seiner eigenen Krankheit zu kämpfen, da mußte sie ihn nicht auch noch mit dieser Schwangerschaft belasten, die zu gar keinem ungünstigeren Zeitpunkt hätte kommen können.
»Annemie.« Franz’ Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, dann griff er nach ihrer Hand. »Ich will hier ’raus.«
Völlig fassungslos starrte Annemarie ihren Verlobten an. »Franzl, das… das wäre ja…« Sie schüttelte den Kopf. »Nur hier kann man dir helfen.«
»Nein«, entgegnete er leise. »Es ist ein Hinauszögern, weiter nichts. Dieter sagt das auch. Er sagt, ich vergeude hier bloß wertvolle Zeit… Zeit, die ich mit dir verbringen könnte.«
Wieder schüttelte Annemarie heftig den Kopf. »Du weißt, wie sehr ich Dieter schätze, aber in diesem Punkt bin ich nicht seiner Meinung. Professor Thiersch tut alles, um dir zu helfen, und Dr. Scheibler sagt auch…«
»Annemie«, fiel Franz ihr ins Wort. »Ich weiß, daß ich sterben muß. Ich sterbe ja schon jeden Tag ein bißchen mehr.« Er schwieg, als müsse er für seine nächsten Worte Kraft sammeln. »Ich will die Zeit, die mir noch bleibt, mit dir verbringen.«
Da legte Annemarie ihre Hände um sein Gesicht. Es fühlte sich heiß an, und sie wußte, daß er noch immer leichtes Fieber hatte. Das würde sich bis zu seinem Tod wohl auch nicht mehr ändern.
»Dieter hat unrecht«, sagte sie eindringlich. »Du darfst nicht davonlaufen, Franzl, du mußt kämpfen, Franzl – für uns… für dich, für mich und… und für unser Baby.«
Aus weit aufgerissenen Augen starrte er sie an. »Unser… Baby?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, Annemie, sag… sag, daß es nicht wahr ist.«
Liebevoll küßte sie ihn. »Doch, Franzl, es ist wahr. Ich wollte es dir nicht sagen, weil… du leidest so schon zu sehr. Ich wollte dich damit nicht auch noch belasten, aber jetzt… du darfst nicht mit deinem Leben spielen, nur weil Dieter glaubt, die Behandlung würde nichts nützen. Franzl, Dieter ist kein Arzt. Er weiß nicht, was gut für dich ist, aber der Professor und Dr. Scheibler wissen es. Und ich weiß, daß sie recht haben. Vertraue ihnen. Das Baby und ich… wir brauchen dich.«
Tränen glitzerten in Franz’ Augen. »Annemie, wie soll es denn jetzt nur weitergehen?«
Wieder küßte sie ihn, versuchte ihm Mut und Kraft zu geben.
»Du mußt gesund werden, Franzl.«
Da schluchzte er hilflos auf. »Wenn ich das nur könnte.« Ungeachtet der Infusionsschläuche zog er Annemarie fest an sich. Er wollte sie spüren… in ihren Armen den Mut finden, den er selbst nicht mehr hatte.
»Annemie«, flüsterte er, bevor er völlig erschöpft einschlief.
Annemarie blieb noch eine Weile so liegen, das Gesicht auf seiner Brust. Sie hörte sein Herz ruhig und regelmäßig schlagen und fragte sich unwillkürlich, wie lange das noch der Fall sein würde. Sie sah ja selbst, wie es mit Franz weiter und weiter bergab ging, und wie oft hatte sie sich schon vorgenommen, mit Dr. Scheibler oder Professor Thiersch zu sprechen, doch sie hatte Angst vor den Antworten gehabt, die sie auf ihre Fragen bekommen würde.
Langsam stand sie auf und verließ mit schleppenden Schritten das Zimmer. Draußen traf sie eine Schwester und bat sie, Franz auszurichten, daß sie nach Steinhausen zu Dr. Daniel gefahren sei. Ihre nächste Vorsorgeuntersuchung stand an, doch Annemarie konnte sich auf das Baby nicht so freuen wie andere werdende Mütter, weil der Schatten des drohenden Todes über ihnen allen schwebte.
*
Zur selben Zeit saß Dr. Daniel zusammen mit Dr. Scheibler im Büro von Professor Thiersch. Die Sorge um Annemarie Demel hatte ihn während seiner Mittagspause hierhergetrieben.
»Das Baby verkümmert im Mutterleib, wenn diese extreme Belastung noch lange anhält«, erklärte Dr. Daniel rundheraus. »In der Sorge um ihren Verlobten magert sie praktisch täglich mehr ab.«
Professor Thiersch rückte energisch an seiner dicken Hornbrille herum – ein deutliches Zeichen, wie sehr dieser Fall ihn mitnahm, auch wenn er das niemals zugegeben hätte.
»Himmel noch mal, Daniel, was soll ich denn tun?« brauste er auf. »Soll ich die Hände auflegen und Hokuspokus sagen?«
»So habe ich das nicht gemeint, Herr Professor«, verwahrte sich Dr. Daniel. »Ich weiß genau, daß Sie alles für Herrn Baumgartner tun, was in Ihrer Macht steht. Was ich sagen wollte…« Er zögerte, weil es ihm schwerfiel, die Frage auszusprechen.
»Ich weiß schon, Daniel, Sie wollen wissen, ob er überhaupt eine Chance hat.« Professor Thiersch nahm ihm die Worte ab, dann seufzte er. »Er hat keine. Wir pumpen ihn hier förmlich mit Medikamenten voll, aber der Zerfall ist kaum aufzuhalten, dabei hatte ich gehofft, wenigstens eine kurze Remission zu erreichen. Es ist völlig aussichtslos.«
Niedergeschlagen lehnte sich Dr. Daniel auf seinem Stuhl zurück. Er hatte so gehofft, daß die Prognose des Professors etwas anders ausfallen würde.
»Wäre eine Knochenmarktransplantation eine Möglichkeit?« warf Dr. Scheibler ein.
Professor Thiersch sah ihn an und wußte genau, daß er an seine eigene Krankheit dachte, die er vor einigen Jahren nur mit viel Glück überlebt hatte.
»Ja«, antwortete er dann. »Allerdings nur, wenn sie innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen durchgeführt werden könnte. Unglücklicherweise hat Herr Baumgartner keinerlei Verwandtschaft, und sosehr ich mich bemühe… ich treibe einfach keinen Spender auf, dessen Gewebetyp auch nur annähernd dem meines Patienten entsprechen würde.«
Nach den niederschmetternden Worten des Professors schwiegen die Ärzte bedrückt. Schließlich stand Dr. Daniel auf. »Ich muß nach Steinhausen zurück. Fräulein Demel ist die erste Patientin, die heute nachmittag bei mir angemeldet ist.«
Dr. Scheibler folgte seinem Beispiel. »Ich muß auch zurück.«
Sie verabschiedeten sich von Professor Thiersch, der heute ungewöhnlich friedlich gesonnen war.
»Die Geschichte nimmt ihn sehr mit«, stellte Dr. Daniel fest, als er mit Dr. Scheibler den düsteren Flur entlangging.
Der junge Oberarzt nickte. »Er fühlte sich hilflos, und das ist für Professor Thiersch das Schlimmste. Ein Patient, der in seiner Klinik trotz seines Wissens zum Sterben verurteilt ist, ist für ihn das Schrecklichste, was es gibt.«
»Nicht nur für ihn«, murmelte Dr. Daniel und dachte dabei an Annemarie. Sie war zwar nicht unheilbar krank, aber die Gefahr, daß sie durch die ganze unglückliche Situation ihr Baby verlieren würde, war gegeben.
»Robert, ich will Ihnen nicht in Ihre Arbeit dreinreden, aber… sollten Sie der jungen Frau in diesem Fall nicht lieber reinen Wein einschenken? Ich meine…«
»Ich weiß, was Sie meinen, Gerrit«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Ich hatte ohnehin vor, mit Fräulein Demel ein ernstes Gespräch zu führen. Sie ist Krankenschwester und weiß, wie es um ihren Verlobten steht. Ich muß ihr aber bewußt machen, daß sie Gefahr läuft, auch ihr Kind zu verlieren, wenn sie sich jetzt nicht mehr schont.« Er seufzte. »Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die schwangere Steffi damals gelitten hat, als Sie auf Leben und Tod in der Thiersch-Klinik lagen.«
Dr. Scheibler dachte eine Weile nach. »Vielleicht sollten Sie es mit Fräulein Demel so machen wie damals mit Steffi. Eine Einweisung in die Waldsee-Klinik könnte ihrem Baby möglicherweise das Leben retten.«
»Oder ihre Lage noch weiter verschlimmern«, entgegnete Dr. Daniel. »Damals hielt ich Steffis Aufenthalt in der Klinik für gut, aber wenn ich heute noch einmal die Wahl hätte… ich weiß nicht, ob ich es wieder so machen würde. Steffi hat unter der Trennung von Ihnen mindestens ebenso gelitten wie unter der Gefahr, Sie zu verlieren, und ich könnte mir vorstellen, daß es sich bei Fräulein Demel ganz ähnlich verhält.«
Dr. Scheibler seufzte. »Um diese Entscheidung beneide ich Sie nicht, Robert.«
»Ich fürchte, es ist nicht meine Entscheidung. Ich kann Fräulein Demel höchstens einen Rat geben – mehr nicht.« Genau das war es ja, was ihm so zu schaffen machte. Er fühlte sich hilflos, und das war für ihn das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte.
*
Annemarie wartete schon, als Dr. Daniel in der Praxis eintraf. Er entschuldigte sich für die Verspätung und bemerkte dabei, daß Annemarie wieder abgenommen haben mußte.
»Fräulein Demel, ich mache mir große Sorgen um Sie«, kam er gleich zur Sache. »Um Sie und um Ihr Baby. Ich weiß, daß Sie vor Sorge um Ihren Verlobten kaum noch schlafen und essen können, aber Sie müssen dennoch auch an Ihr Kind denken. Es verhungert sonst.«
Annemarie schlug die Hände vors Gesicht und begann haltlos zu schluchzen. Hier in Dr. Daniels Praxis erlaubte sie sich diese Schwäche – bei Franz mußte sie stark sein, auch wenn es ihr von Tag zu Tag schwerer fiel.
»Was soll ich denn nur tun?« stieß sie unter Tränen hervor. »Franz geht es immer schlechter…«
Tröstend legte Dr. Daniel einen Arm um ihre bebenden Schultern. »Ich weiß ganz genau, was Sie jetzt durchmachen, Fräulein Demel.« Er zögerte, dann gestand er leise: »Ich habe meine erste Frau durch Leukämie verloren.«
Mit tränennassen Augen blickte Annemarie zu ihm auf. »Werde ich Franz… auch verlieren?«
Wieder zögerte Dr. Daniel einen Moment, bevor er antwortete: »Sie sind Krankenschwester, und soweit ich es beurteilen kann, eine ganz ausgezeichnete. Ich bin sicher, daß Ihnen nicht entgangen ist, wie es um Ihren Verlobten steht.«
Annemarie sackte auf ihrem Stuhl zusammen. Genau das war es, wovor sie sich immer gefürchtet hatte, und nun schien die Konfrontation mit der Wahrheit unausweichlich.
»Franz wird sterben.« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, dann sah sie Dr. Daniel wieder an, und er erkannte die Hoffnung in ihren Augen – eine Hoffnung, die er leider nicht erfüllen konnte.
Er nickte. »Zum jetzigen Zeitpunkt könnte ihm nur noch eine Knochenmarktransplantation helfen.«
»Er hat keine Eltern und keine Geschwister«, wandte Annemarie leise ein. All das, was Dr. Daniel ihr gesagt hatte, hatte sie im Grunde längst gewußt, doch sie hatte sich dagegen gewehrt. Der Gedanke, Franz zu verlieren, war ihr so unerträglich, daß Annemarie das Gefühl hatte, als müsse sie ebenfalls sterben. Sie schluckte schwer, dann zwang sie sich weiterzusprechen. »Seine Mutter starb an Leukämie, als Franz acht Jahre alt war, und seinen Vater kennt er nicht. Franz kam unehelich zur Welt.«
Diese Worte ließen eine vage Erinnerung in Dr. Daniel anklingen. Unwillkürlich runzelte er die Stirn.
»Baumgartner«, wiederholte er nachdenklich, dann sah er Annemarie wieder an. »Ich glaube, ich erinnere mich an sie. Sie kam während ihrer Schwangerschaft in unregelmäßigen Abständen zu mir in die Praxis.« Wieder dachte er angestrengt nach. »Sie war zweimal schwanger.« Er zuckte die Schultern. »Es sei denn, ich würde sie verwechseln. Das alles liegt schon sehr lange zurück. Ich war damals noch recht neu in Steinhausen.«
»Sie erinnern sich richtig«, antwortete Annemarie. »Franz hatte eine kleine Schwester, doch die ist wenige Wochen nach der Geburt gestorben. Er hat es mir einmal erzählt. Obwohl er damals erst sechs Jahre alt war, wußte er das alles noch ganz genau.«
Dr. Daniel seufzte. Er wollte einfach nicht wahrhaben, daß das nur eine Sackgasse gewesen war. Vor allen Dingen wollte er nicht glauben, daß Franz Baumgartner wirklich rettungslos verloren sei.
»Über seinen Vater weiß er nichts?« hakte Dr. Daniel aus diesem Grund nach. Natürlich wußte er, daß Mutter oder Geschwister als Knochenmarkspender geeigneter sein würden, aber durch das Auffinden des Vaters würde wenigstens ein Hoffnungsschimmer bleiben.
Doch Annemarie schüttelte den Kopf. »Seine Mutter hat ihn nie erwähnt.« Sie zuckte die Schultern. »Vielleicht war ihre Beziehung zu ihm nichts weiter als ein flüchtiges Abenteuer.«
»Ja… vielleicht«, murmelte Dr. Daniel, dann richtete er seine Konzentration auf Annemarie und ihr Baby. »Fräulein Demel, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber… denken Sie einmal dar-über nach, ob Sie nicht für eine Weile in der Waldsee-Klinik betreut werden möchten. Geregelte Mahlzeiten und ein bißchen Ruhe und Schonung könnten für Ihr Baby im Moment von Vorteil sein.« Er schwieg kurz. »Wenn Sie weiterhin kaum Nahrung zu sich nehmen und derartigen Raubbau mit Ihren Kräften treiben, könnte eine Fehlgeburt die Folge sein, und ich bin sicher, daß Sie die um jeden Preis vermeiden wollen.«
Unwillkürlich legte Annemarie beide Hände auf ihren Bauch. Die Angst um Franz nahm ihr jegliche Vorfreude auf das Kind, und sie verhinderte auch, daß sich Annemarie mit ihrer Schwangerschaft richtig beschäftigte, trotzdem wollte sie das Baby nicht verlieren, bedeutete es im Augenblick doch die einzig wirklich beständige Verbindung zu Franz. Wenn sein Tod tatsächlich unausweichlich sein würde, dann würde wenigstens ein Teil von ihm in seinem Kind weiterleben. Und gerade die Möglichkeit, daß Franz sterben würde, lag im Moment sehr viel näher als die seiner Genesung.
»Ich arbeite erst seit wenigen Monaten in der Waldsee-Klinik«, wandte Annemarie ohne große Überzeugung ein. »Da kann ich mich doch jetzt nicht einfach hinlegen und von meinen Kolleginnen betreuen lassen… noch dazu, wo ich ohnehin bald in Mutterschutz gehen werde.«
»Machen Sie sich jetzt bloß keine Gedanken über so etwas«, entgegnete Dr. Daniel. »Sie stehen gerade eine extreme Ausnahmesituation durch, ich weiß ganz sicher, daß die Ärzte und Schwestern der Waldsee-Klinik die letzten wären, die Ihnen irgendwelche Vorwürfe machen würden.«
Annemarie dachte eine Weile über diese Worte nach. Obwohl sie ihre neuen Kolleginnen – von Bianca einmal abgesehen – noch nicht sehr gut kannte, wußte sie, daß Dr. Daniel recht hatte. Niemand würde sich darüber mokieren, wenn sie nicht arbeitete – im Gegenteil. Schon jetzt waren alle äußerst rücksichtsvoll, von den anderen Schwestern wurde ihr oftmals sogar Arbeit abgenommen, weil alle wußten, wie groß die Anspannung war, der Annemarie im Moment unterlag.
Wieder streichelten ihre Hände über den Bauch, in dem sie ihr Baby wußte, wenn man auch noch nicht viel sehen konnte.
»Ich kann Franz nicht im Stich lassen«, flüsterte sie. »Er braucht mich doch so dringend.«
Dr. Daniel seufzte leise. Genau damit hatte er gerechnet, und er gestand sich ein, daß er Annemaries Reaktion nur zu gut verstand. Ihre Liebe zu Franz war im Augenblick einfach stärker als die zu ihrem ungeborenen Kind. Sie wollte es nicht verlieren, aber sie konnte ihre Sorge um Franz auch nicht für das Baby zurückstellen.
»Ich möchte, daß Sie mir etwas versprechen«, meinte Dr. Daniel schließlich. »Ich weiß, daß es nicht leichtfällt, aber Sie müssen versuchen, regelmäßig zu essen und soviel wie möglich zu schlafen. Richten Sie sich in der Angst um Ihren Verlobten nicht zugrunde. Das würde er bestimmt nicht wollen.«
Annemarie nickte, dann stand sie auf. »Ich muß jetzt in die Klinik. Meine Schicht beginnt in einer Viertelstunde.«
Auch Dr. Daniel erhob sich, öffnete dann aber die Tür zum Nebenzimmer. »Zuerst muß ich Sie noch untersuchen, Fräulein Demel.«
Die Untersuchung ergab genau das, womit Dr. Daniel gerechnet hatte. Das Baby konnte sich nicht altersgemäß entwickeln, und wenn Annemarie ihren momentanen Lebensrhythmus nicht schnellstens änderte, würde das Baby nicht überleben.
»Ich weiß, daß die Sorge um Ihren Verlobten Ihr ganzes Leben beherrscht«, erklärte Dr. Daniel, bevor er sich von Annemarie verabschiedete. »Aber Sie müssen auch an Ihr Kind denken. Verurteilen Sie es nicht zum Tod.«
*
Als Annemarie die Praxis verließ, kam ihr Dieter entgegen.
»Ich war in der Klinik«, erzählte er. »Aber man sagte mir, daß du hier seiest.«
Annemarie nickte. »Die Vorsorgeuntersuchung war wieder fällig.« Sie sah auf die Uhr. »Ich muß mich beeilen, Dieter, sonst komme ich zu spät.«
»Ich fahre dich«, bot er an, doch als er wenige Minuten später vor der Waldsee-Klinik anhielt, legte er eine Hand auf Annemaries Arm und hinderte sie so am Aussteigen. »Warst du heute schon bei Franz?«
Da schlug Annemarie die Hände vors Gesicht und begann haltlos zu schluchzen.
»Er wird sterben!« stieß sie hervor. »O Gott, Dieter, er wird sterben! Zum jetzigen Zeitpunkt könnte nur noch eine Knochenmarktransplantation… aber er hat ja niemanden… keine Eltern… keine Geschwister…«
Tiefe Zufriedenheit breitete sich auf Dieters Gesicht aus. Das lief ja besser, als er gedacht hatte. Franz brauchte gar nicht mehr dazu überredet zu werden, die Thiersch-Klinik zu verlassen, weil man ihm dort trotz allen Wissens und aller Medizin ohnehin nicht mehr helfen konnte. Und davon, daß Franz eine leibliche Schwester hatte, wußte niemand – nur er und seine Mutter. Dieter würde dafür sorgen, daß das auch so bleiben würde.
Wenn Franz erst tot war, konnte sich Dieter als der fürsorgliche Freund zeigen, der Annemarie in dieser schweren Zeit tatkräftig unterstützte. Irgendwann würde er für Annemarie so unentbehrlich geworden sein, daß sie einer Heirat zustimmen würde, und wenn er dann auch noch Franz’ Balg loswerden konnte, wäre das Demel-Vermögen seines!
*
Das Gespräch mit Annemarie ließ Dr. Daniel keine Ruhe, und so durchforstete er nach Beendigung der Sprechstunde sein Archiv, in dem abgelegte Karteikarten aufbewahrt wurden. Er mußte mehrere Karteikästen durchwühlen, bis er die Karte von Margarethe Baumgartner fand, und stellte dann fest, daß sie das letzte Mal vor fast zwanzig Jahren in seiner Praxis gewesen war.
Dr. Daniel zog sich in sein Sprechzimmer zurück, um die Karte intensiv zu studieren. Sehr viele Eintragungen enthielt sie nicht, denn Margarethe Baumgartner war nur in sehr unregelmäßigen Abständen zu ihm in die Praxis gekommen. Beim ersten Mal war sie bereits im fünften Monat schwanger gewesen, und danach hatte Dr. Daniel sie wenige Wochen vor der zu erwartenden Geburt untersucht. In den darauffolgenden fünf Jahren war sie nur einmal wegen einer Eierstockentzündung bei ihm gewesen, und auch während der zweiten Schwangerschaft war sie mit Vorsorgeuntersuchungen ziemlich nachlässig verfahren. Ganze drei Termine hatte sie wahrgenommen, den letzten kurz vor der Geburt des Kindes. Trotzdem konnte Dr. Daniel anhand seiner Eintragungen feststellen, daß beide Schwangerschaften problemlos verlaufen waren.
Einem Impuls zufolge griff Dr. Daniel nach dem Telefonhörer, rief im Kreiskrankenhaus an und ließ sich mit dem dortigen Chefarzt verbinden. Er hatte Glück, daß Dr. Breuer zu dieser fortgeschrittenen Stunde noch in der Klinik war.
Dr. Daniel nannte seinen Namen und entschuldigte sich für die späte Störung.
»Keine Ursache«, entgegnete Dr. Breuer. »Ihre Anrufe stellen für mich nie eine Störung dar, Herr Kollege. Im übrigen bin ich ja hier um zu arbeiten, nicht wahr?«
»So gesehen haben Sie recht«, stimmte Dr. Daniel zu, dann kam er gleich zur Sache. »Ich habe gerade einen sehr tragischen Fall hier… das heißt, eigentlich bin ich nur indirekt damit befaßt. Es geht um den Verlobten einer meiner Patientinnen, der an Leukämie erkrankt ist und ohne Knochenmarktransplantation unweigerlich sterben wird. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei, Nachforschungen über eventuelle Verwandte anzustellen. Die Mutter des jungen Mannes war seinerzeit Patientin bei mir, ist mittlerweile aber verstorben. Anhand meiner Aufzeichnungen hat sie noch ein zweites Kind zur Welt gebracht.«
»Und dieses Kind soll im Kreiskrankenhaus geboren worden sein?« hakte Dr. Breuer nach.
»Das weiß ich nicht«, räumte Dr. Daniel ein. »Allerdings liegt das fast zwanzig Jahre zurück, und damals fanden die meisten Entbindungen im Kreiskrankenhaus statt.«
»Zwanzig Jahre«, murmelte Dr. Breuer. »Damals war ich noch Oberarzt. Meine Güte, wie die Zeit vergeht.« Dann kam er wieder zur Sache. »Nennen Sie mir den Namen der Patientin, dann werde ich sehen, ob ich etwas herausbekomme.«
»Margarethe Baumgartner«, antwortete Dr. Daniel. »Ihr erstes Kind war ein Junge namens Franz, das zweite müßte ein Mädchen gewesen sein.«
»Gut, Herr Kollege, ich kümmere mich um die Sache«, versprach Dr. Breuer. »Spätestens Anfang nächster Woche werde ich zurückrufen.«
Doch der Rückruf des Chefarztes erfolgte noch am selben Abend. Dr. Daniel war gerade im Begriff, zu Bett zu gehen, als das Telefon klingelte.
»Die Geschichte hat mir keine Ruhe gelassen«, meinte Dr. Breuer. »Im übrigen wäre ich heute sowieso Strohwitwer gewesen, also hatte ich Zeit, unser Klinikarchiv zu durchforschen, und ich bin tatsächlich fündig geworden. Margarethe Baumgartner hat beide Babys hier zur Welt gebracht. Franz war fünfzig Zentimeter groß, hatte ein Geburtsgewicht von sieben Pfund und erreichte beim Apgar-Test zehn Punkte – also ein ganz normal entwickeltes Neugeborenes. Cornelia – so hieß das Mädchen – wurde sechs Jahre später geboren. Auch hier verlief die Geburt ohne Probleme, die Kleine war ebenfalls fünfzig Zentimeter groß und hatte sogar ein Geburtsgewicht von fast acht Pfund. Beim Apgar-Test erreichte sie auch zehn Punkte.«
»Das Mädchen soll wenige Wochen nach der Geburt gestorben sein«, wandte Dr. Daniel nun ein.
Dr. Breuer schwieg eine Weile. »Nun ja, Sie sind selbst Arzt und wissen, daß so etwas auch bei einem normal entwickelten Baby passieren kann. Denken Sie nur an den Plötzlichen Kindstod.«
»Ja, ich weiß«, räumte Dr. Daniel ein. »Aber irgend etwas sträubt sich, an diese Version zu glauben.«
»Die Sorge um Ihre Patientin und den jungen, leukämiekranken Mann«, vermutete Dr. Breuer. »Wobei ich einräumen will, daß es nach den hiesigen Aufzeichnungen bis zum Entlassungstag keine Probleme gegeben hat. Mutter und Kind waren wohlauf, und ich persönlich würde nach allem, was ich hier sehe, die Möglichkeit, daß das Kind dann gestorben ist, eher als gering einschätzen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie das Baby zu Tode gekommen sein könnte.«
Das wußte natürlich auch Dr. Daniel. Franz war zu diesem Zeitpunkt schon beinahe schulpflichtig gewesen. Er könnte beispielsweise Keuchhusten bekommen und seine kleine Schwester angesteckt haben. Sie wäre nicht das erste Baby, das an einer Kinderkrankheit gestorben wäre.
»Jedenfalls danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Bemühungen, Herr Kollege«, meinte Dr. Daniel, verabschiedete sich und legte auf.
»Was ist denn, Liebling?«
Von hinten trat seine Frau Manon zu ihm, und als er sich zu ihr umdrehte, legte sie ihre Arme um seinen Nacken.
»Worüber machst du dir denn schon wieder so große Sorgen?« fragte Manon behutsam weiter.
Dr. Daniel seufzte und vergrub das Gesicht in ihrem weichen, duftenden Haar.
»Ich kann den Tod eben nicht akzeptieren«, gab er unumwunden zu. »Vor allem dann nicht, wenn er einen Fünfundzwanzig-jährigen treffen soll.«
»Das ist aber nicht die ganze Geschichte«, vermutete Manon.
Dr. Daniel sah sie an und mußte nun sogar ein bißchen lächeln. »Du kennst mich viel zu gut.« Er wurde sofort wieder ernst. »Nein, es ist nicht die ganze Geschichte. Der junge Mann hat Leukämie, und seine Verlobte reibt sich in der Sorge um ihn so sehr auf, daß nicht nur sie selbst in Gefahr gerät zusammenzubrechen – sie hat auch das Baby, das sie erwartet, schon an den Rand des Todes gebracht. Und ich stehe hilflos daneben. Wie soll diese junge Frau zu einem geordneten Lebensrhythmus finden, wenn ihr Verlobter im Sterben liegt?«
Manon konnte gut nachvollziehen, was in ihrem Mann vorging. Er selbst hatte diese extreme psychische Belastung zweimal durchgestanden – das erste Mal bei seiner Frau, die wenige Wochen nach Diagnosestellung gestorben war, das zweite Mal bei ihr – Manon. Sie war damals nur durch eine Knochenmarktransplantation gerettet worden.
»Robert.« Manons Stimme klang besorgt, und in ihren Augen konnte er lesen, was sie dachte.
Er schüttelte den Kopf. »Ich denke dabei nicht an das, was ich selbst…« Er stockte, dann seufzte er tief auf. »Doch, natürlich denke ich auch daran. Was soll ich nur tun, um…« Er unterbrach sich mitten im Satz, weil ihm plötzlich ein Gedanke kam.
Margarethe Baumgartner hatte bis zu ihrem Tod in Steinhausen gelebt, und der einzige Allgemeinmediziner hier war zu jener Zeit der alte Dr. Gärtner gewesen, dessen Praxis Manon vor etlichen Jahren übernommen hatte. Wäre die kleine Cornelia ernsthaft krank gewesen, hätte sich ihre Mutter mit Sicherheit an den einzigen Arzt des Ortes gewandt.
»Manon, hast du noch die alten Karteikarten von Dr. Gärtner?« wollte er wissen.
Seine Frau nickte. »Selbstverständlich. Ich habe ja alle seine Patienten übernommen, und seit ich die Praxis führe, ist kaum jemand abgesprungen, es sei denn durch Umzug in einen anderen Ort. Auch die abgelegten Karteikarten habe ich aufbewahrt. Sie sind unten im Keller, in dem alten Eisenschrank.« Sie hielt Dr. Daniel zurück, als er sich sofort der Tür zuwandte. »Moment mal, Robert, du willst doch wohl nicht heute noch dort unten herumsuchen. Es geht bereits auf Mitternacht zu.«
»Ich könnte jetzt sowieso nicht schlafen«, wandte Dr. Daniel ein und küßte Manon flüchtig. »Geh ruhig ins Bett, Liebes. Ich komme dann nach.«
»Robert…«, begann Manon noch einmal, doch da war er schon draußen, und sie wußte, es würde keinen Sinn haben, ihm zu folgen. Die Sorge um seine Patienten, oft auch um Menschen, die nicht zu seinen Patienten gehörten, war stärker als alles andere. Dr. Daniel tat grundsätzlich alles mit ganzem Herzen, und das war auch ein Grund, weshalb Manon ihn so sehr liebte.
*
Die nächtliche Suche im Keller hatte für Dr. Daniel keinen Erfolg gebracht. Unter den Karteikarten des alten Dr. Gärtner war keine gewesen, die auf den Namen Cornelia Baumgartner lautete, während die Karte von Margarethe Baumgartner ordnungsgemäß abgelegt war, doch die Eintragungen beschränkten sich auf die vielfältigen kleineren Erkrankungen der Patientin: grippale Infekte, ein verstauchtes Handgelenk und ähnliches. Die letzte Eintragung war die Auswertung einer Blutprobe und der Vermerk, daß die Patientin wegen Verdachts auf Leukämie in einer Münchner Klinik überwiesen worden war. In der Praxis seiner Frau fand Dr. Daniel dann auch die Karte über Franz, doch sie gab natürlich kei-nerlei Aufschluß darüber, ob dieser auch eine Schwester gehabt hatte.
Alles in allem war Dr. Daniel mit den Ergebnissen seiner Suche nicht zufrieden. Doch dann kam ihm ein Gedanke, und er fragte sich, weshalb er nicht gleich darauf gekommen war. Wenn Cornelia tatsächlich gestorben war, mußte ihr Name im Sterberegister der Gemeinde verzeichnet sein. Dr. Daniel verzichtete darauf, den offiziellen Weg zu gehen, und wandte sich am folgenden Morgen gleich an den Steinhausener Bürgermeister Eberhard Schütz.
»Da bringen Sie mich aber in eine verzwickte Lage, Herr Doktor«, meinte der Bürgermeister und begann nervös an seinem Ohrläppchen zu zupfen, wie er es immer tat, wenn er scharf nachdachte. »Ich kann Ihnen nicht so einfach Einblick in diese Bücher gewähren, das müssen Sie verstehen. Da könnte schließlich jeder daherkommen und…«
»Einen Einblick in die Bücher verlange ich ja gar nicht«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Herr Bürgermeister, Cornelia Baumgartner soll wenige Wochen nach ihrer Geburt gestorben sein. Wenn das stimmt, dann ist das Schicksal eines jungen Mannes besiegelt. Sollte sie aber noch am Leben sein, dann muß ich sie finden, damit sie ihrem Bruder das Leben retten kann.« Er legte einen Zettel auf den Schreibtisch des Bürgermeisters. »Ich will die Bücher gar nicht sehen. Ich will nur wissen, ob eine Cornelia Baumgartner in dem Zeitraum, den ich Ihnen hier notiert habe, gestorben ist. Bitte, Herr Bürgermeister, das Leben eines jungen Menschen hängt davon ab.«
Bürgermeister Schütz stand auf und griff nach dem Zettel. »Also schön, warten Sie hier, Herr Doktor, ich werde sehen, was ich machen kann.«
Die beiden Beamten, die an der zuständigen Stelle saßen, waren nicht sehr erbaut über die Aufgabe, die der Bürgermeister ihnen stellte, doch sie beeilten sich, die gewünschte Auskunft herbeizuschaffen. Das Ganze dauerte dann nicht einmal eine Viertelstunde.
»In unserem Sterberegister ist keine Cornelia Baumgartner verzeichnet«, erklärte Bürgermeister Schütz. »Jedenfalls nicht in diesem Zeitraum.«
Dr. Daniel fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Erregung. Er hatte fast ein Jahr als möglichen Todeszeitraum angegeben, was bedeutete, daß Cornelia nach ihrer Geburt nicht nur ein paar Wochen, sondern mehrere Monate gelebt hatte, und vermutlich lebte sie sogar heute noch… die Frage war nur, wo!
*
Als Dr. Daniel aus dem Rathaus in seine Praxis zurückkehrte, wartete dort schon eine Nachricht auf ihn.
»Sie sollen sofort in die Waldsee-Klinik kommen«, erklärte seine junge Empfangsdame Gabi Meindl hastig. »Fräulein Demel ist vor einer Viertelstunde mit Unterleibsblutungen zusammengebrochen.«
Dr. Daniel verließ im Laufschritt seine Praxis, stieg ins Auto und fuhr zur Waldsee-Klinik hin-über. Als er wenige Minuten darauf die Gynäkologie erreichte, bemühte sich die junge Frauenärztin Dr. Alena Reintaler schon um Annemarie.
»Ich fürchte, die Fehlgeburt wird sich nicht mehr aufhalten lassen«, raunte sie Dr. Daniel leise zu.
»Sie muß sich aufhalten lassen«, entgegnete er entschieden, dann trat er zu Annemarie, die auf der Untersuchungsliege lag und verzweifelt schluchzte.
»Ganz ruhig, mein Kind«, bat er, und seine tiefe, warme Stimme zeigte gleich etwas Wirkung. Annemaries heftiges Zittern und Schluchzen verebbte ein wenig.
»Na los, Alena, erzählen Sie mir etwas«, drängte Dr. Daniel.
»HCG-Wert im Normalbereich, Ultraschall zeigt Herzaktion und schwache Kindsbewegungen«, antwortete die junge Gynäkologin rasch. »Wehen kommen in unregelmäßigen Abständen, Muttermund ist leicht geöffnet. Schmierblutung.«
Dr. Daniel brauchte keine Sekunde, um sich zu entscheiden. Er gab Anweisung für eine Infusion mit einem wehenhemmenden Medikament. Während Alena seinem Befehl nachkam, wandte sich Dr. Daniel der Stationsschwester Bianca Behrens zu. »Ich brauche sofort einen Anästhesisten.«
»Dr. Parker ist im Haus«, antwortete Bianca und lief gleichzeitig los, um den jungen Arzt zu holen.
Die Infusion war gelegt, und als Dr. Daniel die fahrbare Trage persönlich in den Operationssaal hinüberfuhr, sah Annemarie ihn mit großen, ängstlichen Augen an.
»Werde ich mein Baby verlieren?« fragte sie bang.
»Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann«, erwiderte Dr. Daniel, dann berührte er sekundenlang ihre Wange. »Wir werden alle zusammen um Ihr Baby kämpfen.«
Tränen rollten über Annemaries Gesicht. »Es ist meine Schuld.«
»Reden Sie sich das jetzt nicht ein«, entgegnete Dr. Daniel ernst. »Aufgrund der Symptome halte ich eine Gebärmutterhalsschwäche für sehr viel wahrscheinlicher, und dafür kann niemand etwas.«
Im Laufschritt kam Dr. Parker nun herein.
»Notfall«, informierte Dr. Daniel ihn knapp. »Ich muß eine Cerclage vornehmen.«
Der Anästhesist nickte, dann richtete er ein paar aufmunternde Worte an Annemarie, während er die Spritze zur Narkoseeinleitung vorbereitete.
»So, jetzt wird schön geschlafen«, meinte er und preßte den Inhalt der Spritze durch die Infusionskanüle direkt in die Vene. Fast augenblicklich war Annemarie eingeschlafen. Rasch und geschickt intubierte Dr. Parker, damit er der Patientin nicht mehr Narkosegas als nötig verabreichen mußte.
Inzwischen hatte sich Dr. Daniel die Hände gewaschen und ließ sich nun von der ebenfalls rasch herbeigeeilten OP-Schwester die keimfreien Handschuhe überstreifen. Annemaries Beine wurden in spezielle Bügel gelegt. Schon ein erster Blick genügte Dr. Daniel, um festzustellen, daß die Fruchtblase noch nicht geplatzt war. Er arbeitete rasch und konzentriert, um den Gebärmutterhals mit einer kordelähnlichen Naht zu verschließen, bevor die Fehlgeburt wirklich nicht mehr aufzuhalten sein würde.
»Das war in letzter Sekunde«, murmelte er, als er sich langsam aufrichtete, dann sah er Dr. Parker an. »Bringen Sie Fräulein Demel bitte in den Aufwachraum. Ich kümmere mich gleich um sie.«
Er wusch sich die Hände und kam dann gerade rechtzeitig zu Annemarie, als sie aufwachte.
»Mein Baby«, flüsterte sie schwach.
Väterlich nahm Dr. Daniel ihre Hand und drückte sie sanft. »Keine Sorge, Fräulein Demel, es ist alles in Ordnung.«
Erleichtert schloß sie die Augen wieder, und Dr. Daniel wußte, daß sie unter den Nachwirkungen der Narkose noch eine Weile schlafen würde. Er warf einen Blick auf die Uhr. Es war schon gleich halb elf, das bedeutete, daß in seinem Wartezimmer jetzt ein mittleres Chaos herrschen würde.
Rasch eilte er auf den Flur und sah die Stationsschwester der Gynäkologie gerade aus dem Untersuchungsraum kommen.
»Bianca, seien Sie so lieb, und sehen Sie ab und zu nach Fräulein Demel«, bat er. »Ich muß schleunigst in die Praxis, komme aber während der Mittagspause wieder her. Bis dahin wird sie vermutlich ohnehin die meiste Zeit schlafen.«
»Ich werde in regelmäßigen Abständen nach ihr sehen, Herr Doktor«, versprach Bianca.
Dr. Daniel bedankte sich hastig, dann eilte er weiter. In seiner Praxis herrschte tatsächlich die reinste Invasion, so daß er keine Zeit hatte, sich in Gedanken mit Annemarie und Franz zu beschäftigen. Erst als er gegen zwei Uhr nachmittags die letzte Patientin verabschiedet hatte, kam alles zurück, was während dieses Vormittags auf ihn eingestürmt war.
»Fräulein Sarina, rufen Sie bitte meine Frau in der Wohnung oben an und sagen Sie ihr, daß…«
»… daß du nicht zum Mittagessen kommen wirst«, vollendete Manon seinen Satz. Sie hatte die Praxis unbemerkt betreten und nahm ihren Mann jetzt energisch beim Arm. »So nicht, Herr Dr. Daniel. Zumindest einmal am Tag mußt du etwas essen. Dein Frühstück hast du ja ohnehin schon sausen lassen.«
»Manon, ich habe keine Zeit«, entgegnete Dr. Daniel. »Ich muß…«
»Du mußt für zehn Minuten mit hinaufkommen und ein paar Happen essen«, fiel Manon ihm ins Wort. »Heute ist Mittwoch, was bedeutet, daß du nachmit-tags keine Sprechstunde hast
und somit deinen tausend anderen Verpflichtungen nachkommen kannst.«
Dr. Daniel seufzte tief auf, doch zu einer Erwiderung kam er nicht mehr, denn nun mischte sich auch seine Sprechstundenhilfe Sarina von Gehrau ein.
»Ihre Frau hat völlig recht, Herr Doktor«, meinte sie. »Zehn Minuten Mittagspause sollten sogar Sie sich gönnen.«
Die junge Empfangsdame Gabi Meindl nickte ebenfalls zustimmend.
Wieder seufzte Dr. Daniel. »Womit habe ich eine solche Herde besorgter Frauen verdient? Also schön, ich werde kurz etwas essen.«
Diese Tätigkeit nahm dann wirklich nicht mehr als zehn Minuten in Anspruch. Schon war Dr. Daniel wieder auf dem Weg zur Waldsee-Klinik.
Annemarie lag bereits auf der normalen Station, und sie war wach, als Dr. Daniel eintrat.
»Tut mir leid, daß ich so spät komme«, entschuldigte er sich, »aber in meiner Praxis war die Hölle los, und überdies wurde ich nach der Sprechstunde noch zum Essen gezwungen.«
Annemarie mußte lächeln, obwohl ihr nicht danach zumute war. »Wenn Ihre Frau nicht auf Sie aufpassen würde, dann würden Sie sich für Ihre Patientinnen völlig aufreiben.« Sie wurde wieder ernst. »Ist mein Baby wirklich nicht mehr in Gefahr?«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf, schränkte jedoch ein: »Vorausgesetzt, Sie hüten in den nächsten Wochen das Bett.« Er setzte sich zu ihr und griff wieder nach ihrer Hand. »Fräulein Demel, Sie sind heute mit knapper Not einer Fehlgeburt entgangen, wobei Sie noch von Glück sagen konnten, daß Sie Wehen hatten. Wie ich aufgrund der Symptome schon angenommen hatte, leiden Sie an einer Zervixinsuffizienz… einer Gebärmutterhalsschwäche, und die macht meistens erst auf sich aufmerksam, wenn es schon zu spät ist. Unter dem Druck des größer werdenden Babys öffnet sich der Muttermund in den meisten Fällen ohne Wehentätigkeit. Das bedeutet, die Schwangere merkt es überhaupt nicht und wird dann von einer plötzlichen Fehlgeburt überrascht. In Ihrem Fall konnte ich glücklicherweise noch rechtzeitig reagieren. Ich habe den Gebärmutterhals zugenäht, etwa ein bis zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin werde ich die Naht wieder öffnen, damit Ihr Baby auf normalem Weg geboren werden kann. Allerdings bedeutet dieses Zunähen nicht, daß Sie jetzt genauso weitermachen können wie zuvor. Sie hatten Blutungen und vorzeitige Wehen, deshalb gehören Sie ins Bett und zwar ohne Einschränkungen. In den nächsten Wochen dürfen Sie nicht mal auf die Toilette gehen. Sie haben sicher schon bemerkt, daß man Ihnen einen Katheter gelegt hat. Einmal täglich wird Ihnen ein sanftes Abführmittel verabreicht, damit Sie wegen der mangelnden Bewegung nicht auch noch unter Verstopfung leiden. Alles in allem warten auf Sie ein paar unangenehme Wochen, aber wenn Sie Ihr Baby behalten wollen, müssen Sie diese Zeit durchstehen.«
Annemarie kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen. »Natürlich will ich mein Baby behalten, aber… Franz. Ich… ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Er kann sterben, während ich hier liege… Herr Doktor, das… das…«
»Immer mit der Ruhe, Fräulein Demel«, fiel Dr. Daniel ihr sanft ins Wort. »Natürlich weiß ich, wie sehr es Sie zu Ihrem Verlobten zieht – gerade jetzt. Ich verspreche Ihnen, daß ich mich gleich heute mit Professor Thiersch in Verbindung setzen werde. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Sie in der Thiersch-Klinik unterzubringen. Ich will Sie von Ihrem Verlobten ja nicht fernhalten. Das wäre im Moment weder für Sie noch für ihn gut.« Er zögerte. »In diesem Zusammenhang…« Er atmete tief durch, weil er nicht sicher war, ob er nicht gerade im Begriff war, einen Fehler zu begehen. Möglicherweise weckte er Hoffnungen, die sich nie erfüllen würden. Andererseits mußte er mehr über Franz’ Schwester wissen. »Ich habe Nachforschungen angestellt. Sie sagten, die kleine Schwester Ihres Verlobten wäre wenige Wochen nach der Geburt gestorben.«
Annemarie nickte. »So hat Franz es mir erzählt.«
»Die Schwester Ihres Verlobten war ein gesundes, kräftiges Neugeborenes. Sie ist im Sterberegister der Gemeinde nicht verzeichnet.«
Unwillkürlich hielt Annemarie den Atem an. »Heißt das… sie… lebt?«
»Ich weiß es noch nicht«, gab Dr. Daniel zu. »Ihr Verlobter könnte sich geirrt haben, und die Kleine ist vielleicht zwei oder drei Jahre alt geworden, bevor sie dann starb. Ich habe vorerst nur ihr erstes Lebensjahr überprüfen lassen. Während dieser Zeit ist jedenfalls keine Cornelia Baumgartner verstorben.«
»Cornelia«, wiederholte Annemarie stirnrunzelnd. »Diesen Namen hat Franz nie genannt. Wie kommen Sie darauf?«
»Ihr Verlobter und seine kleine Schwester kamen im Kreiskrankenhaus zur Welt«, antwortete Dr. Daniel. »Der dortige Chefarzt nannte mir diesen Namen.«
»Seltsam«, murmelte Annemarie. »Dieters Schwester heißt auch Cornelia. Sie ist vor ein paar Wochen neunzehn geworden.«
Ganz deutlich sah Dr. Daniel die Eintragung aus seiner alten Karteikarte vor sich… und den errechneten Geburtstermin von Margarethe Baumgartners zweitem Kind. Wenn seine Berechnung stimmte, dann wäre Cornelia Baumgartner vor wenigen Wochen neunzehn Jahre alt geworden. Konnte das noch ein Zufall sein?
»Wie lange kennen sich Ihr Verlobter und sein Freund schon?« hakte Dr. Daniel nach.
»Die Krauses haben früher ebenfalls in Steinhausen gewohnt«, gab Annemarie Auskunft. »Frau Krause und die Mutter von Franz waren angeblich die besten Freundinnen. Dieter und Franz wuchsen mehr oder weniger zusammen auf, gingen gemeinsam zur Schule und waren eigentlich genauso unzertrennlich wie ihre Mütter.« Wieder runzelte sie die Stirn und versuchte sich zu erinnern, was Franz ihr noch alles erzählt hatte. »In dem Jahr, als Franz’ Schwester geboren worden ist, zogen die Krauses von Steinhausen in die Kreisstadt um. Franz und Dieter trafen sich daraufhin seltener, blieben aber Freunde – bis heute.«
»Das würde bedeuten, daß Frau Krause fast gleichzeitig mit Frau Baumgartner ein zweites Kind bekommen haben muß«, folgerte Dr. Daniel.
Annemarie nickte. »Ja, sieht so aus, und scheinbar haben sie ihre Mädchen auf denselben Namen getauft – vielleicht aus Freundschaft.« Bedauernd zuckte sie die Schultern. »Darüber hat mir Franz nie etwas erzählt, aber anders kann es ja nicht gewesen sein.«
Dr. Daniel ahnte, daß es noch eine zweite Möglichkeit gab, doch darüber wollte er im Moment noch nichts sagen. Es war ja wirklich möglich, daß Annemaries Auslegung der Dinge richtig war. Dr. Daniel wollte dieser Sache auf jeden Fall nachgehen.
*
Hedwig Krause war überrascht, als sie auf das Klingeln hin die Tür öffnete und sich so unerwartet Dr. Daniel gegenübersah. Allerdings erkannte er seine Patientin von einst auch sofort wieder, obwohl sie älter geworden war, denn sie hatte sich nicht sehr verändert. Der Name Krause hatte ihm nur deshalb nichts gesagt, weil er die damals junge Frau behandelt hatte, als sie noch unverheiratet gewesen war. Später hatte sie dann die Ärztin aus der Kreisstadt vorgezogen.
»Herr Dr. Daniel.« Hedwig war noch immer sichtlich erstaunt. »Was führt Sie zu mir? Woher wissen Sie denn meinen jetzigen Namen und…«
»Ich hatte keine Ahnung, daß Sie hinter dem Namen Krause stehen«, erwiderte Dr. Daniel. »Eigentlich bin ich gekommen, um mit Ihnen über Ihre Tochter zu sprechen.«
Verlegene Röte huschte über Hedwigs Gesicht, was Dr. Daniel natürlich bemerkte.
»Hat Conny etwas angestellt?« fragte sie, und ihre Stimme bebte dabei ein wenig. »Oder… war sie vielleicht bei Ihnen? Ich meine… sie ist jung und… und sie hat einen Freund…«
Dr. Daniel schüttelte den Kopf. »Nein, Frau Krause, darum geht es nicht. Es ist vielmehr…« Er atmete tief durch. »Ich würde Ihnen eine so indiskrete Frage niemals stellen, wenn es nicht um das Leben eines jungen Mannes ginge.« Wieder zögerte er kurz: »Ist Cornelia Ihre leibliche Tochter?«
Sekundenlang stand Hedwig wie erstarrt, dann brach sie in Tränen aus.
»Ich hätte es ihr sagen müssen, aber… ich wollte nicht, daß sie leidet… sie liebt mich so und… ich hatte Angst, daß sich das ändern könnte, wenn sie die Wahrheit erfährt.«
Impulsiv legte Dr. Daniel einen Arm um die bebenden Schultern der Frau und begleitete sie zu einem Sessel.
»Ich verstehe sehr gut, was in Ihnen vorgegangen ist, und normalerweise hätte das wohl nichts ausgemacht«, meinte Dr. Daniel in der ihm eigenen warmherzigen Art. »Cornelia wuchs in einer intakten Familie auf und wurde geliebt. Doch jetzt… Frau Krause, Sie wissen, daß Cornelia einen leiblichen Bruder hat – Franz, den besten Freund Ihres Sohnes.«
Hedwig nickte. »Dieter hat erzählt, wie krank er ist. Als ich es erfuhr, wollte ich Conny sagen, daß… nun ja, daß Franz ihr Bruder ist, aber Dieter hat gemeint, es wäre sinnlos, ihr das anzutun… ihr von einem Bruder zu erzählen, der doch in wenigen Wochen sterben wird.«
Dr. Daniel runzelte die Stirn. »Ihr Sohn weiß von dieser Adoption?«
Hedwig nickte. »Ich habe es ihm gesagt, als er achtzehn war.« Sie zuckte die Schultern. »Er liebt Conny, aber irgendwie hat er wohl gemerkt, daß sie nicht wirklich seine Schwester ist. Vielleicht hat er auch…« Sie winkte ab. »Das ist jetzt alles uninteressant.«
Für Dr. Daniel war es das durchaus nicht, und er war überzeugt davon, daß er dieser Sache noch näher nachgehen würde, doch jetzt ging es in der Tat erst mal um Wichtigeres.
»Franz Baumgartner hat nur eine Überlebenschance«, fuhr Dr. Daniel fort, »nämlich eine Knochenmarktransplantation, und der einzige Mensch, der als Spender in Frage kommt, ist seine Schwester.«
Hedwig erschrak, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich setzte Conny keiner Gefahr aus.«
»Für Cornelia ist es nicht gefährlich«, versicherte Dr. Daniel. »Sie muß nur ihr Blut untersuchen lassen, damit festgestellt werden kann, ob ihr Gewebetyp dem ihres Bruders ähnlich ist. Sollte das der Fall sein, erfolgt ein kleiner Eingriff, von dem sie sich schnell wieder erholen wird. Für ihren Bruder könnte das aber ein zweites Leben bedeuten.«
»Was ist mit Dieter?«
Erschrocken blickten Dr. Daniel und Hedwig Krause auf. Cornelia stand in der geöffneten Tür, und es war klar, daß sie die letzten Worte gehört hatte. Dr. Daniel sah Hedwig an, doch sie schüttelte den Kopf.
»Ich kann es nicht«, flüsterte sie.
Da stand Dr. Daniel auf und ging zu dem jungen Mädchen. Fürsorglich nahm er es beim Arm.
»Bitte, setzen Sie sich. Ihre Mutter hat Ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen.« Dann wandte er sich Hedwig zu und fügte leise hinzu: »Die Wahrheit kann der Liebe nichts anhaben, nur Lügen können sie zerstören.«
*
Völlig apathisch lag Franz Baumgartner im Bett. Seit zwei Tagen hatte er große Schmerzen, und er wußte, daß das der Anfang vom Ende war… einem unvermeidlichen Ende.
Vor wenigen Stunden hatte Annemarie angerufen und gesagt, daß sie stationär in der Waldsee-Klinik lag und das Bett nicht verlassen dürfe, um ihr Baby nicht zu gefährden. Die drohende Fehlgeburt war nur um Haaresbreite verhindert worden. Annemarie hatte auch gesagt, daß sich Dr. Daniel um ihre Verlegung in die Thiersch-Klinik bemühen wolle, doch Franz hatte das Gefühl, als würde Annemarie nicht mehr rechtzeitig hierherkommen. Er würde dazu verurteilt sein, allein zu sterben.
In diesem Moment klopfte es zaghaft an seiner Zimmertür, dann trat ein hübsches junges Mädchen ein. Franz richtete sich ein wenig auf.
»Conny.« Er war sichtlich überrascht, die Schwester seines besten Freundes zu sehen. »Du besuchst mich?«
Mit ernstem Gesicht trat sie an sein Bett, dann griff sie nach seiner Hand.
»Franzl«, flüsterte sie. »Mutti… sie hat mir alles erzählt…«
Verständnislos runzelte Franz die Stirn. »Was hat sie dir erzählt?«
Sehr sanft berührte Cornelia sein schmales, blasses Gesicht. »Unsere Mutter konnte uns nicht ernähren, deshalb hat sie mich weggegeben und dir gesagt, ich wäre gestorben.« Sie beugte sich über ihn und küßte seine Wange. »Franzl, ich bin in Wahrheit nicht Dieters Schwester, sondern deine.«
»Meine…«, stammelte Franz. »Conny… das ist… o mein Gott…«
Sanft legten sich ihre Hände um sein Gesicht, dann lächelte sie.
»Jetzt wird alles wieder gut«, versprach sie leise. »Professor Thiersch hat den Test schon gemacht. Ich werde dir das Knochenmark spenden, das du brauchst, um gesund zu werden. Du wirst leben, Franzl…«
*
Die Sprechstunde bei Dr. Daniel war zu Ende, doch er saß noch am Schreibtisch, um ein paar Dinge aufzuarbeiten, die den ganzen Tag über liegengeblieben waren. Ein leises Klopfen an der Tür schreckte ihn auf.
»Ja, bitte!« rief er.
Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen traten Franz Baumgartner, seine Verlobte Annemarie und seine Schwester Cornelia ein.
»Wir hätten es nicht gewagt, Sie so zu überfallen«, verwahrte sich Franz sofort. »Aber Ihre Frau hat gemeint, Sie würden sich freuen.«
Rasch kam Dr. Daniel um seinen Schreibtisch herum. »Und wie ich mich freue! Seit wann sind Sie nicht mehr in der Klinik?«
»Ich wurde heute entlassen«, antwortete Franz. »Professor Thiersch sagt, ich wäre gesund, und da meine Annemie jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit im Bett liegen muß, haben sie und Conny mich abgeholt.«
Dr. Daniel betrachtete das glückliche Trio. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß alles so gut ausgegangen ist.« Er drohte Franz und Annemarie mit dem Finger. »Aber muten Sie sich ja noch nicht zuviel zu.«
»Keine Sorge, Herr Doktor, ich werde auf die beiden gut aufpassen«, versprach Cornelia, schmiegte sich kurz an ihren Bruder und fuhr dann fort: »Bis zur Geburt von Annemaries Baby ziehe ich zu ihr, damit sie sich nicht überanstrengt. Und Mutti wird sich um Franz kümmern.« Ihr Gesicht wurde ernst. »Sie hat ja jetzt niemand mehr, weil Dieter doch im Gefängnis sitzt.«
Dr. Daniel war sichtlich überrascht. »Davon weiß ich nichts.«
Auch Franz war jetzt sehr ernst geworden. »Er hätte mich sterben lassen, obwohl er wußte, daß Conny meine Schwester ist und ich nur mit ihrer Hilfe gerettet werden konnte.« Er senkte den Kopf. »Sie können sich nicht vorstellen, wie tief mich das getroffen hat. Solange ich denken kann, hielt ich Dieter für meinen besten Freund. Plötzlich festzustellen, daß er in Wirklichkeit gar kein Freund war… daß er mir den Tod gewünscht hat, um mit Annemarie glücklich zu werden… nein, um mit dem Geld glücklich zu werden, das sie einmal bekommen wird…« Er konnte nicht weitersprechen.
»Dafür hätte er nicht belangt werden können«, fuhr Annemarie fort. »Der Grund für seine Inhaftierung liegt in den zweifelhaften Geschäften, in denen er seine Finger hatte. Es ging um Betrug, Hehlerei und noch andere kriminelle Dinge.« Sie griff nach Franz’ Hand. »Nein, Dieter war leider nicht der Freund, für den wir alle ihn hielten.«
Dr. Daniel war schockiert. Es war für ihn unbegreiflich, wie ein Mensch so etwas tun konnte. Doch als er sich wieder gefangen hatte, versuchte er auch die drei jungen Menschen wieder auf andere Gedanken zu bringen.
»Wie wird es jetzt weitergehen?« wollte er wissen.
»Mutti und ich ziehen nach Steinhausen«, antwortete Cornelia und strahlte dabei vor lauter Glück.
»Annemie und ich werden auf das Baby warten und dann heiraten«, fügte Franz hinzu. »Wir wollen die Schwangerschaft nicht durch den Hochzeitsstreß gefährden.«
»Wenn es soweit ist, möchten wir Sie gern als Taufpaten für unser Kind«, fuhr Annemarie fort.
»Und Gerrit als Trauzeugen«, ergänzte Franz. »Ihnen beiden und Professor Thiersch verdanken wir so viel… ich sogar mein Leben.« Er lächelte. »Ich habe den Professor mit viel gutem Zureden soweit gebracht, zu unserer Hochzeit zu kommen.«
Dr. Daniel schmunzelte, weil er sich lebhaft vorstellen konnte, wie vehement sich Professor Thiersch gegen diese Einladung gewehrt hatte.
»Da können Sie sich glücklich schätzen«, meinte er. »Der Professor verabscheut jegliche Art Festlichkeit. Da gerät er nämlich immer in Gefahr, zuviel Herz zu zeigen.«
Sie plauderten noch ein wenig, dann verabschiedeten sich Franz, Annemarie und Cornelia von Dr. Daniel, und als sie auf dem Patientenparkplatz ins Auto stiegen und losfuhren, sah der Arzt ihnen nach.
Wie schlimm hatte alles für diese jungen Menschen ausgesehen. Doch jetzt lag das Leben in leuchtenden Farben vor ihnen, und Dr. Daniel konnte sich von ganzem Herzen mit ihnen freuen…
– E N D E –