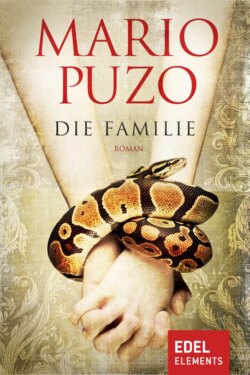Читать книгу Die Familie - Mario Puzo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеAls Kardinal Rodrigo Borgia als Papst Alexander VI. den Heiligen Stuhl bestieg, wusste er, dass er zunächst auf den Straßen Roms Ordnung schaffen musste. Während der Zeit zwischen dem Tod Papst Innozenz’ und seiner eigenen Krönung hatten in der Stadt mehr als zweihundert Morde stattgefunden. Dieser Gesetzlosigkeit musste Einhalt geboten werden. Als ihr Heiliger Vater musste er an den Sündern ein Exempel statuieren, denn wie sonst konnten die guten Seelen der Stadt in Frieden zu ihren Gebeten zurückkehren?
Der erste Mörder wurde ergriffen und auf der Stelle gehängt. Nicht nur das, auch sein Bruder wurde gehängt. Und als größte Demütigung, die einem Bürger Roms widerfahren konnte, wurde überdies auch sein Haus dem Erdboden gleichgemacht und somit seinem Haushalt das Dach über dem Kopf genommen.
Innerhalb weniger Wochen war auf den Straßen Roms die Ordnung wiederhergestellt, und die Bürger schätzten sich glücklich, dass die Tiara auf einem so starken und weisen Kopf gelangt war. Jetzt war die von den Kardinälen getroffene Wahl auch die Wahl des Volkes.
Aber Alexander hatte noch andere Entscheidungen zu treffen und zwei sehr wichtige Probleme zu lösen, von denen keines ein geistliches war. Vor allem hatte er die Aufgabe, ein Heer aufzustellen, um die katholische Kirche als weltliche Macht wiederherzustellen und die Kontrolle über den Kirchenstaat zurückzugewinnen; zweitens musste er für die Zukunft seiner Kinder sorgen.
Dennoch, wie er da nun auf seinem Thron im Saal des Glaubens im Vatikanpalast saß, grübelte er über die Wege Gottes, der Welt, der Nationen und Geschlechter. Dabei tauchten auch unmittelbare Probleme auf, deren er sich anzunehmen und die er zu lösen hatte. War er nicht Gottes unfehlbarer Stellvertreter hier auf Erden? Und musste er mithin nicht mit der ganzen Welt umgehen, den Nationen und ihren Königen, all den unabhängigen Städten Italiens, den Republiken und Oligarchien? Ja, sogar mit den erst jüngst entdeckten Westindischen Ländern. War er nicht verpflichtet, ihnen den besten Rat zu erteilen? Stellten sie eine Gefährdung der Herrschaft Gottes dar oder nicht?
Und wie stand es nun mit seiner eigenen Familie, den Borgias, den unzähligen Verwandten, die versorgt sein wollten, und mit seinen Söhnen und Töchtern, die ihm als sein eigen Fleisch und Blut verbunden, aber wegen ihrer ungestümen Leidenschaften nicht gehorsam waren. Wie sollte er es mit ihnen halten? Wo lag seine vornehmste Pflicht? Konnte er sowohl seinen Pflichten der Kirche und der Welt gegenüber als auch denen gegenüber seiner Familie genügen, ohne dass dabei die eine oder andere Seite zu kurz kam?
Schließlich erwog Alexander seine Pflicht gegenüber Gott. Diese war klar. Er musste die Kirche stärken. Die Erinnerung an das große Schisma, die Zeit, da es zwei Päpste und zwei Kirchen gegeben hatte, beide schwach, bestärkte ihn in dieser Gewissheit.
Die Städte Italiens, die der Kirche gehörten, wurden jetzt von Tyrannen regiert, die mehr darauf bedacht waren, ihre Familien zu bereichern, als der Kirche Steuern abzuführen. Die Könige hatten die Kirche als Werkzeug benutzt, um Macht für sich selbst zu gewinnen. Die Aufgabe, auf die Errettung der unsterblichen Seelen der Menschen hinzuarbeiten, war vergessen. Selbst die reichen Könige von Spanien und Frankreich enthielten der Kirche die Abgaben vor, wenn sie mit dem Papst unzufrieden waren. Sie wagten das! Was, wenn die Heilige Kirche ihrer Herrschaft den Segen entzog? Denn schließlich gehorchte doch wohl das Volk den Königen, weil diese als Gesalbte Gottes galten, und ihre Salbung bestätigen konnte allein der Stellvertreter Christi auf Erden, das Haupt der Kirche, der Papst. Alexander wusste, dass er weiterhin die Macht der Könige von Frankreich durch die Macht der Könige von Spanien neutralisieren musste. Und daraus folgte, dass es nie wieder zu einem von den Königen einberufenen großen Konzil kommen durfte. Ebenso zwingend war die Folgerung, dass die Kirche und der Papst beträchtlicher weltlicher Macht bedurften. Kurzum, eines starken Heeres. Alexander erwog sorgfältig die Machtmittel, die ihm zu Gebote standen. Und entwickelte einen Plan.
Sofort nach seiner Krönung ernannte er seinen Sohn Cesare zum Kardinal. Schon als Kind hatte Cesare kirchliche Pfründen erhalten und hatte als Bischof ein Einkommen von Tausenden von Dukaten. Cesare war, obwohl erst siebzehn und noch voller jugendlicher Leidenschaften und Laster, doch an Leib und Seele schon ein erwachsener Mann. Er hatte ein Studium der Rechte und der Theologie an den Universitäten von Perugia und Pisa hinter sich, seine Disputation war eine der glänzendsten, die man je gehört hatte. Allerdings galt seine Vorliebe dem Studium der Kriegsgeschichte und der Strategie. Er hatte bereits Erfahrung gesammelt, da er schon an verschiedenen kleineren Gefechten teilgenommen und sich bei einem ausgezeichnet hatte. So war sein Interesse an der Kriegskunst nicht nur theoretisch.
Gott hatte diesen Sohn Alexanders gesegnet mit wachem Verstand, festem Willen und mit jener natürlichen Grausamkeit, ohne die man in dieser bösen Welt nicht überleben kann.
Cesare Borgia erhielt die Nachricht, dass er zum Kardinal der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche ernannt worden war, als er noch an der Universität Pisa kanonisches Recht studierte. Die Ernennung kam nicht unerwartet, denn er war ja der Sohn des neuen Papstes. Aber Cesare Borgia freute sich nicht über die Erhebung. Gewiss, sie würde ihn bereichern, aber er war im Herzen Soldat, wünschte, Truppen in die Schlacht zu führen, Burgen zu stürmen, Festungen zu überwinden und Städte einzunehmen. Und er wollte auch heiraten und Kinder haben, die nicht Bastarde wären wie er selbst. Zudem zürnte er seinem Vater immer noch, weil dieser ihn nicht zu seiner Krönung eingeladen hatte.
Seine beiden engsten Freunde und Kommilitonen, Gio Medici und Tila Baglioni, gratulierten ihm und bereiteten für den Abend ein Fest vor, denn in der folgenden Woche würde er zu seiner Investitur nach Rom abreisen müssen.
Gio war bereits mit dreizehn zum Kardinal ernannt worden, denn sein Vater war der Herrscher in Florenz, der große Lorenzo »der Prächtige«. Tila Baglioni hatte als Einziger der drei kein geistliches Amt, doch war er einer der Erben des Herzogtums Perugia. Hier, an der Universität von Pisa, waren sie vor allem temperamentvolle Studenten mit Bediensteten und Leibwächtern, obwohl sie alle drei in der Lage waren, sich selbst zu verteidigen. Cesare war ein geschickter Fechter mit dem Schwert, der Axt und dem Jagdspieß, wenn er auch noch keine volle Kriegsrüstung besaß. Er war von unerhörter körperlicher Kraft und größer als die meisten Männer. Dabei war er ein glänzender Student, der Stolz seiner Professoren. Aber von einem Sohn des Papstes war das zu erwarten.
Auch Gio war ein guter Student, aber körperlich nicht sonderlich beeindruckend. Er war geistreich, hütete sich aber, seine beiden Freunde mit seinem Witz zu behelligen. Cesare war schon mit siebzehn sehr einschüchternd und Tila Baglioni war für seine grausamen Wutausbrüche bekannt, zu denen er sich hinreißen ließ, wenn er argwöhnte, beleidigt worden zu sein.
An jenem Abend feierten sie in der Villa der Familie Medici vor den Toren von Pisa Cesares Ernennung. Da die Würde, zu der Cesare gelangte, die eines Kirchenfürsten war, ließ man eine gewisse Diskretion walten. Es war ein intimes Zusammensein mit nur sechs Kurtisanen. Auch bei Tisch vermied man ausschweifende Üppigkeit, es gab Hammelbraten, Wein, Süßigkeiten und leichte, angenehme Unterhaltung.
Sie gingen früh zu Bett, denn man hatte beschlossen, dass am folgenden Tag, ehe jeder die Heimreise antrat, Cesare Borgia nach Rom und Gio Medici nach Florenz, alle mit Tila Baglioni nach Perugia reiten würden, wo ein großes Fest bevorstand. Tilas Vetter sollte Hochzeit feiern und seine Tante, die Herzogin Atalanta Baglioni, hatte ihm eine besondere Einladung zu dieser Hochzeit geschickt. Er hatte gespürt, dass ihr sein Kommen wichtig war, und hatte zugesagt.
Am nächsten Morgen machten sich die drei also auf den Weg nach Perugia. Cesare ritt sein schönstes Pferd, ein Geschenk Alfonsos, des Herzogs von Ferrara. Gio Medici ritt ein weißes Maultier, denn er war kein besonders guter Reiter. Tila Baglioni, der großen Wert darauf legte, den Leuten Respekt einzuflößen, ritt ein Schlachtross, dessen Ohren man gestutzt hatte, um ihm ein wildes und grausames Aussehen zu verleihen. Pferd und Reiter wirkten überwältigend. Keiner trug Rüstung, obwohl alle drei mit Degen und Dolchen bewaffnet waren. Sie hatten dreißig Mann Gefolge, bewaffnet und leicht gerüstet. Das waren Cesares Leute, die auch seine Farben trugen, gelb und scharlachrot.
Von Pisa aus liegt Perugia am Wege nach Rom, nur weiter landeinwärts. Die Baglionis und Perugia legten großen Wert auf ihre Unabhängigkeit, obgleich der Papst auf der Zugehörigkeit der Stadt zum Kirchenstaat bestand. Wegen der daraus resultierenden Spannungen hätte Cesare wohl nicht gewagt, Perugia zu besuchen, hätte nicht Tila für seine Sicherheit gebürgt, obwohl er durchaus auch glaubte, sich auf seinen Verstand und die eigenen Kräfte verlassen zu dürfen. Aber gleichviel, jetzt kam er in Gesellschaft des Neffen der Herzogin und freute sich auf die Vergnügungen des Hochzeitsfestes, die er zu genießen gedachte, ehe er seinen Pflichten in Rom nachkommen musste.
Perugia war eine Stadt in abschreckender und schöner Lage zugleich. Die Festung der Stadt auf einem hohen Felsen war fast uneinnehmbar.
Als die drei jungen Männer in die Stadt einritten, fanden sie dort alle Kirchen und Paläste für die Hochzeit geschmückt, die Statuen in Goldbrokat gewandet. Cesare plauderte vergnügt mit seinen Reisegefährten und machte sogar Späße, achtete aber insgeheim genau auf die vorhandenen Befestigungsanlagen und überlegte, wie er vorgehen würde, um die Stadt zu stürmen.
Herrscherin von Perugia war damals die verwitwete Herzogin Atalanta Baglioni. Sie war noch immer eine schöne Frau, berühmt jedoch war sie für die Grausamkeit ihres Regiments; ihr Sohn Netto diente ihr dabei als Feldhauptmann. Es war ihr Herzenswunsch, ihren Neffen Torino mit Lavina, einer ihrer Hofdamen, zu verheiraten. Auf Torino, meinte sie, könnte sie zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der Baglionis zählen.
Alle Zweige der riesigen Baglioni-Sippe waren im Schlosshof versammelt. Musikanten spielten auf, es wurde getanzt. Es gab auch Ringkämpfe und Lanzenbrechen. Cesare, der auf seine Kraft stolz war, nahm alle Herausforderungen an und gewann sämtliche Wettkämpfe.
Bei Einbruch der Nacht begaben sich die Baglionis zur Ruhe in die Festung. Gio, Cesare und Tila saßen bei einem letzten Krug Wein in Tilas Gemächern zusammen.
Es war fast Mitternacht und der Wein machte sie schläfrig, als plötzlich Schreie und Rufe in der Burg sie aufschrecken ließen. Tila sprang auf, den Degen gezückt, und wollte dem Geschrei nachlaufen. Cesare aber hielt ihn zurück und sagte: »Sehen wir erst mal, was los ist. Du bist vielleicht in Gefahr. Ich komme gleich wieder.«
Als Cesare die Schreie gehört hatte, war ihm klar gewesen, dass irgendein Verrat stattgefunden hatte. Er hatte einen Riecher für dergleichen. Er ließ das Schwert an seiner Seite, als er Tilas Gemächer verließ. Denn er wusste, dass die Baglionis, so berüchtigt sie auch sein mochten, es nicht wagen würden, den Sohn des Papstes zu töten. Cesare ging ruhig die Gänge der Burg entlang in Richtung des anhaltenden Geschreis. So gelangte er schließlich vor das Brautgemach.
Überall war Blut. Die Statue der Jungfrau Maria, das Bild des Jesuskindes, die weißen Laken und Kissenbezüge des Hochzeitsbettes – selbst der Betthimmel waren blutbespritzt. Und am Boden lagen die Leichen des Brautpaares, Lavina und Torino, ihre Nachthemden zerschlitzt und blutgetränkt, sie selbst durchbohrt, tödliche Wunden an Kopf und Körper.
Über ihnen stand Netto mit vier Bewaffneten, alle mit blutigen Schwertern. Sie standen Nettos Mutter Atalanta gegenüber, der Herzogin, die ihren geliebten Sohn schreiend verfluchte. Netto versuchte, sie zu beruhigen. Cesare konnte alles mit anhören.
Der Sohn erklärte seiner Mutter: »Mama, Torino war zu mächtig und seine Familie wollte dich stürzen. Ich habe alle Mitglieder seiner Sippe getötet.« Dann versicherte er seiner Mutter begütigend, dass er sie zwar absetzen und nun selbst die Regierung übernehmen müsse, es aber an der schuldigen Achtung ihr gegenüber niemals fehlen lassen werde.
»Verrat eines Sohnes«, schrie die Herzogin ihn an.
»Mach doch die Augen auf, Mama. Nicht nur Torino, sondern auch Vetter Tila hat sich gegen dich verschworen.« Cesare hatte genug gehört. Er verließ den Raum und kehrte eilig in Tilas Gemächer zurück.
Tila war außer sich vor Zorn, als er hörte, was vorgegangen war. »Klatsch und Tratsch, das ist alles!«, schrie er. »Dieser Vetter von mir, dieser Bastard Netto, versucht seiner eigenen Mutter die Krone zu stehlen. Und überdies hat er bereits einen Plan, auch mich zu ermorden!«
Cesare, Tila und Gio verbarrikadierten die Tür und stiegen dann aus dem Fenster auf das Dach des Palastes und von dort an den rauen Stein wänden in die Tiefe. Cesare und Tila sprangen zuletzt in den dunklen hinteren Hof hinab und halfen dann dem körperlich nicht so starken Gio. Als sie dann alle unten waren, musste Cesare Tila davon abhalten, in die Burg zurückzukehren, um sogleich den Kampf mit Netto aufzunehmen. Schließlich führte er die Freunde auf das Feld, wo sein Gefolge lagerte und er sich inmitten von dreißig Bewaffneten in Sicherheit fühlen durfte. Die Frage war jetzt nur, was er mit Tila machen sollte. Sollte er gleich hier für das Leben und die Sicherheit seines Freundes kämpfen oder ihn zunächst nach Rom in Sicherheit bringen?
Cesare bot Tila an, unter den genannten Alternativen zu wählen, aber Tila lehnte sie alle ab und bat ihn nur, ihm zu helfen, in den Gemeindepalast in der Mitte der Stadt zu gelangen. Dort würde er seine eigenen Anhänger um sich scharen, die seine Ehre verteidigen und die Burg ihrer legitimen Herrin zurückerobern würden.
Cesare stimmte diesem Plan zu, kommandierte aber zehn von seinen Leuten dazu ab, Gio Medici sicher nach Florenz zu begleiten. Mit den übrigen zwanzig eskortierte er Tila Baglioni in den Gemeindepalast.
Dort trafen sie vier bewaffnete Männer, bei denen es sich um treue Parteigänger Tilas handelte. Tila schickte sie alsbald mit Botschaften los, und als der Morgen graute, befehligte Tila bereits eine Truppe von über hundert Mann.
Bei Sonnenaufgang sahen sie eine von Netto angeführte Reiterschar Stellung auf dem Stadtplatz beziehen. Cesare befahl seinen Leuten, strikteste Neutralität zu wahren. Dann sahen sie zu, wie Tila den Platz von seinen Leuten umzingeln ließ und dann selbst auf Netto zuritt.
Der Kampf war schnell vorüber. Tila sprengte direkt auf Netto los, packte seinen Schwertarm und durchbohrte seinen Schenkel mit dem Dolch. Netto fiel vom Pferd. Tila stieg ab und spießte ihn mit dem Schwert auf, ehe er sich erheben konnte. Nettos Soldaten versuchten zu entfliehen, wurden aber gefangen genommen. Dann stieg Tila wieder auf sein Schlachtross mit den gestutzten Ohren und befahl den Gefangenen, sich vor ihm aufzustellen.
Von Nettos Leuten waren nur fünfzehn Mann noch am Leben. Die meisten waren verwundet und konnten sich kaum noch auf den Beinen halten.
Cesare sah zu, wie die Gefangenen auf Tilas Befehl enthauptet und ihre Köpfe oben auf den Mauern der Kathedrale aufgespießt wurden. Tilas Verwandlung überraschte ihn. Von einem Tag zum anderen war aus dem großsprecherischen, ungehobelten Studenten ein Krieger und gnadenloser Blutrichter geworden. Der gerade siebzehnjährige Tila Baglioni war der »Tyrann von Perugia« geworden.
Als Cesare in Rom ankam und seinen Vater traf, erzählte er diesem die Geschichte und fragte dann: »Wenn die Jungfrau Maria die Lieblingsheilige der Leute von Perugia ist, warum sind sie dann so unbarmherzig?«
Papst Alexander lächelte und die Geschichte schien ihn mehr zu amüsieren als zu erschrecken. »Die Baglionis sind wahre Gläubige. Sie glauben an das Paradies. Eine wahrhaft beneidenswerte Begabung. Denn wie sonst kann der Mensch dieses sterbliche Leben ertragen? Unglücklicherweise ziehen auch böse Menschen aus diesem Glauben die Kraft und den Mut zu großem Verbrechen im Namen des Guten und des gütigen Gottes.«
Papst Alexander liebte den Luxus nicht um seiner selbst willen. Sein Palast, der Vatikan, sollte die allumfassende Seligkeit beschwören, die den Himmel spiegelte. Er verstand, dass selbst geistlich hochstehende Menschen von solcher irdischen Pracht beeindruckt waren, welche die katholische Kirche als Repräsentantin Gottes auf Erden entfaltete. Das gewöhnliche Volk nahm selbstverständlich den Papst als Stellvertreter Christi an, als eine unfehlbare Autorität und ehrwürdige Gestalt, doch Könige und Fürsten neigten in dieser Hinsicht eher zu Zweifeln.
Diese Männer vornehmen Standes, aber schwächeren Glaubens, mussten von Gold und Edelsteinen überzeugt werden; von der riesigen Mitra, die der Papst auf dem Kopf trug, von dem reichen Gewebe der päpstlichen Gewänder, von den goldenen und silbernen Stickereien seines Messgewands und seines Mantels, von diesen Stücken, die schon seit Jahrhunderten bewahrt und liebevoll überliefert wurden und über alle Vorstellungen hinaus kostbar und wertvoll waren.
Da war der große Saal der Päpste, Tausende von Quadratmetern reich verzierter Wände und wunderbar bemalter Decken, die den Tugendhaften die ewige Seligkeit verhießen. In diesem Saal empfing der Papst die Wallfahrer, die aus ganz Europa zu ihm pilgerten, Dukaten in den Händen und Bitten um vollständigen Ablass auf den Lippen. Hier gab es Bildnisse berühmter Päpste, die große Könige krönten, wie etwa Karl den Großen, oder auch Kreuzzüge anführten und die Madonna anflehten, sich für die Menschheit zu verwenden.
Bei all diesen Gemälden war deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die dargestellten großen Könige ihre Macht dem Papst schuldeten, der sie salbte. Er war ihr irdischer Erlöser. Die Könige knieten mit gesenkten Häuptern vor dem Papst, dessen Augen zum Himmel erhoben waren.
In seine Privatgemächer, die am Vorraum dieses großen Saals des Vatikan lagen, rief Alexander nun seinen Sohn Juan. Es galt, ihn darauf hinzuweisen, dass es für ihn an der Zeit war, seine Rolle als Angehöriger des spanischen Hochadels anzunehmen.
Juan Borgia war fast so groß wie Cesare, jedoch schlanker von Gestalt. Wie sein Bruder und Vater war auch er ein anziehender Mann, aber auf andere Weise als diese. Er hatte die leicht schräg gestellten Augen und hohen Backenknochen seiner spanischen Ahnen, der Conquistadoren. Seine Haut war gebräunt von vielen Stunden auf dem Rücken der Pferde und der Jagd nach Hirschen und Keilern, aber da seine weit auseinander stehenden Augen oft den stechenden Blick des Misstrauens zeigten, fehlte ihm der Zauber, der Alexander und auch Cesare auszeichnete. Seine dunklen Lippen kräuselte oft ein zynisches Lächeln, allerdings nicht in diesem Augenblick, da er vor seinem Vater niederkniete.
»Womit kann ich Ihnen dienen, Papa?«, fragte er.
Alexander lächelte seinen Sohn liebevoll an. Denn vor allem dieser junge Mann bedurfte wie jene verirrten und verwirrten Seelen seiner Anleitung und Führung. »Es ist nun an der Zeit, dass du die Verantwortung übernimmst, die dir dein Halbbruder Pedro Luis bei seinem frühen Tode hinterlassen hat. Wie dir schon früher gesagt worden ist, hat er dir sein Herzogtum und den Titel des Herzogs von Gandia hinterlassen. Zur Zeit seines Todes war er verlobt mit Maria Enriquez, einer Cousine König Ferdinands von Spanien, und ich als dein Vater – und überdies Heiliger Vater – habe beschlossen, dich an Stelle des Verstorbenen dieses Eheversprechen einlösen zu lassen, um unser Bündnis mit dem erst jüngst vereinigten Spanien zu festigen und das Haus Aragonien unserer Freundschaft zu versichern. Deshalb wirst du schon bald nach Spanien reisen, um deine königliche Braut aus den Händen ihres Vaters zu erbitten. Verstehst du?«
»Ja, Papa«, antwortete Juan ziemlich mürrisch.
»Bist du über diese meine Entscheidung unglücklich?«, fragte der Papst. »Sie bringt uns und auch dir persönlich Vorteile. Die Familie ist reich und von hohem Stand, und wir werden aus unserer Verbindung mit ihr politischen Gewinn ziehen. Es steht zudem ein großes spanisches Schloss in Gandia, und es gehören viele reiche Ländereien dazu, die dir nun alle zufallen werden.«
»Werde ich Reichtümer haben, die ich mitnehmen kann, sodass sie sehen, dass auch ich respektiert werden muss?«, fragte Juan.
Alexander runzelte die Stirn. »Wenn du respektiert werden willst, musst du fromm und gottesfürchtig sein. Du musst dem König treu dienen, deine Frau ehren und das Glücksspiel meiden.«
»Ist das alles, Vater?«, fragte Juan sardonisch.
»Wenn noch etwas dazu kommt, lasse ich dich rufen«, sagte Papst Alexander knapp. Er war nur selten böse auf diesen Sohn, aber im Augenblick war er äußerst ungehalten. Er versuchte sich vorzuhalten, dass Juan schließlich noch ein Junge war und kein Gespür für Diplomatie hatte. Als Alexander erneut zum Reden ansetzte, klang eine etwas gezwungene Wärme aus seiner Stimme. »Inzwischen freue dich deines Lebens, mein Sohn. Es wird ein großes Abenteuer sein und sich sehr für dich lohnen, wenn du es nur richtig angehst.«
An dem Tag, an dem Cesare Borgia zum Kardinal der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche ordiniert werden sollte, war die riesige Kapelle der Peterskirche überfüllt von nach der letzten Mode gekleideten Angehörigen der besten Gesellschaft. Alle großen Adelsfamilien Italiens waren zugegen.
Aus Mailand war der dunkelhäutige Ludovico Sforza gekommen – Il Moro (der Mohr) – sowie dessen Bruder Ascanio. Ascanio Sforza, nun Alexanders Vizekanzler, trug die aus prächtigem elfenbeinfarbenem Brokat geschneiderten Gewänder seines hohen kirchlichen Amts und den roten Kardinalshut. Sein Erscheinen in der überfüllten Basilika verursachte ein allgemeines Raunen.
Aus Ferrara kam eine der vornehmsten und konservativsten Familien Italiens, die d’Estes. Ihre einfachen schwarzen und grauen Roben brachten das Funkeln der Juwelen an ihren Hälsen gut zur Geltung. Sie hatten die beschwerliche Reise nach Rom gemacht, nicht nur um Respekt zu erweisen, sondern womöglich auch die Gunst des Papstes und des neuen Kardinals zu gewinnen, die sie brauchten.
Aber keiner zog die Blicke der Menge so magnetisch an wie der junge Mann, der ihnen folgte. Piero Medici aus der berühmten Stadt Florenz, eine ehrwürdige und autokratische Erscheinung, trug ein smaragdgrünes Wams, bestickt mit phantastischen Feuerrädern aus 22-karätigem Gold, das sich leuchtend auf seinem Gesicht spiegelte und ihn fast heilig erscheinen ließ. Er führte eine Delegation von sieben seiner stolzen Verwandten, darunter sein Bruder, Cesares guter Freund Gio Medici, den langen Mittelgang entlang. Piero war jetzt in Florenz an der Macht, aber es wurde gemunkelt, dass schon beim Tode seines Vaters, des als »der Prächtige« berühmten Lorenzo, die Stadt begonnen hatte, der Kontrolle der Familie zu entgleiten. Man sagte, dass es nicht mehr lange dauern würde, ehe dieser junge Fürst gestürzt werden und es mit der Herrschaft der Medici in Florenz vorbei sein würde.
Aus der Stadt Rom selbst waren sowohl die Orsinis als auch die Colonnas gekommen. Jahrzehntelang hatten sich die Rivalen erbittert bekämpft, gegenwärtig herrschte Frieden, oder gab es mindestens eine Art Waffenstillstand zwischen ihnen. Sie ließen dennoch die Vorsicht walten, auf entgegengesetzten Seiten der Basilika Platz zu nehmen. Bei einer früheren Kardinalsinvestitur war nämlich ein blutiger Streit zwischen den Orsinis und den Colonnas ausgebrochen.
In der ersten Reihe sprach Guidobaldo di Montefeltro, der mächtige Herzog von Urbino, leise mit dem gewitztesten Gegner des regierenden Papstes, dem Kardinal Giuliano della Rovere, Neffe des verstorbenen Papstes Sixtus IV. und jetzt päpstlicher Legat in Frankreich.
Montefeltro beugte sich näher zu dem Kardinal und flüsterte: »Ich vermute, dass unser Cesare mehr das Zeug zum Soldaten hat als zum Gelehrten. Der Junge könnte eines Tages ein großer General sein, müsste er nicht Papst werden.«
»Wie sein Vater ist er über fleischliche Gelüste nicht gerade erhaben. Und auch in anderer Hinsicht anscheinend ein ziemlicher Rabauke. Kämpft mit Stieren und ringt auf Jahrmärkten mit Bauern. Alles sehr ungehörig«, äußerte Rovere ärgerlich.
Montefeltro nickte. »Ich höre, dass sein Pferd gerade den Palio in Siena gewonnen hat.«
Kardinal della Rovere blickte verärgert. »Das war Schiebung. Er ließ den Reiter kurz vor dem Ziel abspringen und das erleichterte das Pferd, sodass es schneller wurde. Der Sieg wurde natürlich angefochten. Allerdings vergeblich.«
Montefeltro lächelte. »Erstaunlich ...«
Aber della Rovere runzelte die Stirn. »Hört meine Warnung, Guido di Montefeltro. Er hat den Teufel im Leib, dieser Sohn der Kirche.«
Giuliano della Rovere war jetzt ein erbitterter Feind der Borgias. Was ihn noch mehr erbitterte als seine Wahlniederlage, war, dass Papst Alexander jüngst so viele von den Parteigängern der Borgias zu Kardinälen ernannt hatte. Dennoch durfte er der Zeremonie natürlich nicht fernbleiben. Und so nahm er daran teil; den Blick allerdings fest auf seine Zukunft gerichtet.
Am Altar stand Papst Alexander VI., eine ehrfurchtgebietende Erscheinung, groß, breitschultrig und charismatisch. Die dramatische Einfachheit seiner weißen Gewänder mit den scharlachroten und goldenen Glanzlichtern seiner Stola (opus anglicanum) zog alle Blicke auf sich. In diesem Augenblick leuchteten seine Augen vor Stolz und Selbstgewissheit; hier regierte er, allein und unfehlbar, aus diesem festen Gotteshaus, das hier vor Jahrhunderten über dem Grabe des Apostel Petrus errichtet worden war.
Als von der mächtigen Orgel ein brausendes Te Deum ertönte – die Lobeshymne zu Ehren des Herren –, trat Alexander vor. Er hob mit beiden Händen seinen roten Kardinalshut hoch und setzte ihn dann, mit einem sonoren lateinischen Segensgesang, seinem vor ihm knienden Sohn aufs Haupt.
Cesare Borgias Augen blieben fromm gesenkt, solange er den heiligen Segen empfing. Dann erhob er sich und richtete seine stolze und beeindruckende Gestalt zu voller Größe auf, als ihm zwei alte Kardinäle das purpurne Gewand auf die Schultern legten. Danach trat er vor und stellte sich neben den Papst. Die beiden heiligen Männer standen der Gemeinde gegenüber.
Cesare war dunkel und sehr kräftig gebaut. Er war sogar noch größer als sein massiger Vater, mit eckigem Gesicht und hohen Backenknochen. Seine lange Adlernase war so fein wie die einer Marmorskulptur und aus seinen dunkelbraunen Augen strahlte Intelligenz. Die Menge wurde still.
Auf der letzten Bank der Basilika saß allein ein sehr beleibter Mann, der reich in Weiß und Silber gekleidet war: Gaspare Malatesta, der »Löwe von Rimini«, war anwesend. Er hatte mit diesem spanischen Papst ein Hühnchen zu rupfen – wegen eines Jungen, den man ihm gefesselt und ermordet ins Haus geschickt hatte. Was kümmerte ihn ein Papst oder die Drohungen eines Papstes? Nichts! Was kümmerte ihn Gott? Auch nichts! »Der Löwe« glaubte an nichts von alledem. Alexander war nichts als ein Mensch. Und Menschen sind sterblich. »Der Löwe« erinnerte sich bei dieser feierlichen Gelegenheit gerne, wie er seinerzeit, zur Fastenzeit, Tinte in das Weihwasser gegossen hatte, um die feinen Kleider des Kardinals und seiner Gäste zu besudeln und sie alle auf den Boden der Tatsachen herunterzuholen. Diese Erinnerung erfreute ihn. Jetzt freilich hatte er Wichtigeres zu tun. Lächelnd lehnte er sich zurück. Hinter ihm im Schatten stand wachsam Don Michelotto. Und als die glorreichen Schlussakkorde des großen Te Deum zu einem ohrenbetäubenden Crescendo anschwollen, trat der kleine, kräftig gebaute Mann unbemerkt in den engen, unbeleuchteten Raum unmittelbar hinter Gaspare Malatesta. Geräuschlos warf er Gaspare eine Schlinge über den Kopf und zog diese mit einer einzigen Bewegung um den Hals des fetten Mannes zu.
Der »Löwe von Rimini« ächzte, der Strick schnitt ihm gnadenlos die Luft ab. Er versuchte, sich zu wehren, aber seine Muskeln, denen Blut und Sauerstoff verweigert wurden, zuckten nur kraftlos.
Die letzten Worte, die er hörte, ehe die Dunkelheit alle seine Gedanken auslöschte, war ein Flüstern an seinem Ohr: »Eine Botschaft vom Heiligen Vater.« Dann verschwand der Würger in der Menge, so schnell, wie er aufgetaucht war. Der von niemandem beobachtete Mord war in weniger als einer Minute erfolgt.
Papst Alexander VI. ging den Mittelgang der Basilika entlang, hinter ihm der neue Kardinal, sein Sohn Cesare, und diesem folgten seine Mutter Vanozza, seine Schwester Lucrezia und seine Brüder Juan und Jofre, sowie weitere Angehörige der Familie. Alle gingen an der letzten Bank vorbei, ohne etwas zu bemerken. Gaspare Malatestas Kinn ruhte auf seinem fetten Bauch, als schliefe er.
Schließlich blieben einige Frauen stehen und zeigten auf die komische Gestalt. Gaspares Schwägerin, der dieses Aufsehen sehr peinlich war und die glaubte, dass der Tyrann sich wieder einmal einen seiner antiklerikalen Späße erlaubte, beugte sich über ihn, um ihn wachzurütteln. Als Gaspares schwerer Leib in den Gang fiel und die vorquellenden Augen blind die wunderbare Decke der Basilika anstarrten, begann sie zu schreien.