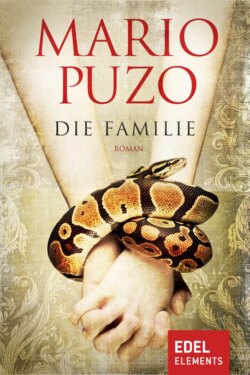Читать книгу Die Familie - Mario Puzo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechstes Kapitel
ОглавлениеLudovico Sforza, den man Il Moro nannte, den Mohren, hatte die Macht in dem großen Stadtstaat Mailand. Er war zwar nicht der Herzog, aber er herrschte dort. Sein schwacher und unfähiger Neffe Gian Galeazzo Sforza, der Inhaber des Titels, war es zufrieden, ihm die Regierungsgewalt zu überlassen.
Il Moro genoss die Achtung der Bürgerschaft, denn er war ein hochgewachsener eleganter Mann, hellblond, der Typus des Norditalieners, intelligent und an der Welt der Künste und des Geistes interessiert. Man hätte wohl behaupten können, dass die antike Mythologie seinem Herzen teurer war als die christliche Religion und dass er zuversichtlich und voller Selbstvertrauen nur so lange war, wie alles gut ging, während er in schwierigen Lagen in Gefahr war, den Mut zu verlieren. Im politischen Umgang war er manchmal skrupellos und oft suchte er seine Ziele mit Hilfe von Täuschungsmanövern zu erreichen. Trotzdem war er ein barmherziger Herrscher, dessen Mitgefühl den Bürgern von Mailand eine Steuer auferlegte, von deren Ertrag Wohnungen und Krankenhäuser für die Armen gebaut wurden.
In Mailand wurde die neue Kultur des Humanismus gepflegt, und Il Moro und Beatrice d’Este taten viel, die Stadt auf die Höhe der Zeit zu bringen. Sie ließen die Kastelle renovieren und ausschmücken, ließen die grauen Gemäuer der Häuser in den hellen Farben der neuen Kunst anmalen und sorgten für saubere Straßen, sodass man dort die Luft atmen konnte, ohne sich halbe Apfelsinen unter die Nase halten zu müssen. Er bezahlte Professoren für die hohen Schulen seines Staats, denn die große Bedeutung des Erziehungswesens für den Wohlstand im Lande war ihm bewusst.
Es war aber seine Frau, die schöne und ehrgeizige Beatrice d’Este aus Ferrara, die ihn drängte, Anspruch auf den Herzogtitel zu erheben. Denn Beatrice sah nicht ein, dass ihr Sohn den Titel nicht erben sollte.
Seit dreizehn Jahren regierte Ludovico ohne Widerspruch von Seiten seines Neffen und Mailand entwickelte sich zu einem Ort der Kunst und Kultur. Dann aber heiratete Gian Galeazzo eine heißblütige und eigenwillige junge Frau, Avia von Neapel, eine Enkelin des gefürchteten Königs Ferrante.
Avia war zwar noch jung, aber nicht gesonnen, sich in die gegebenen Verhältnisse zu schicken oder den Verlust des Herzogstitels hinzunehmen, denn sie hatte zwei Söhne, die sonst als gemeine Leute würden leben müssen.
Nachdem sie sich deswegen erfolglos bei ihrem Manne beschwert hatte, der seinerseits keinen Herrscher-Ehrgeiz hatte und ganz zufrieden war, seinen Onkel regieren zu lassen, wandte Avia sich mit ihren Klagen an ihren Großvater König Ferrante. Sie schrieb ihm einen Brief nach dem anderen, die ihm in Neapel durch tägliche Kuriere zugestellt wurden. Schließlich empörte sich Ferrante. Er war nicht geneigt, die andauernde Demütigung seiner Enkelin noch länger hinzunehmen. Und so beschloss er, an Mailand dafür Rache zu nehmen und sie auf den Thron zu setzen, auf den sie gehörte.
Ludovico Sforza jedoch wurde durch seine geheimen Berater davon unterrichtet, und da er König Ferrantes rücksichtslose Taktik zu fürchten gelernt hatte, ging er hinsichtlich seiner Aussichten bei einer Auseinandersetzung mit ihm noch einmal zu Rate. Die Stärke und Kriegstüchtigkeit der Streitkräfte Neapels war legendär, und so wusste er, dass Mailand ohne Bundesgenossen nicht standhalten konnte.
Just zu dieser Zeit erhielt er, wie einen Fingerzeig des wohlwollenden Himmels, die Nachricht, dass König Karl Anstalten machte, die Krone von Neapel für Frankreich zu fordern. Il Moro nahm die Gelegenheit wahr, schleunigst zu handeln, brach mit der Tradition, ausländischen Mächten die Einmischung in die inner-italienischen Angelegenheiten zu verwehren, und bot Karl freien Durchzug durch Mailand für die französischen Truppen an, die der König von Frankreich zur Eroberung Neapels nach Süden schickte.
Im Vatikan war Papst Alexander mit der Würdigung seiner politischen Lage befasst und erörterte seine Pläne mit Cesare, als Duarte Brandao die päpstlichen Gemächer aufsuchte, um den Heiligen Vater über die neueste, ihm drohende Gefahr zu unterrichten.
»Wie zu meiner Kenntnis gelangt ist«, erklärte Duarte, »hat Ferrante von Neapel sich bei König Ferdinand von Spanien bezüglich Ihres Bündnisses mit Il Moro und der Einstellung des Vatikan zu Mailand beklagt. Frankreich sei dabei, Truppen zu entsenden.«
Cesare nickte verständnisvoll. »Er wird von der Vermählung meiner Schwester mit Giovanni Sforza gehört haben. Und dieses Bündnis mit Mailand macht ihm Kummer.«
»Dazu hat er natürlich allen Grund. Aber wie hat der gute König Ferdinand darauf reagiert?«, fragte Alexander.
»Er hat sich fürs Erste geweigert, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen.«
Papst Alexander lachte. »Ein Ehrenmann. Er hat sich wahrscheinlich daran erinnert, dass ich ihm den päpstlichen Dispens überbrachte, der die Genehmigung erteilte, seine Cousine Isabella von Kastilien zur Frau zu nehmen. Diese Hochzeit hatte die Vereinigung von Kastilien und Aragonien zur Folge gehabt, aus der dann die spanische Großmacht erwuchs.«
»Es wäre wohl angezeigt, einen Gesandten nach Neapel zu schicken zum Zwecke der gütlichen Einigung ...«, regte Duarte an. »Und mit der Versicherung der Loyalität gegenüber Spanien und dem Hause Aragonien.«
Alexander stimmte zu. »Wir werden auch Ferrante ein Ehebündnis antragen. Warum sollte Mailand Neapel das voraus haben?«
Darauf sagte Cesare, nun unverhohlen vergnügt: »Zu meinem allergrößten Bedauern, Vater, kann ich in dieser Angelegenheit nicht zu Diensten sein. Denn ich bin Kardinal der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche.« Papst Alexander entsandte umgehend einen Botschafter an König Ferrante nach Neapel.
Spät in jener Nacht, als Alexander allein in seinen Gemächern war, starrte er in den dunklen Nachthimmel und dachte über die Menschen nach. Als Heiliger Vater kam er zu dem beklemmenden Schluss: dass die Furcht Menschen sogar dazu bringt, gegen die eigenen Interessen zu handeln. Sie verwandelt vernünftige Männer in greinende Narren, oder weshalb sonst würde sich Il Moro mit Frankreich verbünden, wo zu siegen er nicht die mindeste Chance hatte? Ahnte er nicht, dass, wenn erst ein Heer in die Stadt einzog, jeder Bürger in Gefahr war? Frauen, Kinder und Männer waren bedroht. Der Papst seufzte. Zu Zeiten wie dieser war ihm das Bewusstsein der eigenen Unfehlbarkeit ein wahrer Trost.
Selbst in den korruptesten Zeiten gibt es Leute, die bösartiger sind als ihre Mitmenschen. Die Grausamkeit pulsiert in ihren Herzen, weckt ihre Sinne und ist ihr Lebenselixier. Diese Leute haben dann eine Lust, ihre Mitmenschen zu quälen und zu foltern, die der normalen Menschen bekannten Liebeslust sehr ähnlich ist. Sie glauben an einen strafenden mächtigen Gott ihrer eigenen Erfindung und schaffen mit verzerrtem religiösem Eifer sich selbst nach dem Bilde dieser Illusion. König Ferrante von Neapel war ein Mann dieses Schlages. Und er zog, zum Unglück seiner Feinde, aus der seelischen Folterung noch größeren Genuss als aus der leiblichen.
Er war ein untersetzter, beleibter Mann mit olivgrüner Haut, mit krausen, groben schwarzen Augenbrauen, die so dick waren, dass sie seine Augen verbargen, was seine Erscheinung noch drohender machte, als sie ohnedies schon war. Das gleiche dicke Haar bedeckte seinen ganzen Körper und kam oft aus dem Halsausschnitt und den Ärmeln seiner königlichen Roben zum Vorschein wie das Fell eines Tiers. Als junger Mann hatte er sich wegen einer lebensgefährlichen Infektion die beiden Schneidezähne ziehen lassen. Da er eitel war, hatte ihm dann zu deren Ersatz der königliche Schmied zwei goldene machen müssen. Er lächelte selten, aber wenn er es tat, war sein Ausdruck dabei höchst unheimlich. In ganz Italien wurde erzählt, dass er niemals eine Waffe trug und keine Leibwächter benötigte, weil er mit diesen Goldzähnen jedem Feind, der ihn herausforderte, das Fleisch vom Leibe reißen konnte.
Als Herrscher über Neapel, den mächtigsten Staat auf dem italienischen Festland, versetzte er alle Nachbarn in Angst und Schrecken. Fielen ihm Feinde in die Hände, kettete er sie in Käfigen an und allabendlich, ehe er zu Bett ging, besichtigte er die Menagerie dieser Elenden in seinen Kerkern. Konnten dann die Gepeinigten ihre Qualen nicht länger ertragen und gaben den Geist auf, pflegte Ferrante sie einbalsamieren und wieder in ihre Käfige setzen zu lassen, um denen, die noch am Leben festhielten, vor Augen zu führen, dass sie auch nach ihrem Tode noch zu seinem Vergnügen beitrugen.
Selbst seine treuesten Diener entgingen seiner unersättlichen Grausamkeit nicht. Er nahm ihnen, was er konnte, Gunstbeweise und bare Münze, und ließ sie dann im Schlafe in ihren Betten ermorden, sodass seine Angestellten zu Lebzeiten keine ruhige Minute hatten.
Die Auswirkungen dieser Neigungen waren umso schlimmer, als er ein sehr tüchtiger und geschickter Staatsmann war, der weder dem Kirchenstaat noch Mailand je die geringste Konzession gemacht hatte. In der Tat hatte er zur Regierungszeit Papst Innozenz’ und seiner Vorgänger der Kirche den schuldigen Zins verweigert und als einzige Abgabe den traditionellen Schimmel für die päpstliche Reiterei nach Rom geschickt.
Es war in seiner Eigenschaft als tüchtiger Staatsmann, dass König Ferrante von seinen grausamen Gelüsten absah und beschloss, Nutzen aus der Situation zu ziehen und, anstatt Rom mit dem fürchterlichen Heer Neapels zu bedrohen, dem Papst ein Bündnis anzutragen. Doch um sich gegen unliebsame Überraschungen abzusichern und sicherzugehen, dass er die Unterstützung erhalten würde, die er brauchte, um Mailand einzunehmen, schrieb er seinem Vetter König Ferdinand von Spanien: »Wenn der Papst nichts zu meiner Zufriedenheit tut, lassen wir unsere Truppen ins Mailändische einfallen und könnten ja auf dem Wege nach Mailand auch Rom erobern.«
Der spanische König Ferdinand selbst reiste nach Rom, um die seinen Vetter Ferrante betreffende Angelegenheit zu besprechen und Alexander von einer anderen wichtigen Sache zu unterrichten, die ihm aufgefallen war.
Ferdinand war ein großer, herrschaftlicher Mann, der seine Stellung als Monarch Spaniens sehr ernst nahm. Er war ein christlicher König, der an seinem Gott keine Zweifel hatte und sich der Unfehlbarkeit des Papstes ohne Fragen beugte. Aber sein Glauben erhob sich nicht zu der evangelischen Inbrunst seiner Gemahlin, Königin Isabella, und er hatte nicht das Bedürfnis, die Ungläubigen zu verfolgen. Im Wesentlichen war er ein viel vernünftigerer Mann und dogmatisch nur insofern, als dem Aragonesischen Imperium damit gedient war. Er und Alexander respektierten einander, hielten einander für vertrauenswürdig, so weit man überhaupt sterblichen Menschen vertrauen konnte.
König Ferdinand, der in einem einfachen dunkelblauen Seidenmantel mit Pelzbesatz gekleidet war, sah elegant aus in dem riesigen Empfangssaal, in dem er dem Papst gegenüber saß. Er nippte an seinem Weinglas und sagte: »Als Zeichen seines guten Willens bat Ferrante mich, Sie von etwas in Kenntnis zu setzen, das er jüngst entdeckt hat. Bald nach dem Konklave traf sich sein kommandierender General Virginio Orsini mit Kardinal Cibo, um den Kauf dreier Burgen nördlich von Rom zu tätigen, die Kardinal Cibo von seinem Vater, Papst Innozenz, geerbt hatte.«
Papst Alexander runzelte die Stirn, blieb aber eine Zeit lang still, ehe er sprach. »Dieses Geschäft fand ohne mein Wissen statt? Ohne die Genehmigung des Heiligen Stuhls? Hinter dem Rücken des Stellvertreters Christi auf Erden? Dieser Verrat wurde von einem Fürsten der Heiligen Katholischen Kirche verübt?«
Tatsächlich war Alexander mehr von dem Verrat Orsinis als von dem des Kardinals überrascht. Denn Virginio war zwar nur Adrianas Schwager, aber der Papst hatte ihn immer als Freund angesehen, denn selbst in den bösesten Zeiten gibt es Männer, die Vertrauen einflößten, und Virginio Orsini war ein solcher Mann.
Am Abend beim Essen verriet König Ferdinand dem Papst die diesem zur Lösung des Rätsels noch fehlende Tatsache. »Die Einigung über das Geschäft fand statt im Palast von Giuliano della Rovere.«
Jetzt verstand Alexander. Wer immer diese Burgen sein Eigen nannte, die sämtlich uneinnehmbare Festungen waren, hatte die Sicherheit Roms in der Hand.
König Ferdinand erklärte: »Ich werde nach Neapel reisen und mit Ferrante reden, um zu sehen, was sich machen lässt.« Der König küsste den Ring des Papstes, ehe er ging, und versicherte ihm, dass er seinen ganzen Einfluss aufbieten wollte, um eine Seiner Heiligkeit genehme Lösung des Problems herbeizuführen. Dann sagte er noch, als sei ihm der Gedanke eben erst gekommen: »Ach, übrigens, Eure Heiligkeit. Es gibt Streit wegen der Neuen Welt. Portugal und Spanien erheben Anspruch auf neue Territorien. Die Königin und ich selbst würden Ihre Vermittlung sehr zu schätzen wissen.«
Und so geschah es, dass Meldungen zwischen Rom und Neapel hin und her gingen. Kuriere ritten Tag und Nacht. Schließlich versicherte König Ferrante dem Papst, dass Virginio Orsini Seiner Heiligkeit keineswegs zu schaden gedacht, sondern ihm vielmehr einen Dienst erwiesen hatte, da die von ihm käuflich erworbenen Burgen ja gerade vor der Stadt Rom standen und so geeignet waren, diese im Falle einer französischen Invasion zu beschützen.
Man einigte sich also darauf, dass Virginio Orsini seine Burgen behalten durfte. Als Beweis seiner Treue zu Papst Alexander hätte er zukünftig eine Steuer von vierzigtausend Dukaten jährlich an den Vatikan abzuführen.
Nun erhob sich die Frage, was der Papst gewillt sei, sich die Unterstützung der Könige Ferdinand und Ferrante kosten zu lassen?
König Ferrante wollte Cesare Borgia als Mann für Sancia, seine sechzehn Jahre alte Enkelin. Alexander weigerte sich und erinnerte Ferrante an den Umstand, dass sein zweiter Sohn bereits die Kardinalswürde angenommen hatte. Er erbot sich, Sancia statt seiner seinen jüngsten Sohn Jofre zum Mann zu geben. Dieses Angebot wies Ferrante zurück. Wer würde schon statt des älteren den jüngeren Sohn haben wollen?
Obwohl die meisten seiner Vorgänger sich gefürchtet hatten, Ferrante irgendwas, das er von ihnen begehrte, auszuschlagen, blieb Papst Alexander hartnäckig. Er hatte Pläne für Cesare und war nicht gewillt, sein Gold für gemeines Metall einzutauschen.
Ferrante hatte schon viel von Alexanders Geschick und Listigkeit bei Verhandlungen gehört und war nun in höchstem Grade irritiert. Er wusste, dass, sollte er die Gelegenheit zu einem Bündnis nicht wahrnehmen, Alexander bald ein anderes schließen würde. Nach langem Zaudern und angesichts geringer Hoffnung, auf anderen Wegen zum Sieg zu gelangen, nahm Ferrante widerwillig das päpstliche Angebot an. Er wollte nur hoffen, dass der zwölfjährige Jofre imstande sein würde, seine sechzehnjährige Enkelin Sancia zu beschlafen und so den Vertrag zu legitimieren, ehe Alexander eine bessere Partie für ihn fand.
Aber fünf Monate nach der Trauung durch Stellvertreter starb der allseits gefürchtete König Ferrante, und sein Sohn und Thronfolger Masino, der nicht annähernd so klug und grausam wie sein Vater war, sah sich Papst Alexander auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Da Neapel zum Kirchenstaat gehörte, dessen Souverän der Papst war, konnte nur er die Krone dieses Reiches verleihen. War ihm ein Anwärter auf den Thron nicht genehm, so konnte er sich einen anderen aussuchen.
Indessen war just zu dieser Zeit auch Alexander in Schwierigkeiten. König Karl von Frankreich, der Anspruch auf Neapel erhob, wünschte auch die Krone dieses Reichs für sich selbst. Er schickte also eine Gesandtschaft zum Papst, die ihm mit seiner Absetzung drohte, wenn er Masino, den Erben Ferrantes, begünstigen sollte. Der Papst aber wusste, wenn erst die Franzosen Neapel in der Hand hätten, würde es mit der Unabhängigkeit des Kirchenstaats vorbei sein.
Zum weiteren Verdruss des Papstes war bei den spanischen Hassern und beinah traditionellen Feinden des Papsttums eine zunehmende Aufsässigkeit zu beobachten, die zum Bruch des zerbrechlichen Friedens führen konnte, der seit seiner Amtsübernahme in Italien herrschte.
Da erhielt er die Nachricht, die ihm half, eine Entscheidung zu treffen.
Abermals war es Duarte Brandao, der ihm die Nachricht überbrachte. »Man spricht davon, dass ein neuer Einfall der Franzosen bevorsteht. Der junge König Karl VIII. ist leidenschaftlich und schwärmerisch und fest entschlossen, der größte Monarch seiner Zeit zu werden. Er plant einen neuen Kreuzzug zur Eroberung von Jerusalem.«
Alexander verstand. »Also muss dieser junge König zuerst Neapel erobern, das an die Länder der Ungläubigen grenzt. Auf dem Wege nach Neapel muss er notgedrungen durch den Kirchenstaat ziehen.«
Duarte nickte und fügte hinzu: »Karl hat auch erklärt, das Papsttum reformieren zu wollen, und das zu vollbringen, gibt es nur einen Weg, Euer Hochwürden ...«
Der Papst dachte darüber nach, was Duarte gesagt hatte. »Er muss mich absetzen, um tun zu können, was er will ...«
Papst Alexander war entschlossen, es mit Masino nicht zu verderben, denn er brauchte die militärische Stärke Neapels zur Verteidigung Roms gegen König Karls Truppen.
Und er entwickelte noch einen Plan. Um seine Stellung im Vatikan und Rom gegen die Invasion der auswärtigen Macht zu verteidigen, musste der Papst die Stadtstaaten Italiens vereinigen. Und so kam er auf die Idee der Heiligen Liga. Eine Vereinigung mehrerer der größten Stadtstaaten unter seiner Führung versprach stärker zu sein als die Summe ihrer Teile.
Momentan gab es allerdings Schwierigkeiten, die der Herstellung einer tatkräftigen Heiligen Liga entgegenstanden. Venedig blieb neutral, wie immer. Mailand war bereits auf Seiten der Franzosen. Und Florenz war militärisch schwach, ganz abgesehen davon, dass es dort den Propheten Savonarola gab, der genug Einfluss hatte, die Medici zu hindern, der Vereinigung beizutreten.
Alexander erwog all das und gelangte zu der Einsicht, dass er Masino krönen müsse, wenn nicht bald ein anderer Mann die Tiara tragen sollte.
In Neapel wurde Masino gekrönt, vier Tage ehe Jofre Borgia Masinos Tochter Sancia heiratete.
Am Altar der Kapelle des Castel Nuovo stand der zwölfjährige Sohn des Papstes neben der sechzehnjährigen neapolitanischen Prinzessin und versuchte, älter auszusehen als er war. Obwohl er größer war als seine Braut und mit seinem dicken dunkelblonden Haar und hellen Augen recht gut aussah, hatte er doch weder Charme noch Witz. Sancia war ein schönes, lebhaftes Mädchen und es verdross sie, dass ihr Vater sie ausgerechnet mit diesem dummen Jungen verheiraten wollte. Sie weigerte sich, das Hochzeitskleid anzuprobieren, und während der Zeremonie starrte sie die Gäste in der überfüllten Kapelle ungeduldig an. Als der Bischof Jofre fragte: »Willst du diese Frau ...«, ließ Jofre ihn nicht ausreden und fiel ihm atemlos ins Wort. »Ja, ich will ...«
Die Gäste lachten laut. Sancia fühlte sich gedemütigt und ihre Antwort und Wiederholung des Gelöbnisses waren kaum hörbar. Was hatte sie mit diesem albernen Kind zu schaffen?
Als sie dann während des nachfolgenden Empfangs die vielen Goldmünzen und Juwelen sah, die er ihr mitgebracht hatte, wurde ihr Ausdruck weicher. Und als er ihren Brautjungfern erlaubte, ihm weitere Goldmünzen aus den Taschen zu ziehen, lächelte die dunkelhaarige Sancia ihren Bräutigam bereits an.
Am Abend im Brautgemach kletterte Jofre Borgia in Anwesenheit König Masinos und zweier anderer Zeugen auf seine Braut und ritt sie, wie er ein neues Pony geritten hätte. Sie lag unter ihm und stellte sich tot. Wieder und wieder, viermal, bestieg er sie, bis der König ihm Einhalt gebot und den Vertrag ratifizierte.
Alexander hieß Cesare und Juan in den Saal des Glaubens rufen, wo er der mit König Ferdinand hinsichtlich Neapels getroffenen Übereinkunft gemäß, eingewilligt hatte, die Gesandten Spaniens und Portugals zu empfangen, um in einem Streit wegen der neuen Länder zu vermitteln. Als Cesare und Juan den Saal betraten, saß dort schon ihr Vater in vollem Ornat, die päpstliche Mitra auf dem Haupt und den reich bestickten rotgoldenen Mantel um die Schultern. Er erklärte seinen Söhnen: »Das wird für euch eine Lehrstunde der Diplomatie werden, denn bei den Ämtern, die ihr in der Kirche innehaben werdet, werdet ihr an solchen Verhandlungen oft beteiligt sein.«
Was er nicht sagte, war, dass König Ferdinands Bitte um päpstliche Vermittlung keine leere Höflichkeitsfloskel gewesen war, sondern den päpstlichen Einfluss nicht nur in religiösen, sondern auch in politischen Angelegenheiten während des Zeitalters der Entdeckungen in Rechnung stellte. Jetzt würde der Papst sich damit die Unterstützung Spaniens sichern, die er dringend brauchen würde, wenn König Karl von Frankreich, wie er es vorzuhaben schien, in Italien einfiel.
Alexander blickte auf, als die Gesandten den Raum betraten. Er begrüßte sie herzlich und sagte: »Wir glauben, dass Sie unsere Söhne kennen, Kardinal Borgia und den Herzog von Gandia?«
»Ja, Heiliger Vater, wir kennen sie«, erwiderte der Spanier, ein stattlicher kastilischer Grande in schwarzem, dick besticktem Wams. Er nickte Cesare zu und dann Juan, der ältere portugiesische Gesandte folgte seinem Beispiel.
Alexander hatte auf einem großen Tisch mit Intarsien eine Landkarte ausgebreitet. Er und die beiden Gesandten deuteten auf verschiedene dort verzeichnete Orte. »Meine Söhne, wir haben ein Problem gelöst, das Anlass zu großer Besorgnis gegeben hat in den Beziehungen der Nationen dieser beiden edlen Herren.«
Wieder nickten die beiden Männer und Alexander fuhr fort. »Beide Nationen haben tapfere Seefahrer und Forscher auf die fernsten unbekannten Meere hinausgeschickt. Beide haben Anspruch auf alle Länder an der Küste des Atlantischen Ozeans. Portugal erhebt deshalb Anspruch auf die gesamte Neue Welt jenseits des Atlantischen Ozeans. Spanien behauptet dagegen, dass Papst Calixtus dem König von Portugal nur die Oberhoheit über die Länder an der Ostküste des großen Ozeans zugesprochen habe, nicht aber die neu entdeckten Länder im Westen. Um einen Konflikt zwischen diesen beiden großen Völkern zu vermeiden, hat König Ferdinand uns angerufen, dass wir in diesen Streitfragen zwischen ihnen entscheiden möchten. Und in der Hoffnung auf göttliche Führung haben beide Nationen eingewilligt, sich unserer Entscheidung zu fügen. Nicht wahr?«
Die beiden Gesandten nickten.
»Nun denn«, sagte Alexander, »wir haben die Angelegenheiten mit Sorgfalt in Betracht gezogen und sind zu einer Entscheidung gelangt. Wir müssen die Neue Welt entlang dieses Längengrads aufteilen.«
Er wies auf den Längengrad, der auf der Karte hundert Meilen westlich der Azoren und der Kapverdischen Inseln eingezeichnet war. »Alle nicht-christlichen Länder östlich dieser Linie, und es liegen dort viele wertvolle Inseln, sollen dem portugiesischen Königreich gehören. Die Menschen dort sollen in Zukunft portugiesisch sprechen. Alle Länder westlich dieser Linie sollen ihren katholischen Majestäten Ferdinand und Isabella gehören.«
Alexander schaute zu den Gesandten. »Wir haben die Bulle Inter Caetera, in der dieser Schiedsspruch dargetan wird, bereits erlassen. Plandini, der vatikanische Sekretär, wird jedem von Ihnen bei der Abreise ein Exemplar des Dokuments aushändigen. Ich hoffe, die gefundene Lösung möge für alle Beteiligten zufriedenstellend sein und dass aufgrund unserer Übereinkunft viele Seelen errettet, statt geopfert werden mögen.«
Er lächelte und beide Gesandten beugten sich, seinen Ring zu küssen, als er sie verabschiedete.
Als sie gegangen waren, wandte Alexander sich an Cesare: »Was hältst du von meiner Entscheidung?«
»Ich glaube, Vater, dass die Portugiesen dabei den Kürzeren gezogen haben, denn sie haben viel weniger Land erhalten.«
Auf Alexanders Gesicht zeigte sich ein wölfisches Lächeln. »Nun, mein Sohn, es war schließlich König Ferdinand von Spanien, der unseren Schiedsspruch erbeten hat. Vergiss nicht, dass wir eine im Grunde spanische Familie sind. Wir müssen auch in Betracht ziehen, dass Spanien wahrscheinlich heutzutage das mächtigste Land auf Erden ist. Da Karl, der König von Frankreich, plant, in Italien einzufallen – auf Rat unseres Feindes, des Kardinals della Rovere – und seine Truppen schon bereitstehen, die Alpen zu überschreiten –, sind wir vermutlich schon bald auf spanische Hilfe angewiesen. Abgesehen davon haben die Portugiesen zwar sehr kühne Seefahrer, aber kein nennenswertes Heer.«
Ehe Cesare und Juan den Papst verließen, legte er die Hand auf Juans Schulter. »Mein Sohn, aufgrund unserer erfolgreichen Vermittlung ist deine versprochene Eheschließung mit Maria Enriquez vorverlegt worden. Ich sage dir noch einmal, bereite dich darauf vor. Beleidige unseren Freund, König Ferdinand, nicht, denn das gute Einvernehmen, das gegenwärtig zwischen uns herrscht, war nicht leicht herbeizuführen. Wir danken Gott jeden Tag für das Glück unserer Familie und die Möglichkeit, das Wort Christi bis an die Enden der Erde zu predigen, um das Papsttum für Leib und Seele der Gläubigen zu stärken.«
Kaum eine Woche später war, begleitet von einem Tross, der reiche Schätze mitführte, Juan unterwegs nach Spanien, nach Barcelona, zu der Familie Enriquez.
Alexander fühlte sich müde von den Beschwernissen des Lebens. Himmel und Erde schienen auf seinen Schultern zu lasten. Jetzt konnte ihm nur noch eines Freude bereiten ...
An jenem Abend legte Alexander seinen feinsten seidenen Schlafanzug an, denn seine junge Geliebte, Julia Farnese, war eingeladen worden, die Nacht in seinem Bett zu verbringen. Während sein Diener ihn badete und ihm mit parfümierter Seife die Haare wusch, lächelte er bei dem Gedanken an das süße Gesicht, das ihn mit Bewunderung und, wie er glaubte, echter Zuneigung anschauen würde.
Obwohl es ihm einigermaßen rätselhaft erschien, wie eine junge Frau von solcher Schönheit und solchem Zauber einen Mann anbeten konnte, dessen beste Jahre eindeutig schon hinter ihm lagen, nahm er die Tatsache hin, wie er sich in seinem Leben schon mit vielen rätselhaften Tatsachen abgefunden hatte. Natürlich war er klug genug zu wissen, dass seine Macht und die Vergünstigungen, die zu gewähren er imstande war, eine gewisse Ergebenheit hervorrufen konnten. Unbestreitbar war auch, dass Julias Beziehung zum Heiligen Vater die Lage und Habe der gesamten Familie verbessern und derart auch Julias eigenen Status erhöhen konnte. Dennoch war da noch mehr, und in seinem Herzen wusste er das. Denn wenn Julia und er einander liebend umarmten, war das ein Geschenk von unschätzbarem Wert. Ihre Unschuld war hinreißend und ihr Bedürfnis zu lernen und zu gefallen und ihre Neugier auf sinnliche Erkundungen aller Art waren einfach unwiderstehlich.
Alexander war schon mit vielen schönen Kurtisanen zusammen gewesen, die wesentlich mehr Erfahrung gehabt und das Handwerk, einen Mann zu befriedigen, von der Pike auf gelernt hatten. Aber Julias hemmungslose Hingabe an die sinnliche Lust war die Reaktion eines seligen Kindes und verschaffte ihm, wenn er auch die Beziehung nicht als die leidenschaftlichste bezeichnen konnte, die er je gehabt, tiefste Befriedigung.
Nun wurde Julia, in ein Gewand aus purpurnem Samt gehüllt, in sein Schlafzimmer geführt. Ihr goldenes Haar fiel ihr offen über die Schultern, sie trug eine einfache kleine Perlenkette, die er ihr geschenkt hatte, als sie einander zum ersten Mal geliebt hatten.
Julia setzte sich auf die Kante des breiten Betts und begann, ihr Gewand aufzubinden. Sie wandte ihm den Rücken zu und bat: »Liebe Heiligkeit, bitte heben Sie mir das Haar hoch.«
Alexander stand auf, sein mächtiger Körper dicht hinter ihr, und füllte seine Sinne mit dem Lavendelduft ihres Haares. Er hielt ihre blonden Locken in seinen großen Händen, die das Schicksal so vieler Menschenseelen zu tragen hatten, und sie schlüpfte aus ihrem Gewand, das zu Boden fiel.
Als sie sich umdrehte und das Gesicht hob, seinen Kuss in Empfang zu nehmen, musste er sich zu ihr hinabbeugen, um ihre Lippen zu erreichen. Sie war nicht einmal so groß wie Lucrezia und zierlicher von Gestalt. Sie legte ihm die Arme um den Hals und als er sich aufrichtete, hob er sie hoch.
»Meine süße Julia, ich warte schon seit so vielen Stunden auf dich. Dich in meinen Armen zu halten wird mir so viel Freude machen wie die heilige Messe zu feiern – obwohl es ja frevelhaft wäre, diese Wahrheit irgendjemand anderem als dir, meine Süße, laut einzugestehen.«
Julia lächelte ihn an und legte sich neben ihn unter die seidenen Betttücher. »Ich habe heute eine Botschaft von Orso erhalten«, sagte sie, »er will für einige Zeit nach Rom auf Besuch kommen.«
Alexander versuchte, sich sein Missvergnügen nicht anmerken zu lassen, denn die Nacht war dafür viel zu schön. »Unglücklicherweise bin ich der Meinung, dass die Gegenwart deines jungen Gatten in Bassanello noch für ein Weilchen erforderlich sein wird. Ich werde ihn vielleicht mit der Führung eines Teils meiner Streitkräfte betrauen müssen.«
Julia wusste, dass der Papst eifersüchtig war, denn seine Gefühle waren Alexander von den Augen abzulesen. Um ihn zu beruhigen, beugte sie sich über ihn und legte die Lippen auf seine und küsste ihn heftig. Sie hatte die süßen kühlen Lippen eines jungen, unerfahrenen Mädchens, er war aber bemüht, sie recht sanft zu behandeln, denn vor allem wollte er vermeiden, sie zu ängstigen. Sie hatten einander schon verschiedene Male Befriedigung zu verschaffen gesucht, wobei er seine eigene Lust immer hintansetzte, um sicherzugehen, dass sie zu ihrer kam. Er wollte nicht alle Selbstbeherrschung verlieren und riskieren, von seiner Leidenschaft zu ungezügelt in sie hineingetrieben zu werden, denn in dem Fall würde sie erstarren und alle Lust sie beide fliehen.
»Würde es Ihnen gefallen, wenn ich mich auf den Bauch legte«, fragte sie ihn, »und Sie dann über mich?«
»Ich fürchte, Sie zu verletzen«, erklärte er ihr, »lieber lege ich mich auf den Rücken und lasse Sie reiten, wie Sie wollen. Auf diese Weise können Sie das Maß Ihrer eigenen Leidenschaft kontrollieren und so viel Lust empfangen, wie Sie ertragen können.«
Oft hatte er die kindliche Unschuld Julias bewundert, wenn sie ihr Haar herunterließ wie diese Göttinnen alter Mythen und Geschichten, die einen Prinzen verzaubern und für immer gegen seinen Willen in Bann schlagen.
Jedes Mal, wenn er sich auf den Rücken legte und zu ihrem Gesicht aufsah, schloss sie, hingerissen, den Kopf in den Nacken werfend, die Augen, und er glaubte, dass die Fleischeslust, die er empfand, eine Gabe der Ergebung in den himmlischen Vater war. Denn wer außer einem wohltätigen Vater konnte den Menschen so himmlische Seligkeit auf Erden gewähren?
Ehe Julia am nächsten Morgen sein Schlafgemach verließ, gab er ihr ein Kreuz aus Goldfiligran, das er von einem der besten Goldschmiede von Florenz hatte anfertigen lassen. Sie setzte sich unbekleidet auf das Bett und gestattete ihm, ihr das Kreuz um den Hals zu legen. Wie sie da saß, schien sie das Abbild der Gnade zu sein, und die Schönheit ihres Leibes und Gesichts bewies Papst Alexander erneut, dass da ein Vater im Himmel war, denn auf Erden konnte niemand solche Vollkommenheit erdacht haben.