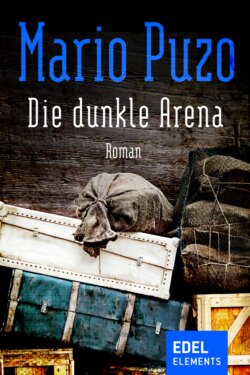Читать книгу Die dunkle Arena - Mario Puzo - Страница 10
6
ОглавлениеIm Zimmer neben Mosca wohnte ein kleiner, vierschrötiger Zivilbeamter, der die übliche olivgrüne Uniform trug und darauf aufgenäht ein blauweißes Stoffabzeichen mit den Buchstaben AJDC. Sie bekamen ihn nur selten zu Gesicht, und im ganzen Haus kannte ihn keiner, aber sie hörten ihn noch spätnachts in seinem Zimmer herumgehen. Eines Tages nahm er Mosca in seinem Jeep mit. Sie wollten beide im Ratskeller essen. Er hieß Leo und arbeitete für das American Joint Distribution Committee, eine jüdische Wohlfahrtsorganisation. Die Initialen waren auch mit großen weißen Buchstaben auf seinem Jeep aufgemalt.
Während sie durch die Straßen fuhren, fragte Leo Mosca mit seiner hohen Stimme in einem englischen Akzent: »Habe ich Sie nicht schon irgendwo gesehen? Sie kommen mir so bekannt vor.«
»Unmittelbar nach dem Krieg habe ich für die Militärregierung gearbeitet«, antwortete Mosca. Er war ganz sicher, daß sie einander noch nie begegnet waren.
»Ach ja«, sagte Leo, »Sie sind doch immer mit den Kohlewagen nach Grohn hinaufgekommen, stimmt’s?«
»Das ist richtig«, gab Mosca überrascht zu.
»Ich war damals dort Insasse, ein DP.« Leo lachte. »Es war nicht besonders gut organisiert. Wir haben so manches Wochenende ohne heißes Wasser auskommen müssen.«
»Wir hatten eine Zeitlang Schwierigkeiten«, entgegnete Mosca. »Es wurde dann wieder in Ordnung gebracht.«
»Ja, ich weiß.« Leo lächelte. »Eine faschistische, aber vielleicht nötige Methode.«
Sie nahmen das Abendessen gemeinsam ein. In normalen Zeiten wäre Leo ein dicker Mann gewesen. Er hatte eine Hakennase und ein breitknochiges Gesicht, dessen linke Seite krampfartig zuckte. Seine Bewegungen waren fahrig und schnell, spiegelten jedoch die Unbeholfenheit und den Mangel an Koordination eines Menschen wider, der sich nie körperlich betätigt hat. Von Sport, welcher Art immer, hatte er keine Ahnung.
»Was tut ihr Leute eigentlich?« fragte Mosca beim Kaffee.
»Wir gehören zur UNRRA«, antwortete Leo. »Wir versorgen die Juden, die in den Lagern sitzen und darauf warten, Deutschland zu verlassen. Ich war selbst acht Jahre in Buchenwald.«
Vor langer Zeit, vor unwirklich langer Zeit, war das einer der Gründe gewesen, die Mosca veranlaßt hatten, sich freiwillig zu melden: um gegen die Herren der Konzentrationslager zu kämpfen. Aber das war nicht er gewesen, das war der Typ auf dem Foto, auf den Gloria und seine Mutter und Alf so große Stücke hielten.
Die Erinnerung daran brachte ihn in Verlegenheit, als er sich eingestehen mußte, daß ihm die Sache mittlerweile völlig schnuppe geworden war.
»Ja«, sagte Leo, »mit dreizehn Jahren kam ich nach Buchenwald.« Er krempelte den Ärmel hoch und zeigte Mosca die mit roter Tinte eintätowierte sechsstellige Zahl. »Mein Vater war auch da. Er starb, ein paar Jahre bevor das Lager befreit wurde.«
»Sie sprechen ziemlich gut Englisch«, meinte Mosca. »Kein Mensch würde glauben, daß Sie Deutscher sind.«
Leo sah ihn an und lächelte. »Nein, nein, ich bin kein Deutscher«, sagte er mit seiner nervösen Stimme. »Ich bin Jude.« Er schwieg eine kleine Weile. »Natürlich war ich Deutscher, aber Juden können jetzt nicht mehr Deutsche sein.«
»Wieso sind Sie noch da?« fragte Mosca.
»Ich habe hier einen guten Job. Ich genieße die gleichen Privilegien wie die Amerikaner, und ich verdiene gut. Und dann muß ich mich auch noch entschließen, ob ich nach Palästina oder in die Vereinigten Staaten gehen will. Diese Entscheidung fällt mir schwer.«
Sie unterhielten sich lange; Mosca trank Whisky und Leo Kaffee. Dabei versuchte Mosca auch, Leo verschiedene Sportarten zu erklären, ihm das Gefühl zu geben, was Sport bedeutete weil man diesem Mann im KZ doch seine Kindheit und seine Jugend gestohlen hatte, weil diese Jahre seines Lebens unwiederbringlich dahin waren.
Mosca versuchte, ihm zu veranschaulichen, wie das war, wenn man beim Basketball die bestmögliche Wurfgelegenheit suchte, wenn man sich durch Täuschung von der gegnerischen Deckung befreite, wenn man in die Luft sprang und einen Korberfolg erzielte. Er sprach zu ihm von der erregenden Lust des Herumwirbelns und Laufens auf dem warmen Holzboden in der Turnhalle, von der schweißnassen Erschöpfung und der wunderbaren Erfrischung durch eine warme Dusche unmittelbar nach dem Spiel. Er erzählte ihm, wie er dann gelöst und entspannt, die blaue Tasche in der Hand, die Straße hinunterzugehen pflegte und wie die Mädchen schon im Eissalon auf ihn und seine Freunde warteten.
»Ich bin immer unterwegs«, sagte Leo, als sie ins Quartier zurückfuhren. »Meine Arbeit bringt es mit sich, daß ich viel reisen muß. Aber wenn es jetzt kälter wird, werde ich mehr Zeit in Bremen verbringen. Wir werden uns besser kennenlernen, nicht wahr?«
»Ich werde Ihnen Baseball beibringen«, sagte Mosca und lächelte. »Ich werde Sie auf Amerika vorbereiten.«
Nach dieser ersten Begegnung kam Leo an manchen Abenden zu ihnen. Sie tranken Tee und Kaffee, und Mosca brachte ihm Kartenspiele bei – Poker, Kasino und Rummy. Leo sprach nie von der Zeit, die er im Lager verbracht hatte, und er schien auch nie trüben Gedanken nachzuhängen, aber er hatte keine Geduld, hielt es nicht lange an einem Ort aus, und ihr ruhiges Leben sagte ihm nicht zu. Leo und Hella wurden gute Freunde, und er behauptete, sie wäre die erste Frau, der es gelungen war, ihm das Tanzen beizubringen.
Und als dann der Herbst kam und die Bäume ihre Blätter auf die Radfahrwege fallen ließen und einen grau-grün gesprenkelten Teppich über die Straßen breiteten, ließ die auffrischende Luft Mosca das Blut zum Herzen strömen und riß ihn aus seiner sommerlichen Lethargie. Er war nervös, aß häufiger im Ratskeller, ging oft auf einen Drink ins Offizierskasino – beides Lokale, zu denen Hella, als Deutsche, keinen Zutritt hatte.
Wenn er spät und leicht angetrunken ins Quartier zurückkehrte, aß er die dicke Suppe aus der Dose, die Hella ihm auf der elektrischen Kochplatte aufwärmte, und fiel sodann in unruhigen Schlaf. Vielfach wachte er schon im Morgengrauen auf und sah den grauen Wolken nach, die der frühe Oktoberwind über den Himmel jagte. Er beobachtete die deutschen Arbeiter, wie sie an der Ecke auf die Straßenbahn warteten, um ins Stadtzentrum zu fahren.
Als er eines Morgens wieder am Fenster stand, verließ auch Hella das Bett und stellte sich zu ihm. Sie trug das Hemd, das ihr als Nachtgewand diente. Sie legte den Arm um seine Hüfte, und dann blickten beide auf die Straße hinunter.
»Kannst du nicht schlafen?« murmelte sie, selbst noch verschlafen. »Du bist immer schon so früh auf.«
»Es liegt wohl daran, daß wir abends nie ausgehen. Das häusliche Leben wird mir zuviel.«
Hella schmiegte sich an ihn. »Wir brauchen ein Baby«, flüsterte sie, »ein süßes, kleines Baby.«
»O Jesus«, sagte Mosca, »auch so ein Quatsch, den der Führer euch da eingepaukt hat.«
»Man hat auch schon früher Kinder geliebt.« Es ärgerte sie, daß er über etwas lachen konnte, was sie sich so sehnlich wünschte. »Ich weiß, man wird heute für dumm angesehen, wenn man Kinder haben will. In Berlin haben die Mädchen uns Bauerntrampel ausgelacht, weil wir ein Herz für Babys hatten und uns über Kinder unterhielten.« Sie gab ihm einen Schuhs. »Na schön, du mußt jetzt zur Arbeit.«
Er versuchte sie durch Argumente zu überzeugen. »Du weißt, daß wir nicht heiraten können, solange sie das Verbot nicht aufheben. Alles, was wir hier tun, ist ungesetzlich, und ganz besonders, daß du hier im Quartier wohnst. Wenn wir ein Kind bekommen, müssen wir uns ein deutsches Logis suchen, und das darf ich wieder nicht. Aber sie können tausend Gründe finden, um mich in die Staaten abzuschieben. Und ich hätte keine Möglichkeit, dich mitzunehmen.«
Sie lächelte ihn an, und in ihrem Lächeln lag eine Spur von Traurigkeit. »Ich weiß, daß du mich nicht wieder allein lassen wirst.« Mosca war bestürzt und überrascht, daß sie das wußte. Er hatte bereits beschlossen, sich falsche Papiere zu besorgen und unterzutauchen, wenn es Schwierigkeiten geben sollte.
»Ach, Walter«, sagte sie, »ich will nicht so leben wie die Leute da unten. Trinken, tanzen im Klub, schlafen gehen und nichts haben, was uns verbindet, außer uns selbst. Das ist nicht genug.« Das Hemd bedeckte gerade noch ihr Hüftbein und ihren Nabel; sich ihrer Würde und ihrer Scham begebend, stand sie da. Er wollte lächeln.
»Nein, das taugt nichts«, sagte er.
»Hör mir zu! Als du wegfuhrst, habe ich mich auf mein Baby gefreut. Was für ein Glück ich doch habe! dachte ich. Denn auch wenn du nicht zurückkommen solltest – es würde ein anderes menschliches Wesen zur Welt kommen, das ich lieben könnte. Verstehst du das? Von meiner ganzen Familie ist mir nur eine Schwester geblieben, und sie lebt weit weg von hier. Dann bist du gekommen, der ein Teil meines Lebens gewesen wäre, dem Freude zu machen mir Freude machen würde, und bist wieder fortgegangen. Es gibt nichts Schrecklicheres.«
Unten kamen ein paar Amerikaner aus dem Haus und traten auf die kalte Straße. Sie lösten die Sicherheitsketten an ihren Jeeps und ließen die Motoren warmlaufen. Das hämmernde Dröhnen war undeutlich durch die geschlossenen Fenster zu hören.
Mosca legte seinen Arm um sie. »Dazu bist du nicht gesund genug.« Er ließ seinen Blick über ihren schmächtigen nackten Körper gleiten. »Ich will nicht, daß dir etwas zustößt.« Und noch während er es aussprach, packte ihn eine große Furcht, sie könnte ihn aus irgendeinem Grund verfassen, und dann würde er an den grauen Wintertagen allein am Fenster stehen, ein leeres Zimmer hinter sich, und es würde auf unerklärliche Weise seine Schuld sein. Er wandte sich jäh nach ihr um. »Sei nicht böse auf mich«, murmelte er. »Warte noch ein bißchen.«
Sie schmiegte sich in seine Arme. »In Wirklichkeit hast du Angst vor dir selbst«, erwiderte sie. »Ich glaube, daß du das weißt. Ich sehe, wie du zu anderen Leuten und wie du zu mir bist. Sie halten dich alle für unfreundlich, für –« sie suchte nach einem Wort, das ihn nicht verärgern würde – »grob. Ich weiß, daß du in Wirklichkeit gar nicht so bist. Ich könnte mir keinen besseren Mann wünschen, in jeder Beziehung. Die Meyer und Yergen, die sehen sich manchmal so an, wenn ich etwas Nettes über dich sage, und ich weiß, was sie denken.« Ihre Stimme klang bitter; es war die Bitterkeit aller Frauen, die ihr Glück gegen eine Welt verteidigen, die das Motiv ihrer Liebe nicht begreift. »Sie verstehen es nicht.«
Er hob sie auf, legte sie auf das Bett und deckte sie zu. »Du wirst dich erkälten«, sagte er. Bevor er zur Arbeit ging, beugte er sich über sie und küßte sie. »Du kannst alles haben, was du dir wünschst«, meinte er und lächelte. »Und schon gar etwas, das so leicht geht. Und sorge dich nicht, daß sie mich zwingen könnten, dich zu verlassen. Was immer auch geschieht.«
»Ich werde mir keine Sorgen machen«, lachte sie. »Bis abend also.«