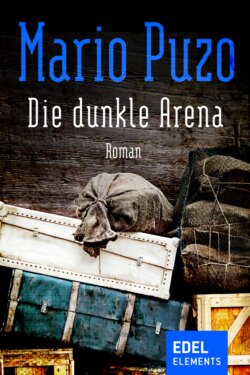Читать книгу Die dunkle Arena - Mario Puzo - Страница 8
4
ОглавлениеNachdem sie die Neustadt durchquert hatten und über die Brücke in die Innenstadt von Bremen gelangt waren, sah Mosca das erste Wahrzeichen, an das er sich erinnerte. Es war der Glockenturm einer Kirche, der Bewurf ein pockenzerfressenes Gesicht; eine schlanke Nadel aus Stein und Mörtel, aufragend zum Himmel.
Dann ging es am klotzigen Polizeipräsidium vorbei, auf dessen dunkelgrünen Mauern noch die weißen Narben der Explosion zu sehen waren. Sie bogen in die Schwachhauser Heerstraße ein, um die andere Seite der Stadt zu erreichen, die einst die eleganteren Viertel umfaßt hatte; hier waren die Häuser zum Großteil unversehrt geblieben und dienten jetzt der Besatzungsmacht als Quartiere.
Mosca dachte über den Mann nach, der neben ihm saß. Eddie Cassin war nicht eben romantisch veranlagt. Eher das Gegenteil, soweit Mosca das beurteilen konnte. Als sie noch GIs gewesen waren, hatte Eddie eine junge, aber auch sehr gut entwickelte Belgierin, ein außerordentlich hübsches Püppchen, in der Stadt gefunden. Er hatte sie in einem kleinen, fensterlosen Raum in seinem Quartier untergebracht und eine große Party gegeben. Das Mädchen hatte den Raum drei Tage und drei Nächte lang nicht verlassen und war allen dreißig GIs des Quartiers zu Willen gewesen. Kartenspielend waren die Männer in der danebenliegenden Küche gesessen und hatten gewartet, bis die Reihe an sie kam. Das Mädchen war so hübsch und gutmütig gewesen, daß die GIs sie so verwöhnt hatten, wie üblicherweise Ehemänner ihre schwangeren Gattinnen verwöhnen. Sie organisierten Eier, Speck und Schinken und überboten sich gegenseitig, wenn es darum ging, ihr Frühstückstablett mit allerlei Köstlichkeiten vollzuräumen. Zu den Mahlzeiten brachten sie ihr Leckerbissen aus der Messe. Sie lachte und scherzte, wenn sie nackt im Bett saß, um zu essen. Den ganzen Tag über war immer einer bei ihr im Zimmer, und sie schien eine echte Zuneigung für die Burschen zu empfinden. Schwierigkeiten machte sie nur in einem Punkt: Eddie Cassin mußte sie jeden Tag mindestens eine Stunde lang besuchen kommen. Sie nannte ihn Daddy.
»Um sie für mich allein zu behalten, dazu war sie zu hübsch«, hatte Eddies Erklärung gelautet. Aber Mosca hatte den Tonfall schäbiger Genugtuung in seiner Stimme nicht vergessen.
Von der Kurfürstenallee bogen sie in die Metzer Straße ein und führen im frühabendlichen Schatten der langen Reihen breiter und laubreicher Bäume dahin. Vor einem vier Stock hohen, neugetünchten Ziegelhaus mit einem kleinen Vorgarten blieben sie stehen. »Hier ist es«, sagte Eddie, »das beste Junggesellenquartier für Amerikaner in Bremen.«
Mosca nahm beide Koffer und die Tasche, und Eddie ging vor ihm über den Gehsteig. An der Tür wurden sie von der deutschen Haushälterin empfangen.
»Das ist Frau Meyer«, sagte Eddie und legte seinen Arm um ihre Hüfte. Frau Meyer war eine Frau von etwa vierzig Jahren und nahezu platinblond. Sie hatte eine ausgezeichnete Figur, die sie ihrer vieljährigen Tätigkeit als Schwimmlehrerin beim BDM verdankte. Ihr Gesicht hatte einen freundlichen, aber verlebten Ausdruck, der durch die großen, sehr weißen, hervorstehenden Zähne betont wurde.
Mosca nickte, und sie sagte: »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Mosca. Eddie hat mir schon so viel von Ihnen erzählt.«
Sie stiegen in den dritten Stock. Frau Meyer schloß die Tür zu einem der Zimmer auf und gab Mosca die Schlüssel. Es war ein sehr großes Zimmer. In einer Ecke stand ein schmales Bett und in der anderen ein großer, weiß bemalter Schrank. Zwei breite Fenster ließen die untergehende Sonne und den ersten Anfang des langen Sommerzwielichts ein. Sonst war das Zimmer leer.
Mosca stellte die zwei Koffer nieder, und Eddie setzte sich auf das Bett. »Ruf doch mal Yergen«, sagte er zu Frau Meyer.
»Ich hole gleich auch Laken und Decken«, antwortete Frau Meyer. Sie hörten, wie sie die Treppe hinaufging.
»Sieht nicht sehr toll aus«, bemerkte Mosca.
Eddie lächelte. »Wir haben einen Zauberer im Haus. Diesen Yergen. Der beschafft alles.« Und während sie warteten, gab Eddie Mosca einige Informationen über das Quartier. Frau Meyer war eine gute Hausfrau und kümmerte sich darum, daß es immer heißes Wasser gab und daß die acht Dienstmädchen alles sauberhielten und daß die Wäsche (nach einer Sondervereinbarung mit Frau Meyer) tadellos gebügelt wurde. Sie selbst wohnte in zwei behaglich eingerichteten Zimmern im Dachgeschoß. »Ich verbringe die meiste Zeit oben bei ihr«, fuhr Eddie fort, »aber ich glaube, sie läßt sich auch noch von Yergen vögeln. Gottlob ist mein Zimmer im Stockwerk unter diesem, so daß wir uns gegenseitig nicht allzu streng kontrollieren können.«
Die Abenddämmerung breitete sich über die Stadt, und Mosca wurde immer ungeduldiger. Eddie ließ sich über das Quartier aus, als ob es sein persönliches Eigentum wäre. Für die in der Metzer Straße einquartierten Amerikaner, erklärte Eddie, war Yergen einfach unentbehrlich. Er hatte die Wasserpumpe des Hauses so hingekriegt, daß sogar die Bewohner des obersten Stockwerks baden konnten. Er machte Kisten für das Porzellan, das die Amerikaner nach Hause schickten, und verpackte das Zeug so geschickt, daß die dankbaren Verwandten in Amerika noch nie geklagt hatten, daß etwas zerbrochen angekommen wäre. Sie waren ein gutes Team, dieser Yergen und Frau Meyer, und nur Eddie wußte, daß sie tagsüber und sehr bedachtsam die Zimmer plünderten. Hier ein paar Unterhosen, dort ein paar Socken, hier ein paar Handtücher, dort ein paar Taschentücher. Die Amerikaner waren schlampig und paßten auf ihre Sachen nicht auf. In den Zimmern der ganz besonders Achtlosen verschwand hin und wieder ein halb gefülltes oder ganzes Päckchen Zigaretten. Sie machten das sehr diskret. Bei den Dienstmädchen allerdings sorgten sie für strenge Disziplin; die mußten ehrlich bleiben.
»Menschenskind«, unterbrach ihn Mosca, »du weißt doch, daß ich hier raus will. Können diese Deutschen sich nicht ein bißchen beeilen?«
Eddie ging zur Tür und rief hinaus: »He, Meyer, mach mal!« Und dann zu Mosca: »Wahrscheinlich hat sie mit Yergen noch schnell mal eine Nummer gemacht, das tut sie gern.« Sie hörten sie die Treppe herunterkommen.
Sie kam mit einem Armvoll Bettwäsche ins Zimmer, und hinter ihr kam Yergen. Im Mund hatte er ein paar Nägel, in der Hand einen Hammer. Er war ein schmächtiger, kleiner Deutscher in mittleren Jahren und trug Overalls über einer khakifarbenen amerikanischen Uniformbluse. Ein Fluidum von selbstverständlicher Zuverlässigkeit und natürlicher Würde ging von ihm aus und würde bei jedem, der mit ihm zu tun hatte, grenzenloses Vertrauen erweckt haben, wären nicht diese verrunzelten und zerknitterten Tränensäcke gewesen, die seinen Zügen einen Ausdruck raffinierter Schläue verliehen. Er schüttelte Eddie Cassin die Hand und bot dann Mosca die gleiche Form der Begrüßung an. Mosca schüttelte ihm die Hand. Richtig freundschaftliches Klima hier, dachte er.
»Ich bin hier das Mädchen für alles«, erklärte Yergen. »Wenn Sie was brauchen, ich stehe zur Verfügung.«
»Ich brauche ein größeres Bett«, sagte Mosca, »ein paar Möbel, ein Radio und noch ein paar Kleinigkeiten. Das überlege ich mir noch.«
Yergen knöpfte seine Hemdtasche auf und zog einen Bleistift heraus. »Selbstverständlich«, sagte er mit geschäftiger Miene. »Die Zimmer sind sehr schlecht ausgestattet. Die Vorschriften! Aber ich habe schon einigen Ihrer Kameraden zu Diensten sein können. Ein kleines oder ein großes Radio?«
»Was kostet das?« fragte Mosca.
»Fünf bis zehn Stangen.«
»In Geld meine ich. Ich habe keine Zigaretten.«
»Dollar oder Besatzungsgeld?«
»Dollars.«
»Ich würde meinen«, sagte Yergen langsam, »Sie brauchen ein Radio, ein paar Tischlampen, vier oder fünf Stühle, ein Sofa und ein großes Bett. Ich werde Ihnen das alles verschaffen, über den Preis sprechen wir später. Wenn Sie auch jetzt keine Zigaretten haben, ich kann warten. Ich bin ein Geschäftsmann; ich weiß, wem ich Kredit einräumen kann. Außerdem sind Sie ein Freund von Mr. Cassin.«
»Na schön«, sagte Mosca. Er zog Hemd und Unterhemd aus und öffnete die blaue Tasche, um Seife und Handtuch herauszuholen.
»Und wenn Sie etwas gewaschen oder gebügelt haben wollen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde dem Mädchen die entsprechenden Anweisungen geben.« Frau Meyer lächelte ihn an. Ihr gefiel sein geschmeidiger Körper mit der dekorativen weißen Narbe, von der sie annahm, daß sie sich bis zu seinen Geschlechtsteilen hinzog.
»Was kostet das?« fragte Mosca. Er hatte einen Koffer geöffnet und legte sich frische Wäsche zurecht.
»Oh, bitte, keine Bezahlung. Geben Sie mir jede Woche ein paar Tafeln Schokolade, und ich werde es so einrichten, daß die Mädchen zufrieden sind.«
»Okay, okay«, sagte Mosca ungeduldig. Und dann zu Yergen: »Sehen Sie zu, daß das Zeug morgen da ist.«
Nachdem die zwei Deutschen gegangen waren, schüttelte Eddie Cassin mit gespielt vorwurfsvollem Blick den Kopf. »Die Zeiten haben sich geändert, Walter«, sagte er. »Die Besatzung befindet sich jetzt in einer neuen Phase. Wir begegnen Leuten wie Yergen und Frau Meyer mit Respekt, schütteln ihnen die Hand und bieten ihnen immer, aber auch immer, eine Zigarette an, wenn wir etwas mit ihnen zu besprechen haben. Sie können uns Gefälligkeiten erweisen, Walter.«
»Der Teufel soll sie holen«, antwortete Mosca. »Wo ist das Badezimmer?«
Cassin führte ihn den Gang hinunter. Das Badezimmer war riesig groß, hatte drei Waschbecken, die größte Badewanne, die Mosca je gesehen hatte, und eine Toilette mit einem kleinen Tischchen daneben, auf dem amerikanische Zeitschriften und Zeitungen ausgebreitet waren.
»Große Klasse«, sagte Mosca. Er begann sich zu waschen, und Eddie setzte sich auf die Klosettmuschel, um ihm Gesellschaft zu leisten.
»Hast du die Absicht, mit deiner Freundin hier zu wohnen?« fragte Eddie.
»Wenn ich sie finde und wenn sie zu mir zurückkommen will«, erwiderte Mosca.
»Gehst du noch heute abend zu ihr?«
Mosca trocknete sich ab und schob eine neue Klinge in seinen Rasierapparat. »Mhm«, machte er und warf einen Blick durch das halb offene Fenster hinaus. Es war schon fast dunkel. »Ich werde es heute abend versuchen.«
Eddie stand auf und ging zur Tür. »Wenn’s nicht klappt, komm nachher zu Frau Meyer hinauf auf einen Drink.« Er klopfte Mosca auf die Schulter. »Wenn alles glattgeht, sehe ich dich morgen früh im Büro.« Er ging hinaus und den Gang hinunter.
Allein geblieben, empfand Mosca ein überwältigendes Verlangen, sich nicht fertig zu rasieren, in sein Zimmer zurückzukehren und ins Bett zu gehen oder hinauf zu Frau Meyer, um dort, zusammen mit Eddie, den Abend mit Trinken zu verbringen. Es widerstrebte ihm, das Haus zu verlassen und Hella aufzusuchen, aber er bezwang diese Anwandlung, rasierte sich fertig und kämmte sich. Er ging zum Badezimmerfenster und öffnete es; die Seitenstraße war nahezu leer, aber ein Stück weiter unten war eine schwarz gekleidete Frau, eine verschwommene Gestalt in der zunehmenden Dunkelheit, damit beschäftigt, Gras auszureißen, das hier und dort zwischen den Ruinen wuchs. Sie hatte schon einen ganzen Armvoll davon. Ihm näher, fast unmittelbar unter seinem Fenster, sah er eine vierköpfige Familie, Vater, Mutter und zwei kleine Jungen, eine Mauer aufrichten, die bis jetzt allerdings nur etwa einen Fuß hoch war. Von einem kleinen Handwagen holten die Knaben die gebrochenen Ziegel, die sie offenbar aus den Trümmern der zerstörten Stadt geborgen hatten, und der Mann und die Frau hackten und schabten, bis die Ziegel in die Mauer paßten. Das Gerippe ihres Hauses umrahmte die Szene zu einem Bild, das einen tiefen Eindruck bei ihm hinterließ. Das letzte Licht des Tages erlosch, und Straßen und Menschen waren nur noch dunkle Formen, die sich gegen eine noch tiefere und undurchdringlichere Finsternis abhoben. Mosca ging in sein Zimmer zurück.
Er nahm eine Flasche aus dem Koffer und tat einen kräftigen Zug. Er kleidete sich sorgfältig an. Es ist das erste Mal, daß sie mich ohne Uniform sehen wird, dachte er. Er wählte einen hellgrauen Anzug und dazu ein offenes weißes Hemd. Er ließ alles, wie es war – die Koffer offen, aber nicht ausgepackt, die schmutzige Wäsche auf dem Boden, das Rasierzeug achtlos auf das Bett geworfen. Noch einmal setzte er die Flasche an den Mund, dann lief er die Treppe hinunter und trat in die warme, schwüle Sommernacht hinaus.
Er nahm eine Straßenbahn, und der Schaffner, der ihn sogleich als Amerikaner identifizierte, bat ihn um eine Zigarette. Mosca gab sie ihm und behielt ein scharfes Auge auf die entgegenkommenden Züge. Es könnte sein, dachte er, daß sie ihr Zimmer schon verlassen hatte, um irgendwo den Abend zu verbringen. Mehr als einmal spannte sich die Haut über seinen Backenknochen, wenn er glaubte, daß er sie gesehen hatte, daß das Profil oder der Rücken einer Frau dem ihren glich, aber er war nie sicher.
Als er aus der Straßenbahn ausstieg und die vertraute Straße entlangging, erkannte er das Haus nicht gleich wieder und mußte erst die Namenlisten studieren, die an der Tür jedes Hauses angebracht waren. Er irrte sich nur ein einziges Mal, und schon auf der zweiten Liste fand er ihren Namen. Er klopfte, wartete ein paar Minuten und klopfte abermals.
Die Tür öffnete sich, und im trüben Licht des Korridors erkannte er die alte Frau wieder, der die Wohnung gehörte. Das sorgfältig festgesteckte graue Haar, das abgetragene schwarze Kleid, der fadenscheinige Schal, alles fügte sich zu dem klassischen Bild einer sorgenbeladenen alten Frau zusammen.
»Ja«, fragte sie, »was ist?«
»Ist Fräulein Hella zu Hause?« Mosca war selbst überrascht, wie gut und flüssig sein Deutsch war.
Die alte Frau erkannte ihn nicht und merkte auch nicht, daß er kein Deutscher war. »Bitte, kommen Sie herein«, sagte sie, und er folgte ihr durch den matt erleuchteten Gang bis zum Zimmer. Die alte Dame klopfte und sagte: »Fräulein Hella, Sie haben Besuch. Ein Herr.«
Endlich hörte er ihre Stimme, ganz ruhig, aber doch ein wenig überrascht. »Ein Herr?« Und dann: »Einen Augenblick, bitte.«
Mosca öffnete die Tür und trat ein.
Sie saß mit dem Rücken zu ihm und schob sich eilig Spangen in das frisch gewaschene Haar. Auf dem Tisch neben ihr lag ein Laib graues Brot. An der Wand stand ein schmales Bett und daneben ein Nachttischchen.
Während er sie beobachtete, steckte Hella sich das Haar fest und griff nach dem Brot und einer bereits abgeschnittenen Scheibe, um es in den Schrank zu tun. Dann drehte sie sich um, und ihre Augen fielen auf Mosca, der an der Tür wartete.
Mosca sah das weiße, knochige, nahezu skelettartige Gesicht und die Gestalt, die noch zerbrechlicher wirkte, als er sie in Erinnerung hatte. Ihre Hände öffneten sich, und das graue Brot fiel auf den hölzernen, unebenen Fußboden. Sie zeigte keine Überraschung, und einen Augenblick lang glaubte er, Ärger und so etwas wie Mißfallen in ihren Zügen zu lesen. Doch dann breitete sich ein Schleier aus Leid und Trauer über ihr Gesicht. Er ging auf sie zu, und ihr Gesicht wurde runzelig und faltig, und die Tränen liefen durch die vielen Furchen bis hinunter zum Kinn, das er jetzt in seiner Hand hielt. Sie ließ den Kopf sinken und preßte ihn an seine Schulter.
»Laß dich anschauen«, sagte Mosca. Er versuchte, ihren Kopf zu heben, aber sie ließ es nicht geschehen. »Ist ja gut«, sagte er, »ich wollte dich überraschen.« Aber sie hörte nicht auf zu schluchzen, und er konnte nichts anderes tun, als zu warten und seine Blicke durch das Zimmer schweifen zu lassen, über das schmale Bett, über den altmodischen Schrank und die Kommode, auf der, vergrößert und eingerahmt, die Fotos standen, die er ihr geschenkt hatte. Das Licht der Tischlampe war trübe, ein deprimierender, schwacher gelber Schein. Unter dem Gewicht der zerstörten oberen Stockwerke waren die Wände und die Decke des Zimmers nach innen durchgebogen.
Halb lachend, halb weinend, hob Hella den Kopf. »Oh, du, du«, murmelte sie. »Warum hast du nicht geschrieben? Warum hast du mir nicht gesagt, daß du kommst?«
»Ich wollte dich überraschen«, wiederholte er. Er küßte sie zart, und an ihn gelehnt, sagte sie mit schwacher, schwankender Stimme: »Als ich dich gesehen habe, habe ich geglaubt, du wärst tot, und ich träumte oder bin verrückt geworden oder ich weiß nicht. Ich sehe ja entsetzlich aus, ich habe mir eben das Haar gewaschen.«
Sie blickte an ihrem verschossenen, formlosen Hauskleid herab und hob ihm dann abermals ihr Gesicht entgegen.
Jetzt sah er die dunklen Ringe unter ihren Augen. Das Haar unter seiner Hand fühlte sich feucht und tot an, ihr Körper hart und kantig.
Sie lächelte, und er sah seitlich die Lücke in ihrem Mund. Er streichelte ihre Wange und fragte: »Und das?«
Sie machte ein verlegenes Gesicht. »Das Baby«, antwortete sie. »Es hat mich zwei Zähne gekostet.« Sie lächelte ihn an und fragte wie ein Kind: »Sehe ich sehr häßlich aus?«
Langsam schüttelte Mosca den Kopf. »Nein«, erwiderte er, »nein.« Und dann, nachstoßend: »Was war mit dem Baby? Hast du es dir wegmachen lassen?«
»Nein«, sagte Hella, »es wurde zu früh geboren; es lebte nur ein paar Stunden. Ich bin erst vor einem Monat aus dem Krankenhaus gekommen.«
Und weil sie seinen Argwohn, seinen Mangel an Vertrauen kannte, ging sie zum Schrank und holte ein Bündel Papiere heraus, die mit einer Schnur zusammengebunden waren. Sie blätterte sie durch und reichte ihm vier amtliche Dokumente.
»Lies«, sagte sie, und es klang weder zornig noch verletzt. Sie wußte, daß man in dieser Welt und Zeit, in der sie lebten, mit Beweisen zur Hand sein mußte.
Die Siegel und Stempel der verschiedenen Amtsstellen zerstreuten seine Zweifel. Fast bedauernd nahm er die Tatsache zur Kenntnis, daß sie nicht gelogen hatte.
Hella ging zum Schrank und nahm einen Stoß Kleidungsstücke heraus. Sie hielt jedes einzelne davon hoch, die kleinen Unterhemden, Hemden, Blusen und Hosen. Die Stoffe und Farben waren Mosca zum Teil vertraut. Und dann begriff er, daß sie, weil eben sonst nichts zu haben war, ihre eigenen Kleider, ja sogar ihre Unterwäsche aufgetrennt und für das Baby wieder zurechtgeschnitten hatte.
»Ich wußte, daß es ein Junge sein würde«, sagte sie. Und plötzlich fühlte Mosca heißen Zorn in sich aufsteigen. Er war zornig, weil sie die Farbe aus ihrem Gesicht, das Fleisch um ihre Hüften und Schultern, die Zähne und ihre so geschickt aufgetrennten und wieder zusammengesetzten Kleider gegeben – und nichts dafür erhalten hatte. Und im gleichen Augenblick erkannte er, daß er zurückgekehrt war, weil er ihrer und nicht sie seiner bedurfte.
»Das war dumm von dir«, sagte er, »das war verdammt dumm von dir.«
Er setzte sich auf das Bett, und sie setzte sich neben ihn. Eine kleine Weile waren sie beide verlegen und starrten auf den nackten Tisch, auf den einzigen Stuhl, die eingedrückten Wände und die herabhängende Decke. Dann aber, ganz langsam, so als ob sie ein uraltes Ritual vollzögen, Heiden gleich, die den Segen eines unbekannten, grausamen Gottes auf ihren Bund herabflehen, ohne zu wissen, ob das Zeremoniell ihnen Glück oder Unglück bescheiden wird, streckten sie sich auf dem schmalen Bett aus und vereinten sich. Er tat es mit einer Leidenschaft, die sich auf Alkohol, Schuldgefühle und Gewissensbisse gründete, sie mit der festen Überzeugung, daß dies eine gute und erfüllende Vollziehung war, durch die sie beide der Seligkeit teilhaftig werden würden. Sie fand sich mit dem Schmerz ab, den er ihrem noch nicht ausgeheilten Körper zufügte, und akzeptierte die Rücksichtslosigkeit seiner Leidenschaft und seinen mangelnden Glauben an sie, an sich und an alles, denn sie erkannte die entscheidende Wahrheit: daß er von allen Menschen, denen er je begegnet war, nur ihrer bedurfte, ihrer Zuversicht, ihres Körpers, ihres Glaubens an ihn und ihrer Liebe zu ihm.