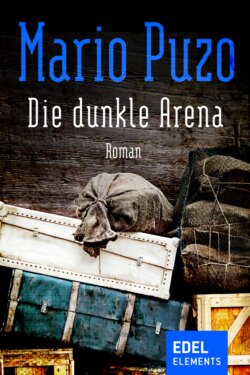Читать книгу Die dunkle Arena - Mario Puzo - Страница 5
1
ОглавлениеWalter Mosca fühlte die Erregung und die letzte, überwältigende Einsamkeit vor seiner Heimkehr. Er dachte zurück an die wenigen Ruinen in den Pariser Vorstädten und an vertraute Wahrzeichen. Jetzt, am Ende seiner Reise, konnte er es kaum erwarten, ans Ziel zu kommen, die zerstörte Stadt zu erreichen, von der er geglaubt hatte, daß er sie nie wiedersehen würde. Die Wahrzeichen, die den Weg nach Deutschland wiesen, waren ihm vertrauter als die seines eigenen Landes, seiner eigenen Heimatstadt.
Der Zug brauste dahin. Es war ein Truppentransport mit Verstärkungen für die Frankfurter Garnison, aber der halbe Waggon war von Zivilbeamten besetzt, die man in den Staaten angeworben hatte. Mosca faßte an seine seidene Krawatte und lächelte. Sie war ihm ungewohnt. Bei den GIs am anderen Ende würde er sich wohler fühlen, und so, dachte er, empfanden zweifellos auch die meisten der etwa zwanzig Zivilisten, die mit ihm unterwegs waren.
An beiden Enden des Waggons brannte ein mattes Licht. Die Fenster waren mit Brettern verschlagen, so als sollten die Fahrgäste nichts von den riesigen Ruinenfeldern sehen, die sich zu beiden Seiten der Strecke ausbreiteten. Die Sitze waren lange Holzbänke, die nur einen schmalen Durchgang frei ließen.
Mosca streckte sich auf einer Bank aus und legte sich die kleine, blaue Reisetasche als Kissen unter den Kopf. Im matten Licht konnte er die anderen Zivilisten kaum erkennen.
Sie waren alle mit demselben Truppentransportschiff gereist. So wie er schienen es alle anderen kaum erwarten zu können, nach Frankfurt zu kommen. Sie redeten laut, um sich im Dröhnen des Zuges verständlich zu machen, und Mosca hörte, wie Mr. Geralds Stimme die anderen noch übertönte. Mr. Gerald war der ranghöchste Zivilbeamte. In seinem Gepäck führte er einen Satz Golfschläger mit sich, und auf dem Schiff hatte er alle Welt wissen lassen, daß sein Dienstgrad als Zivilbeamter dem Rang eines Obersten entsprach. Mr. Gerald war fröhlich und vergnügt, und Mosca sah ihn vor sich, wie er auf den Ruinen einer Stadt Golf spielte, wobei er die plattgedrückten, dem Erdboden gleichgemachten Straßen als Spielbahn und runde Schutthügel als Grün benützte und mit dem Putter den Ball sorgfältig in einen verwesenden Schädel trieb.
Der Zug passierte einen kleinen Bahnhof, wobei er seine Geschwindigkeit verringerte. Es war Nacht und sehr dunkel im Waggon. Mosca döste vor sich hin, und die Stimmen der anderen drangen nur undeutlich an sein Ohr. Doch als der Zug wieder schneller wurde, war Mosca plötzlich hellwach.
Die Zivilisten unterhielten sich jetzt ein wenig ruhiger, und Mosca setzte sich auf und richtete seine Blicke auf die Soldaten am anderen Ende des Waggons. Manche schliefen auf den langen Bänken, aber er sah auch um drei Gruppen von Kartenspielern drei Lichtkreise, die diesen Teil des Waggons in einen freundlichen Schimmer tauchten. Er empfand eine leise Sehnsucht nach dem Leben, das er so lang geführt und nun vor einigen Monaten aufgegeben hatte. Beim Schein der Kerzen konnte er sehen, wie sie aus ihren Feldflaschen tranken – gewiß kein Wasser, das war ihm klar – ihre Verpflegungspackungen aufrissen und Schokolade knabberten. Ein GI war immer auf alles vorbereitet, dachte Mosca und grinste. Decken auf dem Rücken, Kerzen in seinem Tornister, Wasser oder etwas Besseres in seiner Feldflasche und immer einen Überzieher in der Brieftasche. Immer vorbereitet für Glücksfälle und andere.
Abermals streckte Mosca sich auf der Bank aus und versuchte zu schlafen. Aber sein Körper war ebenso steif und unnachgiebig wie das harte Holz unter ihm. Der Zug fuhr jetzt sehr schnell. Er sah auf die Uhr. Es war fast Mitternacht und noch gute acht Stunden bis Frankfurt. Er setzte sich auf, nahm eine Flasche aus der kleinen, blauen Tasche stützte den Kopf gegen das verschalte Fenster und trank, bis sein Körper sich ein wenig entspannte. Er mußte eingeschlafen sein, denn als er wieder zum anderen Ende des Wagens hinuntersah, entdeckte er nur noch einen Lichtkreis; aber in der Dunkelheit hinter ihm konnte er immer noch die Stimmen Mr. Geralds und einiger anderer Zivilisten hören. Sie mußten wohl getrunken haben, denn Mr. Geralds Stimme klang gönnerhaft und herablassend; er sprach prahlerisch von der ihm zufallenden Machtfülle und wie er ein gut funktionierendes Papierimperium errichten würde.
Zwei Kerzen lösten sich aus dem Lichtkreis am anderen Ende des Wagens, und ihr flackerndes Licht kam unruhig schwankend den Gang entlang. Mosca fuhr jäh auf. Der Gesichtsausdruck des GI mit den Kerzen war von bösartigem und stumpfsinnigem Haß geprägt. Der helle, gelbe Schein der Kerzen färbte das schon vom Trunk gerötete Gesicht noch dunkler und verlieh den finster blickenden Augen einen gefährlichen, gefühllosen Ausdruck.
»He, Schütze«, hörte er Mr. Geralds Stimme, »könnten Sie uns nicht eine Kerze überlassen?«
Gehorsam stellte der Mann die Kerze in der Nähe von Mr. Gerald und der Gruppe von Zivilbeamten nieder, und sogleich hoben sich die Stimmen, so als ob ihnen das flackernde Licht Mut gemacht hätte. Sie versuchten den GI in ihr Gespräch mit einzubeziehen, aber er, die Kerzen auf der Bank, sein eigenes Gesicht im Dunkel, antwortete nicht auf ihre Fragen. Sie vergaßen ihn wieder und sprachen über andere Dinge; nur einmal lehnte Mr. Gerald sich ins Licht vor, so als ob er zeigen wollte, daß man ihm vertrauen könne, und sagte etwas herablassend, wenn auch freundlich zu dem GI: »Wir waren ja alle in der Armee, wissen Sie?« Und dann mit einem Lachen zu den anderen: »Das haben wir ja nun Gott sei Dank hinter uns.«
»Seien Sie nicht so sicher«, meinte einer der Zivilisten, »die Russen sind auch noch da.«
Wieder vergaßen sie den GI, als dieser plötzlich, ihrer aller Stimmen und auch das Dröhnen des Zuges übertönend, der so sinnlos durch die Nacht brauste, mit der Anmaßung des Betrunkenen, laut, wie in Panik, schrie: »Haltet eure Fressen, haltet eure Fressen, quatscht nicht so viel, haltet eure verdammten Fressen!«
Es folgte ein Augenblick überraschter, verlegener Stille, und dann beugte Mr. Gerald sich abermals vor und sagte ruhig zu dem GI: »Gehen Sie doch wieder zu ihren Freunden zurück, Mann.« Der GI antwortete nicht, und Mr. Gerald setzte sein Gespräch an dem Punkt fort, wo er unterbrochen worden war.
Plötzlich verstummte er und erhob sich. Im flackernden Licht der Kerzen stand er da und sagte ruhig, gar nicht aufgeregt, aber auf erschreckende Weise ungläubig: »Mein Gott, ich bin verletzt. Der Schütze hat mich verwundet.«
Mosca setzte sich auf, und andere dunkle Gestalten erhoben sich von den Bänken. Einer streifte an eine Kerze an, und sie fiel zu Boden. Mr. Gerald, immer noch aufrecht, aber nicht mehr so deutlich, sagte mit entsetzter Stimme: »Der Schütze hat mich gestochen.« Dann fiel er aus dem Licht in die Dunkelheit seiner Bank zurück.
Zwei Männer vom anderen Ende des Wagens kamen den Gang heruntergeeilt. Beim Schein der Kerzen, die sie trugen, sah Mosca das Glitzern ihrer Offiziersrangabzeichen.
»Der Schütze hat mich gestochen, der Schütze hat mich gestochen«, wiederholte Mr. Gerald immer wieder. Er hatte seinen Schrecken überwunden; es klang erstaunt, überrascht. Mosca konnte ihn aufrecht auf seiner Bank sitzen sehen und sah dann auch, im vollen Licht der drei Kerzen, den Riß im Hosenbein hoch oben am Schenkel und das Blut, das daraus hervorquoll. Seine Kerze ganz nahe daranhaltend, beugte sich der Leutnant über ihn und erteilte dem Soldaten, der ihn begleitete, einen Befehl. Der Soldat lief ans andere Ende des Wagens hinunter und kam mit Decken und einem Verbandspäckchen zurück. Sie breiteten die Decken auf dem Boden aus und forderten Mr. Gerald auf, sich niederzulegen. Der Soldat wollte das Hosenbein aufschneiden, aber Mr. Gerald sagte: »Nein, rollen Sie es auf; ich kann es flicken lassen.« Der Leutnant besah sich die Wunde.
»Keine ernste Sache«, erklärte der Leutnant. »Decken Sie ihn zu.« Weder sein junges, ausdrucksloses Gesicht noch seine Stimme verrieten Mitgefühl; nur unpersönliche Freundlichkeit. »Am Bahnhof in Frankfurt wird ein Krankenwagen bereitstehen. Für alle Fälle. In der nächsten Station telegrafiere ich.« Dann wandte er sich an die anderen und fragte: »Wo ist er?«
Der betrunkene GI war verschwunden; in die Finsternis spähend, sah Mosca eine Gestalt, die in einer Ecke der Bank vor ihm kauerte. Er sagte nichts.
Der Leutnant ging ans andere Wagenende und kam mit seinem Pistolengürtel zurück. Er ließ den Strahl seiner Taschenlampe im Wagen herumtanzen, bis er die Gestalt sah. Er stieß den Mann mit der Taschenlampe an – gleichzeitig zog er seine Pistole und hielt sie hinter dem Rücken versteckt. Der GI rührte sich nicht.
Der Leutnant gab ihm einen derben Stoß. »Stehen Sie auf, Mulrooney!« Der GI öffnete die Augen, und als Mosca das ausdruckslose, störrische, tierische Glotzen sah, empfand er Mitleid.
Der Leutnant beließ den Strahl seiner Taschenlampe in den Augen des Mannes; er blendete ihn. Er befahl Mulrooney aufzustehen. Als er sah, daß seine Hände leer waren, steckte er seine Pistole wieder in den Halfter. Mit einem derben Schubs drehte er den GI herum und durchsuchte ihn. Als er nichts fand, ließ er das Licht der Lampe auf die Bank fallen. Mosca sah das blutige Messer. Der Leutnant hob es auf und schob den GI vor sich her ans andere Ende des Wagens.
Der Zug verringerte seine Geschwindigkeit und kam allmählich zum Stehen. Mosca ging ans Ende des Wagens, öffnete die Tür und blickte hinaus. Er sah den Leutnant zum Bahnhof gehen, um zu telegrafieren; sonst stieg niemand aus.
Mosca ging zu seiner Bank zurück. Mr. Geralds Freunde beugten sich über ihn und beruhigten ihn, und Mr. Gerald sagte ungeduldig: »Ich weiß, es ist nur ein Kratzer, aber warum hat er das gemacht? Warum macht er so etwas Verrücktes?« Und als der Leutnant in den Wagen zurückkam und ihnen mitteilte, daß in Frankfurt ein Krankenwagen warten würde, versicherte Mr. Gerald ihm: »Glauben Sie mir, Leutnant, ich habe nichts getan, um ihn zu provozieren. Sie können meine Freunde fragen. Ich habe nichts getan, überhaupt nichts, was ihn dazu hätte veranlassen können.«
»Der Mann ist verrückt, das ist alles«, erwiderte der Leutnant. Und fügte hinzu: »Sie haben Glück gehabt, Sir; wie ich Mulrooney kenne, hatte er es auf Ihre Eier abgesehen.«
Dies schien alle Welt aufzumuntern und anzuregen, so als ob die Ernsthaftigkeit des Vorhabens dem Geschehen selbst größere Bedeutung verleihen würde, als ob der Stich in Mr. Geralds Schenkel nun zu einer schwereren Verwundung geworden wäre. Der Leutnant brachte sein zusammengerolltes Bettzeug und schob es Mr. Gerald als Kissen unter. »Sie haben mir, ohne es zu wollen, einen Gefallen getan, Sir. Seit Mulrooney in meinen Zug gekommen ist, habe ich versucht, ihn loszuwerden. Für ein paar Jahre sind wir jetzt vor ihm sicher.«
Mosca konnte nicht schlafen. Der Zug hatte zu fahren begonnen, und Mosca ging abermals zur Tür, lehnte sich dagegen und blickte auf die dunkle, schattenhafte Landschaft hinaus. Er erinnerte sich an die gleiche oder fast gleiche Gegend, die nur so langsam vorbeizog, wenn man auf einem Lastwagen oder einem Panzer saß, marschierte oder über den Boden kroch. Er hätte nie geglaubt, daß er dieses Land je wiedersehen würde, und er fragte sich jetzt, warum alles so danebengegangen war. Er hatte so lange davon geträumt, in die Heimat zurückzukehren, und nun war er wieder weit fort. Hier im dunklen Zug dachte er zurück an die erste Nacht seiner Heimkehr.
Auf dem großen, breiten Klebestreifen an der Tür stand Willkommen daheim, Walter, und Mosca bemerkte, daß ähnliche Streifen mit anderen Namen auch an zwei anderen Wohnungstüren klebten. Das erste, was er sah, als er in die Wohnung kam, war das Bild von ihm selbst, aufgenommen kurz bevor er eingeschifft worden war. Dann drängten sich Mutter und Gloria um ihn, und Alf schüttelte ihm die Hand.
Sie standen alle um ihn herum, und dann folgte ein Augenblick verlegenes Schweigen.
»Du bist älter geworden«, bemerkte seine Mutter, und alle lachten. »Nein, ich meine, mehr als drei Jahre älter.«
»Er hat sich nicht verändert«, meinte Gloria. »Er hat sich überhaupt nicht verändert.«
»Der Held kehrt in die Heimat zurück«, sagte Alf. »Seht euch die vielen Ordensbänder an. Warst du so besonders tapfer?«
»Das übliche«, antwortete Mosca. »Die meisten Armeehelferinnen haben die gleichen Bänder.« Er zog seine Jacke aus, und seine Mutter nahm sie ihm ab. Alf ging in die Küche und kam mit einem Tablett voll Drinks zurück.
»Mensch«, sagte Mosca überrascht, »ich dachte, du hättest ein Bein verloren.« Mutter hatte ihm über Alf geschrieben; er hatte es ganz vergessen. Aber sein Bruder hatte offenbar auf diesen Augenblick gewartet. Er zog sein Hosenbein hoch.
»Sehr hübsch«, sagte Mosca. »Pech gehabt, Alf.«
»Ach was«, gab Alf zurück, »ich wollte, ich hätte zwei davon. Kein Fußpilz, keine eingewachsenen Nägel – du verstehst.«
»Na klar«, sagte Mosca. Er gab seinem Bruder einen Klaps auf die Schulter und lächelte.
»Er hat es speziell für dich angeschnallt, Walter«, fügte seine Mutter erklärend hinzu. »Sonst trägt er es nicht in der Wohnung, obwohl er weiß, daß ich es nicht mag, wenn er ohne herumläuft.«
Alf hob sein Glas. »Auf den siegreichen Helden«, sagte er, und dann, lächelnd, zu Gloria: »Auf das Mädel, das auf ihn gewartet hat.«
»Auf uns alle«, sagte Gloria.
»Auf meine Kinder«, sagte seine Mutter liebevoll. Ihr Blick umfaßte Gloria. Alle sahen Mosca erwartungsvoll an.
»Laßt mich das mal trinken; dann wird mir vielleicht auch was einfallen.« Alle lachten und tranken.
»Und jetzt das Abendessen«, schlug seine Mutter vor. »Hilf mir den Tisch decken, Alf.« Sie gingen in die Küche. Mosca ließ sich in einem der Lehnsessel nieder. »Es war eine lange, lange Fahrt«, sagte er.
Gloria ging zum Kaminsims und griff nach Moscas eingerahmtem Foto. Mit dem Rücken zu ihm, sagte sie: Jede Woche bin ich hergekommen und hab’ mir das Bild angeschaut. Ich habe deiner Mutter geholfen, das Abendessen herzurichten, wir haben zusammen gegessen, und dann sind wir hier in diesem Zimmer gesessen, haben uns das Bild angeschaut und über dich gesprochen. Jede Woche, drei Jahre lang, wie Leute, die auf einen Friedhof gehen, und jetzt, wo du da bist, sieht es dir nicht mehr ähnlich.
Mosca stand auf und ging zu Gloria hinüber. Er legte seinen Arm um ihre Schulter und betrachtete das Bild. Er hätte nicht sagen können, was ihn daran störte.
Der Kopf war lachend zurückgeworfen, er hatte sich offenbar so hingestellt, daß man die schwarzen und weißen diagonalen Streifen seiner Division deutlich sehen konnte. Arglose Gutmütigkeit lag auf dem jugendlichen Gesicht. Die Uniform paßte ihm ausgezeichnet. Wie er da in der Hitze der südlichen Sonne stand, war er der typische GI gewesen, der sich für eine liebende Familie fotografieren läßt.
»So was von blödem Gegrinse«, meinte Mosca.
»Mach dich nicht lustig darüber. Das war lange Zeit alles, was wir von dir hatten.« Sie schwieg eine kleine Weile. »Ach, Walter«, sagte sie dann, »wie wir manchmal geweint haben, wenn du nicht geschrieben hast, wenn wir Gerüchte hörten, daß ein Truppentransportschiff versenkt worden oder eine große Schlacht im Gange war. Am Tag der Landung in der Normandie sind wir nicht in die Kirche gegangen. Deine Mutter saß auf dem Sofa und ich hier beim Radio. Den ganzen Tag sind wir so gesessen. Ich bin nicht zur Arbeit gegangen. Ich stellte das Radio immerfort auf andere Stationen ein; sowie eine Nachrichtensendung zu Ende war, versuchte ich gleich einen anderen Sender zu bekommen, obwohl wir nun immer wieder das gleiche hörten. Deine Mutter hatte ein Taschentuch in der Hand, aber sie weinte nicht. In dieser Nacht schlief ich hier, in deinem Zimmer, in deinem Bett, mit dem Bild. Ich stellte es auf das Nachtkästchen und sagte ihm gute Nacht, und dann träumte ich, daß ich dich nie wiedersehen würde. Und jetzt bist du da, gesund und munter, und siehst überhaupt nicht aus wie das Bild.« Sie versuchte zu lachen, aber sie weinte.
Mosca war verlegen. Er küßte sie sanft. »Drei Jahre sind eine lange Zeit«, sagte er und dachte dabei: Am Tag der Landung war ich in einer englischen Stadt und ließ mich vollaufen. Die kleine Blonde bekam von mir ihren ersten Whisky und, wie sie behauptete, ihren Jungfernstich. Ich feierte den Tag der Landung, aber noch mehr feierte ich, daß ich nicht dabei war. Er hatte große Lust, Gloria die Wahrheit zu sagen, daß er nämlich an diesem Tag überhaupt nicht an sie gedacht, daß er an nichts gedacht hatte, woran sie gedacht hatte, aber er meinte nur: »Ich mag das Bild nicht, und außerdem – wie ich hereingekommen bin, hast du doch gesagt, ich hätte mich nicht verändert …«
»Ist das nicht komisch?« erwiderte Gloria. »Wie du durch die Tür gekommen bist, hast du genauso ausgesehen wie das Bild. Aber je länger ich dich anschaue, desto mehr scheint es mir, als ob dein ganzes Gesicht sich verändert hätte.«
»Das Essen ist fertig«, rief seine Mutter aus der Küche, und sie gingen alle ins Speisezimmer.
Alle seine Lieblingsspeisen standen auf dem Tisch – das halbrohe Roastbeef mit den kleinen Bratkartoffeln, der grüne Salat und eine dicke Scheibe Käse. Das Tischtuch war schneeweiß, und als Mosca fertig war, bemerkte er, daß die Serviette unberührt neben seinem Teller lag. Das Essen war gut gewesen, aber nicht so gut, wie er es sich in seinen Träumen vorgestellt hatte.
»Das ist schon was anderes als der GI-Fraß, was, Walter?« lachte Alf.
»Ja«, sagte Mosca. Er nahm eine kurze, dicke, dunkle Zigarre aus der Hemdtasche und wollte sie gerade anzünden, als er merkte, daß sie ihn alle belustigt anstarrten, Alf, Gloria und Mutter.
Er grinste. »Ich bin jetzt ein großer Junge«, sagte er. Übertriebenes Wohlbehagen demonstrierend, zündete er sich die Zigarre an. Alle vier fingen an zu lachen. Die letzte Verlegenheit schien überwunden. Durch ihre Überraschung und die darauf folgende Heiterkeit, als er sich die Zigarre angesteckt hatte, war alles, was sie trennte, bedeutungslos geworden. Sie gingen ins Wohnzimmer; die zwei Frauen hatten ihre Arme um Moscas Hüfte gelegt, und Alf trug das Tablett mit dem Whisky und dem Gingerale.
Die Frauen setzten sich neben Mosca aufs Sofa. Alf gab ihnen ihre Gläser und ließ sich dann gegenüber in einem der bequemen Lehnsessel nieder. Die Stehlampe hüllte das Zimmer in einen warmen gelben Schein, und in dem gleichen wohlwollenden, ein wenig scherzhaften Ton, den er schon den ganzen Abend über anschlug, verkündete Alf jetzt: »Sie hören jetzt die Geschichte des Walter Mosca.«
Mosca trank. »Zuerst die Geschenke«, sagte er. Er ging zu seiner kleinen, blauen Reisetasche, die noch bei der Tür stand, und entnahm ihr drei kleine, in braunes Papier gewickelte Schachteln. Jeder bekam eine, und während sie noch die Päckchen öffneten, nahm er wieder einen Schluck.
»Mann«, rief Alf, »was ist denn das?« Er hielt vier lange Silberzylinder hoch.
Mosca lachte. »Vier der besten Zigarren, die es in der Welt gibt. Sonderanfertigung für Hermann Göring.«
Gloria öffnete ihr Päckchen und hielt den Atem an. In einem schwarzen Samtetui lag ein Ring. Kleine Brillanten umgaben einen viereckigen, dunkelgrünen Smaragd. Sie sprang auf, schlang ihre Arme um Mosca und zeigte den Ring dann seiner Mutter.
Seine Mutter aber war von den ellenlangen Rollen weinroter Seide fasziniert, die in breiten Falten zur Erde fielen. Sie hielt sie hoch.
Es war eine riesige, viereckige Fahne, und in der Mitte, auf weißem, kreisförmigem Untergrund, schimmerte pechschwarz das Hakenkreuz. Alle verstummten. Zum erstenmal in der Stille dieses Raumes sahen sie das Symbol des Feindes.
»Es sollte ja nur ein Spaß sein«, brach Mosca das Schweigen. »Das ist dein Geschenk.« Er hob eine kleine Schachtel auf, die auf dem Boden lag. Seine Mutter öffnete sie, und als ihr Blick auf die blau-weißen Brillanten fiel, sah sie ihn an und dankte ihm. Sie faltete die große Fahne wieder ganz klein zusammen, stand auf und griff nach Moscas Tasche. »Ich werde auspacken«, sagte sie.
»Das sind wunderschöne Geschenke«, bemerkte Gloria. »Wo hast du sie her?«
Mosca grinste. »Kriegsbeute«, antwortete er und betonte das Wort auf eine Weise, daß alle lachen mußten.
Seine Mutter kam mit einem großen Paket Fotografien wieder ins Zimmer.
»Die waren in deiner Tasche, Walter. Warum hast du sie uns nicht gezeigt?« Sie setzte sich auf das Sofa und fing an, die Bilder eines nach dem anderen anzusehen. Sie gab sie an Gloria und Alf weiter. Während sie verschiedene Fotografien betrachteten und fragten, wo sie aufgenommen worden waren, schenkte er sich einen frischen Drink ein. Dann sah er, wie seine Mutter ein Bild anstarrte und ganz blaß dabei wurde. Ein Schrecken durchzuckte Mosca, und er dachte angestrengt nach, ob etwa noch eines von den wirklich schmutzigen Bildern dabei war, die er unterwegs aufgelesen hatte. Aber er war ganz sicher, daß er sie auf dem Schiff alle verkauft hatte. Er sah, wie seine Mutter die Bilder alle an Alf weitergab, und ärgerte sich über sich selbst, daß er so erschrocken war.
»Und das da«, fragte Alf, »was ist das?« Gloria ging zu ihm hinüber, um das Bild zu betrachten. Drei Augenpaare waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet.
Mosca lehnte sich zu Alf hinüber, und als er sah, was es war, fühlte er sich erleichtert. Jetzt erinnerte er sich. Er war auf einem Panzer gefahren, als es passierte.
Auf dem Foto war die zusammengesunkene Gestalt eines deutschen Soldaten mit seiner »Panzerfaust« zu sehen, der im Schnee lag; eine dunkle Linie zog sich von seinem Körper bis an den Rand des Bildes. Mosca selbst, seine M1 über die Schulter geschwungen, stand über dem Toten und starrte in die Kamera. In seiner Winteruniform sah er sonderbar unförmig aus. Die Decke, in die er Löcher für Kopf und Arme geschnitten hatte, hing wie ein Hemd unter seiner Uniformjacke. Er schien wie ein erfolgreicher Jäger dazustehen, der sich anschickte, das erlegte Wild nach Hause zu tragen.
Nicht auf dem Bild waren die brennenden Panzer auf der schneebedeckten Ebene. Nicht auf dem Bild waren die verkohlten Leichen, die wie Abfall über das weiße Feld gestreut lagen. Der Deutsche war ein guter Soldat gewesen.
»Mein Kumpel hat das Bild mit der Leica von dem Deutschen geknipst.« Mosca wandte sich wieder seinem Glas zu, als er sah, daß die anderen noch warteten.
»Mein erstes Opfer«, sagte er. Es sollte wie ein Scherz klingen. Aber doch war es, als ob er vom Eiffelturm oder den Pyramiden gesprochen hätte, um die Kulisse zu bezeichnen, vor der er gestanden war.
Seine Mutter betrachtete die anderen Fotos. »Wo wurde das aufgenommen?« fragte sie. Mosca setzte sich neben sie. »Das war in Paris, bei meinem ersten Urlaub«, antwortete er und legte seinen Arm um die Hüfte seiner Mutter.
»Und das?« fragte seine Mutter.
»Das war in Vitry.«
»Und das?«
»Das war in Aachen.«
Und das? Und das? Und das? Er nannte die Städte und erzählte lustige kleine Geschichten. Die Drinks hatten ihn in gute Laune versetzt, aber er dachte dabei: Das war in Nancy, wo ich zwei Stunden warten mußte, bevor ich zum Bumsen dran kam, das war in Dombasle, wo ich den toten, nackten Deutschen fand. Seine Eier waren groß wie Melonen. »Toter Deutscher im Haus«, hatte auf dem Plakat an der Tür gestanden. Und das war nicht gelogen gewesen. Er konnte heute noch nicht verstehen, wie sich einer die Mühe hatte nehmen können, das hinzuschreiben, selbst als Witz. Und das war in Hamm, wo er nach drei Monaten zu seiner ersten Mieze und seinem ersten Tripper gekommen war. Und das und das und das, das waren die zahllosen Städte, wo die Deutschen, Männer, Frauen und Kinder, in ihren Gräbern aus Schutt und Geröll lagen und einen unerträglichen Gestank verbreiteten.
Immer wieder stand er da, wie ein Mann, der sich in der Wüste fotografieren läßt. Er, der siegreiche Held, stand auf den niedergewalzten, zu Staub zermahlenen Resten von Fabriken, Wohnhäusern, menschlichen Knochen – wie wogende Sanddünen verloren sie sich in der Ferne.
Mosca setzte sich auf das Sofa zurück. Er paffte seine Zigarre. »Wie wär’s mit Kaffee?« fragte er. »Ich mach einen.« Er ging in die Küche hinaus, und Gloria folgte ihm. Gemeinsam richteten sie die Tassen her, schnitten die mit Schlagsahne gekrönte Torte auf, die sie aus dem Kühlschrank geholt hatte. Und während der Kaffee auf dem Herd siedete, schmiegte sie sich an ihn an und flüsterte: »Ich liebe dich, Walter, ich liebe dich.«
Sie brachten den Kaffee ins Wohnzimmer, und nun war die Reihe an ihnen, Mosca Geschichten zu erzählen. Wie Gloria in drei Jahren nie mit jemandem ausgegangen war, wie Alf bei einem Autounfall in einem Armeelager im Süden sein Bein verloren hatte und wie seine Mutter als Angestellte in einem großen Kaufhaus wieder arbeiten gegangen war. Sie hatten alle ihre Erlebnisse gehabt, aber nun war der Krieg Gott sei Dank vorüber, und die Moscas waren wohlbehalten durchgekommen. Ein Bein war verloren, doch wie Alf sagte, gab es ja genügend moderne Transportmittel, und wozu brauchte man da noch Beine, und jetzt saßen sie alle zufrieden, gesund und munter in dem kleinen Zimmer beisammen.
Vor dem Feind, der so weit fort und so völlig vernichtet war, brauchten sie keine Angst mehr zu haben. Der Feind war umzingelt, besetzt, Hunger und Krankheiten gaben ihm den Rest. Nie wieder würde er die körperliche und auch nicht die seelische Kraft haben, sie zu bedrohen. Und als Mosca in seinem Sessel einnickte, betrachteten sie ihn minutenlang mit stiller, den Tränen naher Freude. Sie, die ihn liebten, konnten es fast nicht fassen, daß er so weit durch Zeit und Raum gereist war und wie durch ein Wunder unverletzt den Weg zurückgefunden hatte.
Es gelang Mosca erst am dritten Abend, mit Gloria allein zu sein. Am zweiten Abend waren sie bei ihr zu Hause gewesen, wo sich seine Mutter und Alf zusammen mit Glorias Schwester und Vater über alle Einzelheiten in bezug auf die Hochzeit absprachen – aus reiner Freude und Begeisterung, daß alles so gutgegangen war, und nicht, weil sie sich einmischen wollten. Sie waren übereingekommen, daß so bald wie möglich Hochzeit gefeiert werden sollte, aber erst wenn Walter eine feste Stellung hatte. Mosca war mehr als einverstanden gewesen. Und Alf hatte ihn überrascht. Der schüchterne Alf war zu einem selbstbewußten, verständigen Mann herangewachsen, und die Rolle des Familienoberhauptes lag ihm ganz vortrefflich.
An diesem dritten Abend waren seine Mutter und Alf ausgegangen.
»Vergiß nicht, auf die Uhr zu schauen«, hatte Alf gesagt und gelacht, »um elf sind wir wieder da.« Seine Mutter hatte Alf aus der Tür geschoben und gemeint: »Wenn du mit Gloria ausgehen solltest, vergiß nicht, die Tür abzuschließen.«
Der zweifelnde Ton in ihrer Stimme hatte Mosca amüsiert. Es klang, als ginge es gegen ihre innere Überzeugung, ihn mit Gloria allein in der Wohnung zu lassen. Du meine Güte, dachte er und streckte sich auf dem Sofa aus.
Er versuchte sich zu entspannen, aber er war zu nervös. Er sprang auf und mischte sich einen Drink. Er lehnte sich ans Fenster und lächelte. Wie würde es wohl werden? Die wenigen Wochen bevor er eingeschifft worden war, hatten sie einige Abende in einem kleinen Hotelzimmer verbracht, aber er konnte sich jetzt kaum noch daran erinnern. Er drehte das Radio an und ging dann in die Küche, um auf die Uhr zu sehen. Es war schon bald halb neun. Wieder ging er ans Fenster, aber es war schon zu dunkel, um noch etwas sehen zu können. Gerade als er sich umdrehte, klopfte es an der Tür, und Gloria betrat die Wohnung.
»Hallo, Walter«, begrüßte sie ihn, und Mosca bemerkte, daß ihre Stimme ein wenig zitterte. Sie zog sich den Mantel aus. Sie trug eine Bluse mit nur einigen wenigen großen Knöpfen und dazu einen weiten Faltenrock.
»Endlich allein«, witzelte er und legte sich wieder auf das Sofa. »Mach uns was zu trinken.« Gloria setzte sich auf das Sofa und beugte sich über ihn, um ihn zu küssen. Er legte seine Hände auf ihre Brüste; es war ein langer Kuß. »Ich hole die Drinks«, sagte sie und stand auf.
Sie tranken. Das Radio spielte leise, und die Stehlampe warf ihren warmen, gelben Schein über das Zimmer. Er zündete zwei Zigaretten an und gab ihr eine. Sie rauchten, und als er seine Zigarette ausdrückte, sah er, daß sie mit ihrer noch nicht fertig war. Er nahm sie ihr aus der Hand und machte sie sorgfältig im Aschenbecher aus.
Er zog Gloria zu sich herunter, so daß sie quer über ihm lag. Er knöpfte ihr die Bluse auf, schob seine Hand in ihren Büstenhalter und küßte sie. Mit der anderen Hand fuhr er ihr unter den Rock.
Gloria setzte sich auf und rückte ein Stück weg. Mosca war überrascht.
»Ich will nicht bis zum letzten gehen«, sagte Gloria. Die jungmädchenhafte Phrase ärgerte ihn, und ungeduldig griff er nach ihr. Sie stand auf und kehrte ihm den Rücken zu.
»Ich meine es ernst«, sagte sie.
»Zum Teufel«, protestierte Mosca, »in den zwei Wochen bevor ich eingeschifft wurde, war alles okay. Was stört dich denn jetzt?«
»Ich weiß.« Gloria lächelte ihm zärtlich zu, und er fühlte Zorn in sich aufsteigen. »Aber das war damals anders. Du gingst fort, und ich liebte dich. Wenn ich es jetzt täte, würdest du schlecht von mir denken. Sei nicht böse, Walter, aber ich habe mit Emmy darüber gesprochen. Du bist jetzt so anders, daß ich mit jemandem reden mußte. Und wir glauben, daß es so am besten ist.«
Mosca zündete sich eine Zigarette an. »Deine Schwester ist ein dummes Luder.«
»Sag so etwas nicht, Walter. Wenn ich dir nicht gebe, was du haben willst, so nur, weil ich dich wirklich liebe.«
Mosca mußte sich sehr anstrengen, um nicht zu lachen; beinahe wäre er an seinem Drink erstickt. »Sieh mal«, sagte er, »wenn wir in den letzten zwei Wochen nicht miteinander geschlafen hätten, ich würde mich gar nicht an dich erinnert oder dir geschrieben haben. Du würdest mir überhaupt nichts bedeutet haben.«
Er sah, wie sie errötete. Sie ging zum Lehnsessel ihm gegenüber und setzte sich nieder.
»Ich habe dich auch schon vorher geliebt«, entgegnete sie. Er sah, daß ihr Mund zuckte, und warf ihr das Zigarettenpäckchen hinüber. Er schlürfte seinen Drink und versuchte, sich über seine Empfindungen klarzuwerden.
Sein Verlangen war erloschen, und er fühlte sich sogar erleichtert. Warum, wußte er nicht. Er zweifelte nicht daran, daß es ihm ein leichtes sein würde, Gloria mit Worten oder durch Drohungen zu bewegen, das zu tun, was er wollte. Er wußte, daß sie nachgeben würde, wenn er es darauf anlegte. Er wußte, daß er zu schroff gewesen war; etwas Schläue und ein wenig Geduld, und der Abend könnte noch einen sehr netten Abschluß haben. Zu seiner Überraschung aber stellte er fest, daß ihm die Sache die Mühe nicht wert war. Er empfand überhaupt kein Verlangen.
»Ist schon gut. Komm zu mir.«
Gehorsam folgte sie seiner Aufforderung. »Du bist nicht böse?« fragte sie leise.
Er küßte sie und lächelte. »Nein. Es ist nicht so wichtig«, antwortete er, und er sprach die Wahrheit.
Gloria legte ihren Kopf auf seine Schulter. »Bleiben wir doch so hier zusammen sitzen, und plaudern wir. Seit du zurück bist, hatten wir noch keine Gelegenheit, miteinander zu sprechen.«
Mosca löste sich von ihr. »Wir gehen ins Kino«, sagte er.
»Ich möchte hierbleiben.«
»Entweder wir gehen ins Kino, oder wir gehen ins Bett«, entgegnete Mosca mit vorsätzlicher, brutaler Sorglosigkeit.
Sie stand auf und blickte ihm ins Gesicht. »Und das eine ist dir ebenso lieb wie das andere.«
»Stimmt genau.«
Er hatte erwartet, daß sie ihren Mantel anziehen und sich empfehlen würde. Aber sie wartete stillschweigend, bis er sich gekämmt und seine Krawatte umgebunden hatte. Dann gingen sie ins Kino.
Es war einen Monat später, als Mosca gegen Mittag nach Hause kam. Alf, seine Mutter und Glorias Schwester Emmy saßen in der Küche und tranken Kaffee.
»Möchtest du auch eine Schale?« fragte seine Mutter.
»Ja, ich mach mich nur etwas frisch.« Mosca ging ins Badezimmer und lächelte grimmig, als er sich das Gesicht abtrocknete, bevor er in die Küche zurückkehrte.
Alle schlürften Kaffee, und dann eröffnete Emmy den Angriff.
»Es ist nicht recht, wie du Gloria behandelst. Sie hat drei Jahre auf dich gewartet, sie ist nie mit einem Mann ausgegangen und hat viele Chancen verpaßt.«
»Chancen wofür?« fragte Mosca. Dann lachte er. »Wir werden schon zurechtkommen. Es braucht alles seine Zeit.«
»Du warst gestern mit ihr verabredet und bist einfach nicht erschienen«, hielt Emmy ihm vor. »Jetzt erst kommst du nach Hause. Das ist nicht anständig, wie du dich benimmst. «
Seine Mutter sah, daß Mosca zornig wurde, und versuchte, die Wogen zu glätten. »Gloria hat hier bis zwei Uhr früh gewartet. Du hättest anrufen sollen.«
»Und wir wissen ja alle, was du treibst«, entrüstete sich Emmy. »Du vernachlässigst ein Mädchen, das drei Jahre auf dich gewartet hat, und ziehst mit einem Flittchen rum, das schon drei Abtreibungen gehabt hat und weiß Gott was sonst noch.«
Mosca zuckte die Achseln. »Ich kann mich nicht jeden Abend mit deiner Schwester treffen.«
»Natürlich nicht! Ein so bedeutender Mann wie du!« Er stellte überrascht fest, daß sie ihn wirklich haßte.
»Ihr wart euch ja alle einig, daß wir warten sollten, bis ich eine feste Stellung habe«, hielt Mosca ihr entgegen.
»Ich wußte nicht, daß du dich als gemeiner Kerl entpuppen würdest. Wenn du sie nicht heiraten willst, sag es Gloria. Keine Bange, sie findet schon einen anderen.«
Alf mischte sich ein. »Das ist doch Unsinn. Natürlich will Walter sie heiraten. Es ist noch alles ein bißchen fremd für ihn; er wird sich schon eingewöhnen. Wir müssen ihm dabei helfen.«
»Wenn Gloria mit ihm schlafen würde, wäre alles wunderbar«, stichelte Emmy ironisch. »Dann wärst du gleich wieder in Ordnung, nicht wahr, Walter?«
»So kommen wir nicht weiter«, sagte Alf. »Fassen wir doch das Wesentliche ins Auge. Du bist wütend, weil Walter ein Verhältnis hat und sich gar nicht die Mühe nimmt, es zu verheimlichen, was ja das mindeste ist, was er tun könnte. Also schön. Gloria hängt zu sehr an Walter, um ihm den Laufpaß zu geben. Ich halte es für das beste, daß wir einen Termin für die Hochzeit festsetzen.«
»Und meine Schwester soll weiter arbeiten gehen, während er sich mit Huren herumtreibt, wie er das schon in Deutschland gemacht hat?«
Mosca streifte seine Mutter mit einem vorwurfsvollen Blick, und sie schlug die Augen nieder. Stille trat ein. »Ja«, sagte Emmy. »Deine Mutter hat Gloria von den Briefen erzählt, die du von diesem Mädchen aus Deutschland bekommst. Du solltest dich schämen, Walter, wirklich, du solltest dich schämen.«
»Diese Briefe besagen gar nichts«, erwiderte Mosca. Er sah die Erleichterung auf ihren Gesichtern.
»Er wird sich eine Stellung besorgen«, erklärte seine Mutter, »und sie können hier wohnen, bis sie selbst etwas finden.« Mosca schlürfte seinen Kaffee. Einen Augenblick lang war er zornig gewesen, aber jetzt verspürte er nur noch den Wunsch, dieses Zimmer verlassen zu können, sie alle nicht mehr sehen zu müssen. Er hatte die Nase voll.
»Aber er muß aufhören, sich mit diesem Flittchen herumzutreiben«, ereiferte sich Emmy.
»Die Sache hat nur einen Haken«, warf Mosca in sanftem Ton ein. »Ich habe nicht die Absicht, einen Termin für die Hochzeit festzusetzen.«
Überrascht sahen sie ihn an. »Ich bin mir noch nicht darüber klar, ob ich überhaupt heiraten will«, fügte er lachend hinzu.
»Was?« schrie Emmy. »Was?« Sie war so wütend, daß sie nicht weiterreden konnte.
»Und hör endlich auf, auf den drei Jahren herumzureiten. Was, zum Teufel, soll es mir ausmachen, wenn sie drei Jahre nicht gefickt worden ist? Glaubst du vielleicht, daß ich deswegen nachts nicht schlafen konnte? Zum Teufel, ist ihr Ding vielleicht ausgekühlt, nur weil sie’s nicht gebraucht hat? Ich hatte andere Sorgen.«
»Bitte, Walter«, murmelte seine Mutter.
»Scheiße«, sagte Mosca. Seine Mutter stand auf und ging zum Herd; er wußte, daß sie weinte.
Alle waren plötzlich aufgestanden, und Alf, sich auf den Tisch stützend, schrie zornig: »Alles, was recht ist, Walter, man kann das mit dem Eingewöhnen auch zu weit treiben!«
»Und ich finde überhaupt, daß man dich viel zu sehr verwöhnt hat, seitdem du wieder daheim bist«, keifte Emmy.
Auf all das gab er keine Antwort. Er mußte ihnen genau darlegen, welche Gefühle ihn bewegten. »Leck mich doch am Arsch«, sagte er. Seine Worte waren zwar an Emmy gerichtet, aber sein Blick umfaßte alle.
Er erhob sich, um zu gehen, doch Alf, sich auf den Tisch stützend, stellte sich ihm in den Weg und brüllte: »Verdammt, du gehst zu weit! Entschuldige dich, hörst du, entschuldige dich!«
Mosca schob ihn zur Seite und sah zu spät, daß Alf seine Prothese nicht angeschnallt hatte. Alf stürzte nieder, und sein Kopf schlug gegen den Fußboden. Die zwei Frauen schrien auf. Mosca beugte sich schnell über seinen Bruder, um ihn aufzuheben. »Hast du dich verletzt?« fragte er. Alf schüttelte den Kopf, schlug die Hände vors Gesicht und blieb am Boden sitzen. Mosca verließ die Wohnung. Er vergaß nie, wie seine Mutter weinend und händeringend am Herd stand.
Als er das letztemal in die Wohnung kam, hatte seine Mutter auf ihn gewartet. Sie war den ganzen Tag nicht weg gewesen.
»Gloria hat dich angerufen«, sagte sie.
Mosca nickte.
»Wirst du jetzt packen?« fragte seine Mutter zaghaft.
»Ja.«
»Soll ich dir helfen?«
»Nein«, antwortete er.
Er ging in sein Zimmer und nahm die zwei neuen Koffer heraus, die er gekauft hatte. Er steckte sich eine Zigarette in den Mund, suchte in seinen Taschen vergeblich nach Streichhölzern und ging in die Küche, um sich welche zu holen.
Seine Mutter saß auf einem Stuhl. Sie hielt sich ein Taschentuch vors Gesicht und weinte leise.
Er nahm die Streichhölzer und wollte gehen.
»Warum behandelst du mich so?« fragte seine Mutter. »Was habe ich dir getan?«
Er empfand kein Mitleid, und auch ihre Tränen berührten ihn nicht, aber er wollte keine Szene. Er versuchte, ruhig mit ihr zu sprechen und sie seine Verärgerung nicht merken zu lassen.
»Du hast gar nichts getan. ich fahre fort; es hat nichts mit dir zu tun.«
»Warum redest du immer mit mir, als ob ich eine Fremde wäre?«
Ihre Worte bewegten ihn, aber er war keiner liebevollen Geste fähig. »Ich bin einfach nervös«, antwortete er. »Wenn du zu Hause bleibst, hilf mir packen.«
Sie ging mit ihm in sein Zimmer, faltete seine Kleider sorgfältig und legte sie in die Koffer.
»Brauchst du Zigaretten?« fragte sie.
»Nein, ich bekomme welche auf dem Schiff.«
»Ich lauf schnell hinunter und hol dir welche; man weiß ja nie.«
»Auf dem Schiff kosten sie nur fünfundzwanzig Cents«, entgegnete er. Er wollte sich nichts von ihr schenken lassen.
»Zigaretten kann man immer brauchen«, sagte sie und verließ die Wohnung.
Mosca saß auf seinem Bett und starrte auf Glorias Bild, das an der Wand hing. Er empfand keinerlei Gefühle. Es hat nicht geklappt, dachte er. Schade. Er bewunderte ihrer aller Geduld, denn er wußte, wie sehr sie sich bemüht hatten und wie gering sein Beitrag gewesen war. Er zerbrach sich den Kopf, was er seiner Mutter sagen sollte, um ihr klarzumachen, daß sie nichts tun, daß sie nichts ändern konnte, daß die Art seines Handelns auf Umständen beruhte, die weder er noch sie beeinflussen konnten.
Im Wohnzimmer läutete das Telefon. Er nahm den Hörer ab. Es war Glorias Stimme – unpersönlich, aber freundlich.
»Wie ich höre, fährst du morgen. Soll ich heute abend kommen, um dir Lebewohl zu sagen, oder genügt es telefonisch?«
»Wie du magst«, antwortete Mosca, »aber gegen neun muß ich weg.«
»Dann komme ich vorher«, sagte sie. »Keine Sorge, ich komme nur, um dir Lebewohl zu sagen.« Und er wußte, daß sie die Wahrheit sprach, daß ihr nichts mehr an ihm lag, daß er nicht mehr der Mann war, den sie geliebt hatte, und daß die Freundlichkeit, mit der sie sich verabschieden wollte, eigentlich Neugierde war.
Als seine Mutter zurückkam, hatte er einen Entschluß gefaßt. »Mom«, sagte er, »ich gehe jetzt. Gloria hat angerufen. Sie kommt heute abend rüber, und ich möchte ihr nicht mehr begegnen.«
»Du meinst jetzt? Jetzt gleich?«
»Ja.«
»Aber du könntest doch wenigstens deinen letzten Abend zu Hause verbringen«, wandte sie ein. »Alf muß bald kommen; du könntest dich doch wenigstens noch von deinem Bruder verabschieden.«
»Leb wohl, Mom«, sagte er. Er beugte sich vor und küßte sie auf die Wange.
»Warte«, bat sie ihn, »du hast deine Tasche vergessen.« So wie sie es früher so oft getan hatte, wenn er Korbball spielen ging, und später, als er eingerückt war, nahm sie die kleine, blaue Tasche und stopfte hinein, was er brauchen würde. Nur daß sie ihm jetzt statt der mit Seide überzogenen Turnhose und den ledernen Knieschützern sein Rasierzeug, Unterwäsche zum Wechseln, Handtuch und Seife hineinpackte. Dann nahm sie ein Stück Bindfaden aus einer der Schreibtischladen und knüpfte die Tasche an den Griff eines seiner Koffer.
»Ach«, jammerte sie, »was die Leute jetzt alles reden werden! Sie werden denken, daß es meine Schuld ist, daß ich dich nicht glücklich gemacht habe. Und so, wie du Gloria behandelt hast, könntest du doch wenigstens heute abend mit ihr sprechen und dich verabschieden und nett zu ihr sein, damit sie sich nicht kränkt.«
»Wir haben es alle nicht leicht«, entgegnete Mosca. Er küßte sie noch einmal, aber bevor er die Wohnung verlassen konnte, hielt sie ihn am Ärmel fest.
»Gehst du wegen dieses Mädchens nach Deutschland zurück?« Es war Mosca völlig klar, daß es ihren Schmerz lindern würde, wenn er ja sagte, daß er sie damit von aller Schuld an seiner Flucht freisprechen würde, aber er konnte nicht lügen.
»Eigentlich nicht«, antwortete er. »Wahrscheinlich hat sie sich schon einen anderen GI zugelegt.« Und während er es laut und in aller Offenheit aussprach, wunderte er sich, wie falsch es klang, so als ob die Wahrheit, die er ihr sagte, eine Lüge wäre, um sie zu verletzen.
Sie küßte ihn und ließ ihn gehen. Auf der Straße richtete er seinen Blick noch einmal nach oben und sah seine Mutter am geschlossenen Fenster stehen. Sie hielt sich ein Taschentuch vor das Gesicht. Er stellte die Koffer nieder, winkte ihr zu und sah, daß sie vom Fenster weggegangen war. Und weil er Angst hatte, sie könnte herunterkommen und ihm auf der Straße eine Szene machen, nahm er seine Koffer auf und ging schnell zur Hauptstraße hinüber, wo er ein Taxi bekommen würde.
Aber seine Mutter saß auf dem Sofa und weinte vor Kummer, weil sie sich gedemütigt fühlte und weil sie sich schämte. In ihrem Innersten wußte sie, daß ihr Kummer vielleicht größer sein würde, wenn er auf einem unbekannten Strand gefallen und, das weiße Kreuz über seinem Körper, eines von Tausenden, in fremder Erde begraben worden wäre. Doch dann würde sie sich nicht zu schämen brauchen, sie würde sich nach einiger Zeit mit dem Schicksal ausgesöhnt haben und bis zu einem gewissen Punkt sogar stolz sein können.
Dann würde sie nicht unter diesem nagenden Schmerz leiden, unter dem Wissen, daß er für immer fort war und daß sie, wenn er starb, nie an seiner Leiche klagen, nie ihn begraben und nie Blumen auf sein Grab legen konnte.
In dem Zug, der ihn in das Land des Feindes zurückbrachte, döste Mosca stehend vor sich hin und schwankte, den Bewegungen des Waggons folgend, von einer Seite zur anderen. Verschlafen ging er zu seiner Bank zurück und streckte sich darauf aus. Doch wie er da lag, hörte er das Stöhnen des Verwundeten, hörte er ihn mit den Zähnen klappern, denn erst jetzt protestierte der Körper des Schlafenden gegen der Welt sinnlose Wut. Mosca stand auf und ging zu den GIs. Die meisten Soldaten schliefen, und nur drei dicht beieinander brennende Kerzen waren von einem flackernden Lichtschein umgeben. Mulrooney lag zusammengekrümmt auf einer Bank und schnarchte, und zwei GIs spielten, ihre Karabiner neben sich, Rummy und tranken aus einer Flasche.
»Kann mir einer von euch eine Decke leihen?« fragte Mosca leise. »Dem Burschen ist kalt.«
Einer der GIs warf ihm eine Decke zu. »Danke«, sagte Mosca.
Der GI zuckte die Achseln. »Ich muß sowieso aufbleiben und diesen Witzbold bewachen.«
Mosca warf einen Blick auf den schlafenden Mulrooney. Das Gesicht war ausdruckslos. Langsam öffneten sich die Augen, und er starrte ihn an wie ein dummes Tier, aber in dem Moment, bevor sie sich wieder schlossen, hatte Mosca ein Gefühl des Wiedererkennens. Du armer, blöder Hund, dachte er.
Er ging wieder zurück, deckte Mr. Gerald zu und streckte sich abermals auf seiner Bank aus. Diesmal schlief er schnell und leicht ein. Er schlief traumlos, bis der Zug in Frankfurt ankam und jemand ihn wachrüttelte.