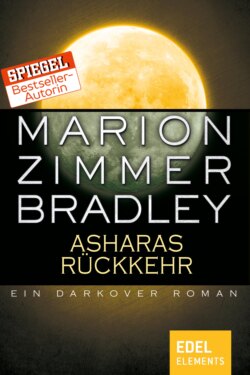Читать книгу Asharas Rückkehr - Marion Zimmer Bradley - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеMargaret öffnete die Augen und spürte eine harte, glatte Oberfläche unter ihrem Rücken. Über sich sah sie ein hohes Gebälk, das mit so komplizierten Mustern bemalt war, daß sich ihr der Kopf drehte und ihr Magen rebellierte. Wo war sie? Einen Augenblick lang konnte sie sich nicht erinnern. Sie schloß die Augen, um die Balken nicht mehr sehen zu müssen. Etwas Weiches, Schweres lag auf ihrem Körper. Sie legte die Hand darauf und fühlte den warmen, rauhen Kuß einer Wolldecke. Sie hatte den guten, sauberen Geruch von Bergbalsam. Sie hielt die Augen geschlossen und versuchte, normal zu atmen.
Als sie die Augen wieder aufschlug, blickte sie in das dunkle, bärtige Gesicht von Aaron MacEwan, der sie ängstlich anschaute. Sie spürte etwas unter ihrem Kopf und vermutete, daß es sich um einen Stoffballen handelte. »Ganz ruhig, Kind. Manuella bringt Ihnen eine Tasse Tee. Sie haben uns einen schönen Schrecken eingejagt, einfach so ohnmächtig zu werden. Aber ich kann’s Ihnen nicht verübeln. Von dieser Hitzewelle wird mir auch manchmal schwindlig. Es ist dann so stickig im Laden.«
Hitzewelle! Sie fühlte sich wie ein Eisblock. Ihre Hände und Füße schmerzten vor Kälte, während ihre Brust naß von kaltem Schweiß war. Margaret hatte das Bedürfnis, wie von Sinnen zu schreien oder zu lachen. Sie atmete rauh und tief und zwang sich zu einer Ruhe, die sie tief in ihrem Innern nicht fühlte. Die Erlebnisse des Vortags kehrten in ihr Gedächtnis zurück, und sie begriff, daß es für darkovanische Verhältnisse tatsächlich ein sehr warmer Tag war.
Margaret setzte sich mühsam auf, und die Welt drehte sich. Sie sank kraftlos wieder zurück, wütend, weil ihr Körper sie so im Stich ließ. Irgend etwas war passiert, etwas so Schreckliches, daß sie es nicht wissen wollte. Aber sie mußte es wissen! Es war dringend. Doch ihr Gehirn verweigerte die Mitarbeit.
Hände halfen ihr, sich aufzusetzen, zärtliche Hände, schwielige, von Arbeit abgenutzte Hände, echte Hände von echten Menschen. Eine Tasse mit starkem, aromatischem Tee wurde ihr an die Lippen gehalten. Sie war so durstig! Sie schluckte und verbrannte sich leicht die Zunge. Der Tee enthielt reichlich Honig, er war heiß und süß. Sie trank gierig, dann hustete sie prustend, weil ihr ein Tropfen in die falsche Kehle geraten war. Die fürchterliche Schwäche verließ ihren Körper allmählich, und sie leerte die Tasse mit langen, wenig anmutigen Zügen. Der Zucker wirkte auf ihren Blutkreislauf wie eine Droge, und die Erinnerung flutete zurück.
Ivor! Mit Ivor stimmt etwas nicht! Die Gewißheit, mit der sie das wußte, machte ihr angst. Sie konnte nicht sagen, woher sie es wußte, aber diesmal versuchte sie nicht, sich einzureden, daß nur ihre Phantasie am Werk war. Dafür war alles zu real. Ihre Zähne klapperten gegen den Rand der leeren Tasse, und sie zitterte am ganzen Leib.
Margaret widerstand dem Drang, von der festen Platte des langen Schneidetisches zu springen und zur Musikstraße zurückzulaufen. Nur die absolute Gewißheit, daß ihre Beine beim ersten Schritt nachgeben würden, ließ sie noch ein paar Minuten bleiben, wo sie war, und so langsam wie möglich atmen. Die Disziplin ihrer akademischen Ausbildung setzte sich durch, und langsam verging die Benommenheit, und ein wenig Kraft kehrte in ihre Glieder zurück.
»Bitte – ich muß sofort gehen!«
»Aber Sie sind krank, Domna.« Das war Manuella, deren Gesichtszüge vor Sorge ganz zerfurcht waren. Selbst in ihrem Gefühlsaufruhr bemerkte Margaret, daß die Sorge echt war, und sie war gerührt. Diese Leute waren Fremde, und doch benahmen sie sich, als läge Margaret ihnen am Herzen. Das berührte eine tiefe Sehnsucht in ihr, eine Wunde, von der sie bis zu diesem Augenblick gar nicht gewußt hatte, daß sie existierte.
Sie biß die Zähne zusammen und schob den Wunsch beiseite, sich einfach in die Freundlichkeit dieser Leute fallen zu lassen. Dann zog sie die Decke von den Beinen und nahm sich zusammen. »Das spielt keine Rolle. Ich muß sofort zum Haus von Meister Everard zurück!« Sie stellte ihre Füße auf den mit Stoffresten bedeckten Boden und torkelte wie ein Betrunkener. »Geremy, Ethan – bringt mich, so schnell ihr könnt, zurück!«
Beide Erwachsenen und die Kinder sahen einander hilflos an. Dann zuckte Aaron die Schultern, als wollte er sagen »Wie Sie meinen«. Margaret richtete sich auf und zog die verhaßte Uniformjacke nach unten, die unter den Achseln nach oben gerutscht war. Sie zitterte am ganzen Leib. Es gab eigentlich keinen Grund zur Eile, und tief in ihrem Herzen wußte sie das. Es war bereits zu spät. Aber sie wünschte sich verzweifelt, daß sie Unrecht hätte. Sie hatte einen lebhaften Eindruck von ihrem Taumelflug ins Dunkel, die Erinnerung an eine Hand, die ihr Herz umklammerte. Doch sie wußte, nicht ihr Herz hatte einen Anfall erlitten, sondern Ivors. Sie wünschte, es wäre nur ein Traum, aber sie wußte mit Bestimmtheit, daß es so real war wie die Hände, die ihr nun Hilfe anboten.
Vor dem Laden war das Licht in der Straße rot. Die große, blutrote Sonne war tief über die niedrigen Dächer der Häuser gesunken und warf lange Schatten zwischen sie. Margaret stürmte die Straße entlang, ihre Füße wirbelten, ihre Absätze schlugen hart auf das grobe Pflaster. Sie legte mit ihren langen Beinen ein Tempo vor, daß die beiden Jungen neben ihr bald keuchten. Ihr Puls hämmerte wie die Todestrommeln auf Vega VI und pochte in ihren Schläfen, bis ihr beinahe übel war. Sie rutschte mit einem Fuß aus, stürzte und fiel auf Knie und Hände. Der Schmerz ließ sie laut aufschreien, und sie fluchte fließender, als sie für möglich gehalten hätte. Die Burschen halfen ihr auf, und Margaret blickte wie aus großer Entfernung auf den Schnitt in einer Handfläche. Sie spürte, wie ihr unter der Uniform etwas warm am Bein hinablief. Ihr feines Haar hatte sich teilweise aus der Schmetterlingsspange gelöst und flatterte ihr ins Gesicht. Sie steckte die Strähnen ungeduldig wieder zurück, wobei sie sich frisches Blut auf die Stirn schmierte, ohne es zu bemerken.
Wo waren sie? Die Straßen kamen ihr endlos vor, verschlungen und verwinkelt im rotglühenden Licht der untergehenden Sonne. Wie lange war sie bewußtlos gewesen? Warum hatte sie Ivor allein gelassen, wenn sie doch spürte, daß er nicht ganz in Ordnung war? Ihre Füße bewegten sich schnell und mechanisch. Sie richtete ihre ganze Energie darauf, ihren Bestimmungsort zu erreichen, und versuchte, nicht zu denken, sich nicht vorzustellen, was sie bereits wußte, wenn sie auch nicht sagen konnte, wieso.
Die Haustür ging auf, bevor sie den hölzernen Türklopfer packen konnte. Meister Everard selbst stand blaß und entsetzt vor ihr, seine Haut war fast so bleich wie sein weißes Haar, und seine alten Zähne hoben sich gelb davon ab. Er hatte Tränen in den blauen Augen, als er ihr aufgelöstes Äußeres musterte.
»Ivor ...« keuchte sie mit schmerzender Brust.
»Liebes Kind, ich habe schlechte Nachrichten für ...«
»Er ist tot, nicht wahr?« Ihre Stimme klang ihr selbst barsch und grob in den Ohren, belegt und rauh wie der Ruf einer Dohle.
Everard nickte und zog sie ins Haus. »Ja, er ist tot. Der Bursche wollte ihn wecken und konnte es nicht. Er muß im Schlaf hinübergeglitten sein.«
»Aber er war nicht krank«, protestierte sie mit der hohen, schrillen Stimme eines übermüdeten, hysterischen Kindes. »Er darf einfach nicht tot sein«, beharrte sie stumpfsinnig.
Meister Everard führte sie zu einem Sessel, wobei er ihr freundlich die Hand tätschelte. »Wir wissen nicht, was geschehen ist, Kind. Er war alt. Er war müde. Wenn die Zeit eines Menschen gekommen ist, dann ist sie eben gekommen. Sein Gesicht war friedlich, ich glaube nicht, daß er überhaupt etwas gemerkt hat.«
»Ich muß zu ihm!«
»Nein. Sie sind nicht in der Verfassung, ihn zu sehen. Setzen Sie sich erst einmal hin und beruhigen Sie sich.«
»Aber ich muß ihn sehen – ich muß bei ihm sein!« Tränen der Hilflosigkeit strömten ihr über die Wangen.
Anya hastete durch das Zimmer. Sie trug eine Schüssel mit dampfendem Wasser und einen weichen Lappen. Leise schnalzend wischte sie die Tränen von Margarets Gesicht und das Blut von ihren aufgerissenen Händen. Margaret zuckte zusammen, als sie die Wunden reinigte und mit einer dicken Salbe einrieb, die scharf und erfrischend nach Kräutern roch. Hinter der Frau stand der Musikmeister, rang die Hände und wollte helfen, wurde jedoch angewiesen wegzubleiben.
Margaret war kurz davor, Anyas Hände wegzustoßen, diese beiden freundlichen Menschen, die sich um sie bemühten, anzubrüllen. Aber es mangelte ihr an Kraft, auch nur die Worte zu formen. Sie versuchte aufzustehen, aber ihre Beine versagten ihr den Dienst.
Sie kauerte sich in den Sessel und wünschte, sie könnte aus diesem Alptraum aufwachen. Sie wußte, es war Wirklichkeit, aber sie fühlte sich unendlich weit entfernt. Ihr Geist trieb ziellos umher, der Geruch der Salbe machte sie schläfrig. Sie dachte an Ethans falsche Aussprache von Thetis. Jetzt bin ich nicht mehr dazu gekommen, Ivor vom Planeten »Thesis« zu erzählen. Wie albern, jetzt daran zu denken, aber es hätte ihm gefallen. Neue Tränen traten ihr in die Augen.
»Kommen Sie jetzt mit ins Bett«, sagte Anya.
»Ich muß ihn sehen. Wirklich, es geht mir gleich besser, wenn ich ihn nur sehen kann.«
»Sie sind nicht in der ...«
»Anya – bring sie zu ihm. So findet sie keine Ruhe.« Meister Everards Stimme war schneidend, gequält und gebieterisch.
Die Haushälterin brummte etwas, sah den alten Mann an und nickte. Sie half Margaret die lange Treppe hinauf, dann gingen die beiden in Ivors Zimmer. Anya blieb in der Tür stehen, während Margaret ans Bett trat. Ihre Schritte waren nun zögernd. Es gab keinen Grund mehr zur Eile.
Das Zimmer lag auf der Nachmittagsseite des Hauses, so wie ihr eigenes auf der Morgenseite lag, und die Sonnenstrahlen drangen durchs Fenster und beleuchteten die Gestalt in dem riesigen Bett. Er wirkte so klein und friedlich, so, als würde er nur schlafen; Hunderte Male hatte sie ihn so schlafen sehen. Aber sie wußte, diesmal wachte er nicht mehr auf.
»Ivor«, flüsterte sie, dann wiederholte sie das Wort etwas lauter. Was hätte ich tun können? Nichts. Warum habe ich dann irgendwie das Gefühl, daß es meine Schuld ist? »Es tut mir leid! Warum mußtest du mich verlassen? Was soll ich Ida sagen? Wie soll ich ohne dich weitermachen?« Die Worte hörten sich töricht an, aber sie wußte, daß sie es nicht waren. Es waren einfach Worte, wie Menschen sie sprachen, wenn jemand starb.
»Ich habe dich geliebt, alter Mann. Habe ich dir das je gesagt? Habe ich dir gesagt, daß du ein Vater für mich warst in all den Jahren und daß ich für alle Anerkennung im Universum keine Sekunde der Zeit mit dir eintauschen würde?« Margaret ergriff die Hand des alten Mannes und verschränkte ihre fröstelnden Finger in seine kalten. Sie konnte noch den vertrauten Geruch seines Nachtgewands riechen, den Duft seines Gesichtswassers und das Zeug, das er in sein schütteres Haar gab.
Lange stand Margaret da, hielt die kühle Hand in der ihren und dachte an ihre gemeinsamen Jahre und seine vielen Freundlichkeiten. Schließlich ergriff die Einsamkeit von ihr Besitz. Er war tot, und sie würde das Beste daraus machen müssen, wenngleich sie im Augenblick nicht wußte, was das sein sollte. Sie legte seine Hand auf seine Brust, glättete die Laken ein wenig und berührte zärtlich seine faltige Wange. Dann drehte sie sich um. Sie konnte nichts mehr tun.
In diesem Moment traf sie die Erschöpfung wie ein Keulenhieb, und ihre Knie gaben nach. Sie taumelte gegen das große Bett und schlug sich das Schienbein so heftig an, daß ihr Sterne vor den Augen tanzten. Verbissen ignorierte sie den Schmerz. Er würde später auch noch dasein. Er würde immer dasein. Sie hatte keine Tränen. Sie war leer, bis auf das Gefühl von Schmerz und Verlust. Anya nahm sie sanft am Arm und führte sie zu Bett.
Wände; hohe Wände türmten sich vor ihr auf. Unter ihren kleinen Füßen waren große Quadrate aus Beton. Margaret fühlte sich so klein, so machtlos. Sie schaute die großen Skulpturen an, die um sie herumstanden. Da war eine lange Tastatur, die sich wie eine Meereswelle neben ihr erhob. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, eine der Tasten zu berühren; und ein leiser Glockenton klang in ihrem Ohr. Er erinnerte sie an etwas, aber sie wußte nicht, an was. Der Klang war der Klang von feinem Kristall, und er ließ sie erzittern.
Ein Bär, rund und massig, tanzte freundlich auf einem Podest. Neben ihm war ein langes Blech, das mit komplizierter Ceti-Tri-Model-Notenschrift bedeckt war. Margaret wollte sie entschlüsseln, denn Ceti-Notenschrift funktionierte gleichzeitig als Musik und als Sprache. Es war ein Code, und sie wußte, wie man ihn las, aber was sie sah, ergab keinen Sinn. Sie bewegte sich wie durch eine zähe, unsichtbare Flüssigkeit, langsam und mit Mühe. Sie starrte in die unsichtbare Flüssigkeit, während sie im Kreis in dem Skulpturengarten herumlief und einen Weg nach draußen suchte.
Eine gelbe Sonne, abscheulich für ihre Augen, brannte auf sie hinab, und es wurde dringend notwendig, ihr zu entfliehen. Sie ging an den Wänden entlang, schaute die Steine an und suchte nach einem Ausgang. Zuletzt fand sie eine Tür, die so klein war, daß sie sie zunächst übersehen hatte. So klein sie selbst war, die Tür war noch kleiner, nur wenig mehr als einen Fuß hoch, sie ging ihr kaum bis zum Knie. Sie griff hinunter und drehte an dem kleinen Metallknauf: Die Tür war verschlossen. Sie trommelte mit ihren kleinen Fäusten dagegen, drehte und zerrte, während die Statuen sich über ihre Bemühungen lustig zu machen schienen. Erschöpft lehnte sie ihren Kopf gegen die Tür und weinte.
Sie öffnete ihre geschwollenen Augenlider und spürte das Kissen unter ihrem Kopf. Die Bettdecke war feucht. Margaret blinzelte. Es war nicht sehr dunkel im Zimmer. Sie drehte den Kopf zum Fenster und entschied, daß es etwa in der Mitte des Nachmittags sein mußte, Ortszeit. Wieso war sie im Bett? Sie haßte es, tagsüber zu schlafen. Danach war sie immer ganz benebelt und schlechter Laune.
Wieso hatte sie am hellichten Tag geschlafen? Margaret drehte sich auf den Rücken und sah hinauf zu den reichverzierten Balken über ihr. Die Erinnerung stieg an wie ein Fluß und überflutete ihr Bewußtsein. Der Ohnmachtsanfall im Geschäft, der schreckliche Lauf zurück zu Meister Everards Haus, der Sturz auf dem Kopfsteinpflaster. Sie hob eine Hand und sah die saubere Mullbinde, die darum gewickelt war. Nein, sie hatte nicht phantasiert. Ivor war tot.
Tränen stiegen ihr erneut in die Augen und liefen ihr als lästiges Rinnsal in die Ohren. Ihre Trauer verhärtete sich zu einer Art Wut, zu dem Gefühl, wieder einmal im Stich gelassen worden zu sein! Sie hatte keine Vorstellung, woher diese Leere in ihr kam, die sie mit einer sinnlosen Wut erfüllte, für die sie kein konkretes Ziel hatte. Sie setzte sich auf und fluchte fließend in mehreren Sprachen, um die Wut mit Worten zu vertreiben, bis sie sich für sich selbst wie eine Verrückte anhörte. Margaret verstummte abrupt und ließ ihre Gedanken ziellos wandern. Sie wollte nicht nachdenken, denn Denken erfüllte sie mit Schmerz. Einen Moment lang wünschte sie sich, im Wein Vergessen suchen zu können, und dachte an den Senator mit seinen Anfällen von Trunksucht. Trank er deshalb? Zum ersten Mal verstand sie ihn beinahe und fand das Gefühl beunruhigend. Sie wollte ihren Vater nicht verstehen – niemals!
Sie verbannte ihn an den Ort in ihrem Bewußtsein, der für ihre verhaßtesten Erinnerungen bestimmt war, und ertappte sich dabei, daß sie an die kompliziert gereimten Couplets von Zeepangu dachte. Auf diesem nebelverhangenen Planeten wurde der Tod als unglaubliche Drückebergerei vor jeder Verantwortung angesehen. Die Trauernden weinten nicht und zeigten keinen Kummer. Statt dessen beschimpften sie den Leichnam und warfen die kleinen, zweizeiligen Gedichte ins Grab. Für einen Moment verstand sie dieses Gefühl der Wut und des Verlustes. Aber sie war keine Bewohnerin von Zeepangu, und sie hatte nicht das Verlangen, Ivor zu beschimpfen, weil er sie verlassen hatte. Sie wünschte sich nur verzweifelt, er wäre nicht gestorben, so vergeblich dieser Wunsch auch war. Wie war der Schmerz über den Tod zu ertragen?
Margaret war als naives kleines Siedlermädchen von sechzehn Jahren an der Universität eingetroffen. Dort war ihr alles sehr fremd und sonderbar erschienen, und sie hatte es gehaßt, bis ihr Ivor sowohl ein Zuhause als auch eine Richtung für ihr Leben gab. Sie hatte keine Vorstellung, wie unwissend sie war, bevor sie die Studenten von anderen Welten der Föderation kennenlernte, die alle ihre eigenen Gebräuche und Voreingenommenheiten hatten. Und jeder von ihnen war genauso provinziell wie sie gewesen und genauso überzeugt, daß es so, wie man die Dinge bei ihm zu Hause regelte, richtig war.
Der Unterschied zwischen Thetis und der Universität war der Unterschied zwischen Stadt und Land. Margaret hatte nicht vermutet, daß sie ein Kind vom Lande war, daß selbst die Tochter eines Senators unter gewissen Umständen eine Idiotin sein konnte. Was für eine Offenbarung das gewesen war! Sie hatte sich sehr gefürchtet, und dann hatten Ivor und Ida Davidson sie so herzlich aufgenommen. Sie konnte noch sowohl die schreckliche Einsamkeit jener Zeit nachempfinden als auch die Freude, von den gütigen Davidsons gerettet worden zu sein.
Eine Weile entspannte sie sich in der Wärme und Sicherheit ihrer Erinnerungen. Aber ihre Wut dauerte hartnäckig an wie ein erhitzter Ziegelstein, direkt unter ihrem Brustbein. Sie konnte die angenehmen Gefühle nicht festhalten, weil ihr Zorn ständig hochkochte, egal, wie sehr sie sich bemühte, ihn unten zu halten. Warum war sie so zornig? Sie war schließlich ein logisch denkender Mensch, eine ausgebildete Wissenschaftlerin, oder etwa nicht? Schlimmer noch, warum war sie wütend auf Ivor? Wie scheußlich!
Margaret hatte das starke Bedürfnis, die Quelle ihres Zorns zu entdecken, ihn klar zu umreißen, dann sauber zu einem Päckchen zu verschnüren und wegzuwerfen. Niemand, der ihr nahestand, war in ihrem bisherigen Leben gestorben. Das wußte sie mit Sicherheit. Sie setzte sich im Bett auf, zog die Knie an und stützte nachdenklich den Kopf in die Hände.
Nur leider ließen sich ihre Gefühle nicht hübsch analysieren und dann wegstecken. Sie waren wie ein Sack voll Katzen, die alle jaulten und kratzten. Es hatte nicht nur mit Ivor zu tun. Es war doch noch jemand gestorben, der ihr etwas bedeutete. Margaret dachte nach, aber sie konnte sich nicht vorstellen, wer, außer vielleicht ihre richtige Mutter, die erste Frau ihres Vaters. Sie dachte selten an diese Frau. Wenn sie es getan und Dio nach ihr gefragt hatte, wünschte sie sich nachher, sie hätte geschwiegen, weil Dio so gequält und sorgenvoll aussah. Oder die andere Frau, diese Thyra, von der sie sicher annahm, daß sie ein Teil des Rätsels war. War sie tot? Sie vermutete es, denn Meister Everard hatte in der Vergangenheitsform von ihr gesprochen.
Bäh! Sie stank nach Schweiß, Dreck und Elend, und mochte die Göttin wissen, wonach sonst noch. Margaret hielt es keinen Moment länger aus, stieß die Bettdecke zur Seite und hielt nach ihren Kleidern Ausschau. Ihre Uniform war nirgendwo zu sehen, aber die weiche darkovanische Kleidung, die sie gekauft hatte, hing in dem kleinen Schrank. Sie fühlte sich wundervoll an in ihren Händen, tröstend und Geborgenheit ausstrahlend.
Margaret steckte ihr Haar im Nacken zusammen und zog ihr Schlafgewand aus. Sie betrachtete das Licht und erkannte, daß sie rund um die Uhr geschlafen haben mußte. Ein Blick auf ihren Chronometer bestätigte ihr, daß sie tatsächlich einen ganzen Tag verloren hatte. Kein Wunder, daß sie sich fühlte, als wäre ihr Kopf in Watte gepackt. Sie zitterte am ganzen Leib und zog einen Morgenrock aus dem Schrank, den sie sich um den nackten Körper schlang, dann eilte sie zu der riesigen Badewanne, die, wie sie wußte, am Ende des langen Flurs auf sie wartete. Darkover mochte keine Elektrizität und Automobile zu bieten haben, aber es war äußerst kultiviert, was die Badesitten betraf.
Margaret lächelte beinahe und stellte fest, daß ihre Gesichtsmuskeln vor Unbeweglichkeit fast schmerzten. Sie wollte nie wieder lächeln! Sofort kam sie sich dumm vor. Sie war einfach immer noch wütend und würde es wahrscheinlich noch lange bleiben, auch wenn sie keinen konkreten Grund für ihre Wut entdeckte. Aber die Wut würde durch den Wunsch allein nicht vergehen. Sie würde auch wieder lächeln, sogar lachen – Ivor hätte es so gewollt. Aber noch nicht gleich. Für den Augenblick mußte sie sich damit abfinden, daß sie einige starke Empfindungen auf einmal hatte und daß keine davon sehr angenehm war. Sie seufzte tief, und ein Teil von ihr machte ihr Vorwürfe, weil sie gar so dramatisch war. Es war, als wäre eine Fremde in ihren Körper eingedrungen, während sie schlief, eine andere Margaret, von der sie gewußt hatte, daß sie in ihrer Seele lauerte und auf eine Gelegenheit wartete, die Herrschaft über ihren Körper zu übernehmen. Das war natürlich lächerlich, aber so fühlte sie sich.
Sie sank in die warmen Tiefen des Bades und griff nach einem grünen Glas, das am Rand der Wanne stand. Als sie ein wenig von dem Inhalt ins Wasser goß, war sie überwältigt von dem Duft. Er war süß und blumig – und irgendwie vertraut. Die kleine Tür aus ihrem Traum kam ihr lebhaft in den Sinn. Was lag hinter ihr? Es war gar keine richtige Tür, aber sie wußte, sie hatte irgendeine Bedeutung.
Sie schloß für einen Moment die Augen, und der süße Blumenduft schien sie zu beruhigen. Sie war wieder klein, und sie saß in einer Wanne mit warmem Wasser, das mit derselben grünen Mischung parfümiert war. Anmutige Arme hatten sie in die Wanne gehoben. Wessen Arme? Margaret war sich beinahe sicher, daß die Arme jener rothaarigen Frau gehörten, die durch ihre Alpträume spukte. Und da war noch jemand, eine Person, die sie nicht sehen konnte. Der silberhaarige Mann?
Und urplötzlich erinnerte sich Margaret an eine zweite Nacht kurz vor ihrer Abreise von Thetis, eine Nacht, die sie mit all den anderen aus ihrem Bewußtsein gesperrt hatte. Bevor sie abreiste, hatte sie tagelang vor Aufregung kaum geschlafen, hatte ein dutzendmal gepackt und wieder ausgepackt und sich nicht entscheiden können, was sie bei dem knappen Gewichtslimit mitnehmen sollte. Schließlich war sie nach unten gegangen, um sich etwas Langweiliges zum Lesen zu suchen, damit sie einschlafen konnte.
Der Alte saß am Kamin, ein Glas in der Hand. Ihre Erinnerung rekonstruierte jede Linie seines Gesichts; den dunklen, struppigen Bart, die tiefen Furchen zwischen seinen Augenbrauen und die Narben, die er mit hautfarbenem Make-up abdeckte, wenn er aus dem Haus ging. Als sie noch klein war, hatte sie ihn oft gefragt, woher die vielen Narben stammten, aber er hatte ihr nie geantwortet. Später hatte sie gelernt, keine Fragen zu stellen, sich an nichts zu erinnern und niemals seine strengen Befehle zu mißachten.
Er blickte auf, und ein halbes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Marja.« Er hatte sie immer so genannt. In ihrem Paß stand »Margaret«, aber Dio und der Senator nannten sie immer Marja.
»Aufgeregt?«
»Ein bißchen. Ich konnte nicht schlafen. Ich nehme an, ich komme auf dem Schiff dazu.«
»Das bezweifle ich«, sagte er. »Bei unserer Abreise von ... Als wir hier ankamen, warst du ziemlich krank. Anscheinend hast du meine Allergien auf die meisten Hyperraum-Medikamente geerbt, obwohl sie inzwischen ja ein paar neue entwickelt haben. Marja, erinnerst du dich überhaupt an irgend etwas, bevor du hierhergekommen bist?«
Obwohl er freundlich gesprochen hatte, blieb ihr aus irgendeinem Grund bei seiner Frage vor Entsetzen fast das Herz stehen. »Nicht an viel«, sagte sie. »Ich war ja praktisch noch ein Baby.«
»Aber nein. Du warst beinahe sechs, in dem Alter erinnert man sich schon an eine ganze Menge. Nichts? Nicht einmal in Träumen?«
»Eigentlich nicht.« Sechs? Da irrte er sich bestimmt. Wie hätte sie sechs Jahre ihres Lebens vergessen können? Margaret war zornig und fühlte sich betrogen. Es war ein alter und bitterer Zorn, und sie wünschte, sie hätte ihn nicht. Er stieg bei den merkwürdigsten Gelegenheiten in ihr auf – wenn Dio zu erklären versuchte, warum sich der Senator ihr gegenüber so komisch benahm, oder wenn sie Fragen stellte und man ihr befahl, still zu sein. »Träume? Natürlich träume ich ... wie alle Leute.«
»Wovon?« fragte er sofort.
»Ach, den üblichen Unsinn«, erwiderte sie gleichgültig. Die paar Monate im Jahr, in denen die drei zusammen waren, wenn der Senator nicht in irgendwelchen Angelegenheiten unterwegs war, hielten sie eine solche Distanz zueinander, daß sie so etwas wie ein Familienleben gar nicht hatten. Seine Frage kam ihr wie eine Verletzung der Privatsphäre vor, die jeder für sich aufgebaut hatte, und sie krümmte sich und wünschte, sie wäre in ihrem Zimmer geblieben. »Symbolische Sachen. Verschlossene Räume. Türen. Wände. Hinter einer Tür ist etwas sehr Kostbares eingesperrt.«
Sein Blick hellte sich auf, als sie das sagte. »Zum Beispiel?«
»Ein großer ... Edelstein. Spielt es eine Rolle?« Ihr war nicht wohl.
»Möglicherweise. Noch etwas?«
»Nein, eigentlich nicht.« Aber da war noch etwas.
Er mußte etwas ahnen, denn er sagte, durchaus freundlich: »Erzähl mir davon, Kind.«
»Ach nichts. Manchmal träume ich von einer kleinen Tür, die anscheinend ganz furchtbar ist. Ich weine und schlage an die Tür, aber ich komme nicht hinein. Oder vielleicht nicht hinaus. Das kann man in Träumen nie wissen. Ich bin sehr klein, aber die Tür ist noch kleiner, und dann ...« Sie hielt inne, überwältigt von einem Gefühl, das sie nicht benennen konnte. »Dann seid du und Dio bei mir, so wie ihr immer seid.« Aber ihr wart nicht da, als ich eingeschlossen wurde! Es war bemerkenswert, wie wütend sie wurde, wenn sie an den Traum dachte. Sie hoffte, er hatte ihre Gedanken nicht gehört – manchmal schien es, als wäre er dazu fähig –, denn sie wollte nicht, daß er erfuhr, wie wütend sie war.
Offenbar hatte er die heftigen Gefühlswallungen, die ihr junges Herz erschütterten, nicht aufgefangen, oder er war schon zu betrunken, um noch etwas zu bemerken. »Komm, setz dich, Marja; hier auf den Boden, so wie früher, als du noch klein warst.«
Einen Augenblick lang war das Angebot verlockend. Sie hatte es als kleines Mädchen sehr gemocht, sich neben ihn vor den Kamin zu kuscheln, aber jetzt kam es ihr lächerlich vor. »Ich bin nicht dein Hündchen.«
»Nein«, erwiderte er, und seine ruhige Stimmung verschwand plötzlich und unerklärlich, wie so oft, wenn er trank. »Du bist eine verteufelte, rothaarige Hexe – genau wie deine Mutter.«
»Das ist eine schöne Art, über deine tote Frau zu sprechen!« brauste sie auf. Dann schauderte sie. Es war gefährlich, ihn zu reizen, wenn er in dieser Stimmung war.
Der Senator schaute verblüfft. »Marjorie? Wieso glaubst du, daß ich sie gemeint habe? Ich habe sie mehr geliebt, als sich in Worten sagen läßt«, entgegnete er ein wenig freundlicher. »Aber sie war nicht deine richtige Mutter, den Göttern sei’s geklagt.«
»Dio ist die einzige Mutter, die ich je gekannt habe. Aber ich dachte, meine leibliche Mutter wäre deine erste Frau gewesen, auch wenn du nie von ihr gesprochen hast. Ich war einfach der Meinung, du hast sie so sehr geliebt, daß du es nicht konntest.« Die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, auch wenn sie versuchte, sie zurückzuhalten. Margaret wußte, wie gefährlich es war, den Alten zur Rede zu stellen, und sie war überrascht von sich selbst. Seit sie beschlossen hatte, auf die Universität zu gehen, war alles so verwirrend. Er war immer noch nicht glücklich über ihre Wahl, aber er sagte nie, warum.
Manchmal schienen Geheimnisse das luftige Haus wie mit einem Nebel zu erfüllen, mit dem Geruch von uralter Wut und Trauer. Margaret war so daran gewöhnt, daß sie selten Fragen stellte. Sie versuchte, seine Stimmung zu erraten, aber es gelang ihr nicht, sie biß sich auf die Unterlippe und trat von einem Fuß auf den anderen.
»Marjorie?« sagte er unbedacht. »Nein, deine Mutter war Marjories Schwester, Thyra.«
Margaret bemühte sich, diesen neuen und unerwünschten Brocken an Information zu verdauen. Wer? Sie kannte diesen Namen – manchmal rief er ihn im Schlaf. Es lief ihr jedesmal kalt über den Rücken. Sie wäre jetzt gern gegangen, aber ihre Neugier behielt die Oberhand. »Ich habe ja schon von ziemlich schrägen Hochzeitsbräuchen gehört, aber der ist neu! Wird das erste Kind immer von der Schwester der Frau zur Welt gebracht?« Sie war sarkastisch und sich dessen bewußt, aber sie wäre lieber gestorben, als sich anmerken zu lassen, daß die Sache sie interessierte.
Er lachte nicht. »Es war keine Absicht«, sagte er und schaute freudlos. Margaret war gerade alt genug, um zu glauben, daß sie verstand, und verlegen zu werden. Ob seinetwegen oder ihretwegen, war ihr nicht ganz klar.
»Weiß Dio es?«
»Ja, natürlich. Ich habe ihr die ganze Sache erzählt, als ich ... als ich es selbst herausfand«, sagte er. »Wußtest du, daß Dio und ich auch ein Kind hatten?« Der Schmerz in seiner Stimme ließ sie zusammenfahren.
»Nein«, sagte sie, etwas weniger grob. »Das wußte ich nicht.« »Deshalb war Dio so froh, daß sie dich hatte.«
»Aber warum hattet ihr nie andere Kinder?« Sie hatte sich nach Brüdern und Schwestern gesehnt, nach einer großen, betriebsamen Familie wie bei den Bewohnern von Thetis. Margaret hatte sich immer ein bißchen betrogen gefühlt, weil sie ein Einzelkind war.
»Ich habe mich nicht getraut«, sagte er rauh. Ein schreckliches Bild blitzte in ihrem Kopf auf, von einem gräßlich mißgebildeten Kleinkind, das nicht lebensfähig war. »Ich konnte sie das nicht noch einmal durchmachen lassen ... Kein Mann hätte das gekonnt.« Er stockte. »Dio meinte, du solltest es erfahren, aber ich war immer zu feige dazu. Unser Sohn – ist gestorben. Dann habe ich dich gefunden. Du warst so ein wundervolles kleines Mädchen, und Dio wollte so gern ein Kind von mir. Ich glaube, sie war eine gute Mutter.«
»Das ist sie. Das habe ich nie in Frage gestellt.« Aber wo – und wer – ist Thyra, meine eigene Mutter?
»Dio hätte ein halbes Dutzend Kinder bekommen müssen. Es hätte ihr gefallen, aber ich konnte es einfach nicht riskieren.« Margaret konnte ihm nicht widersprechen. Aber wieso war es ein Geheimnis? Und warum hatte sie immer das Gefühl gehabt, daß es irgendwie ihre Schuld, ein Versagen ihrerseits war, daß es keine weiteren Kinder gab?
»Nein«, sagte er sanft, und sie wußte, daß er sie auf diese seltsame Weise wieder einmal gehört hatte. Sie war nie dahintergekommen, wie er das anstellte – als könnte er ihre Gedanken lesen. Aber das war unmöglich. Auf jeden Fall war es undenkbar – Menschen sollten nicht in der Lage sein, in die Gedanken von anderen einzudringen. »Es hatte nichts mit dir zu tun, obwohl das in deinem Alter sicher schwer zu glauben ist. Als ich so alt war wie du, dachte ich, daß alles, was meinem Vater zustieß, meine Schuld war, und ich nehme an, du bist genauso.« Da Margaret sich nicht vorstellen konnte, daß ihr Vater jemals jung war, und schon gar nicht, daß er im Unrecht war, hatte sie sich zurückgezogen, bevor er mehr erzählen konnte. Sie wußte noch, wie sie auf ihr Zimmer gegangen war und dort seine Worte wegschloß, sich zwang, sie zu vergessen. Jetzt kam ihr zu Bewußtsein, daß sie das auch bei anderen Gelegenheiten getan hatte. Immer wenn ihr etwas angst machte oder wenn etwas zu schmerzlich war, schickte sie die Erinnerung an einen geheimen und verschlossenen Ort in ihrer Seele.
Nun, im warmen Wasser des Bades, fragte sie sich, ob die rothaarige, kreischende Frau in ihren Träumen diese Thyra war. Margaret dachte nur ungern daran. Und wer war dieser Mann, von dem sie immer kurze Blicke erhaschte? Wenn sie dem Alten damals vor vielen Jahren nur die Wahrheit über ihre Träume gesagt hätte. Aber sie hatte ihm nicht genügend getraut, um ihm ihre Träume zu enthüllen. Und es hatte keinen Sinn, über die Vergangenheit nachzudenken. Sie war vorbei, und sie interessierte sie eigentlich nicht.
War die Thyra, der die Ryll gehört hatte, dieselbe Frau? Vieles sprach dafür, aber es gab niemanden, den sie fragen konnte. Sie bemerkte, daß ihre Finger vom Wasser runzlig wie Dörrpflaumen wurden, und das war eine so alltägliche Sache, daß es ihr unwillkürlich besserging. Margaret schob dieses Rätsel, das sie wahrscheinlich nie lösen würde, beiseite und beendete ihr Bad.
Falls die Frau in ihren Träumen dieselbe Thyra war, deren Ryll sie vor zwei Tagen gespielt hatte, falls sie in der Tat ihre Mutter war, dann hatte ihr der Alte eine Menge zu erklären. Falls sie ihn wiedersah – nein: wenn sie ihn wiedersah –, würde sie ihn auf einen Stuhl fesseln und erst freilassen, wenn er ihr alles erzählt hatte! Dieser Entschluß machte Margaret Mut, denn ihr wurde klar, daß sie kein verängstigtes kleines Mädchen mehr war. Gut, vielleicht noch ein bißchen verängstigt, aber ganz bestimmt kein Kind mehr.
Die Bürokratie, dachte Margaret, mußte der Teufel erfunden haben, um den Menschen das Leben schwerzumachen. Nachdem sie zwei Tage mit kleinlichen Angestellten im terranischen Sektor gerungen hatte, bekam sie den Bescheid, daß sie Ivors Leichnam nicht nach Hause schicken durfte, weil sie keine Verwandte war. Er mußte auf Darkover beerdigt werden, und wenn Ida Anspruch auf den Leichnam erhob, mußte sie kommen und ihn hier geltend machen. Sie hatte die Person hinter dem Schalter mit einigen farbigen und unmöglichen Namen bedacht, und dann war sie mit diesen Kopfschmerzen davongestapft, die anscheinend zur festen Einrichtung wurden.
Sie hatte Ida ein Telefax geschickt und die traurige Antwort erhalten, den Professor zumindest vorläufig auf Darkover beerdigen zu lassen. Margaret hatte mit Anyas Hilfe einen Sargschreiner gefunden und einen hübschen Sarg ausgesucht. Es war eine fast tröstliche Begegnung gewesen, denn der Mann hatte alles über Ivor wissen wollen – was er tat und was er mochte. Er zeigte ihr Entwürfe aus seinem Buch, und sie wählte eine Gitarre als Motiv aus, das auf den Sargdeckel geschnitzt wurde.
Inzwischen gab es eine Stelle auf ihrer Stirn, hinter der es unablässig pochte, und sie hatte sich die Haut dort fast wund gerieben – so wund, wie sie sich im Innern fühlte. Das Ausfüllen von Formularen und die Beantwortung der immer gleichen Fragen hatten ihre Trauer in Schach gehalten, aber wenn sie nicht beschäftigt war, fühlte sie sich verloren und im Stich gelassen. Lediglich Meister Everards und Anyas freundliche Nähe verhinderte, daß sie völlig in Hoffnungslosigkeit versank. Die beiden benahmen sich, als hätten sie Margaret und Ivor ein Leben lang gekannt, als wäre er ein geschätzter Freund gewesen und nicht ein Fremder, der die Unhöflichkeit besessen hatte, am zweiten Tag seines Aufenthalts in ihrem Haus zu sterben.
Meister Everard ging jetzt neben ihr durch die engen Straßen. Der Sarg wurde von vier Mitgliedern der Musikerzunft getragen, und die Mitglieder von Meister Everards Haushalt gingen hinter ihm her. Margaret trug die kostbare Gitarre des Professors. Ihre Hände waren nach dem Sturz auf das Kopfsteinpflaster so gut wie verheilt, aber die Wunde am Knie war schorfig und schmerzte.
Als sie sich dem kleinen Friedhof näherten, der am Rand des terranischen Sektors lag, blieben etliche Leute stehen und schauten der Prozession nach. Margaret war tief in ihren Schmerz versunken und übersah die neugierigen Blicke, die ihr Darkovaner wie Terraner zuwarfen. Sie hatte die Kleidung an, die sie bei MacEwan gekauft hatte, und sie schaffte es gerade so, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ständig stolperte sie in dem ungewohnt langen Rock.
Sie gingen unter einem hübschen Steinbogen hindurch und betraten die mit einer Mauer umgrenzte Anlage. Es gab verstreut dastehende Grabsteine, hier und da einen Baum und weiter vorn eine Gruppe von Figuren, die sie für die Statuen aus ihrem Traum hielt. Dann drehte sich eine davon um, und sie erkannte, daß sie lebendig waren. Der leichte Wind trug den frischen Duft von Balsam heran und bewegte die Kleidung der Wartenden.
»Ich hoffe, es ist Ihnen recht, Kind. Ich habe ein paar Leute aus der Musikstraße gebeten, sich uns anzuschließen.«
»Ich habe nichts dagegen. Aber sie kannten ihn gar nicht. Es kommt mir irgendwie komisch vor.«
»Das stimmt, aber sie hätten sich gewünscht, ihn gekannt zu haben. In der kurzen Zeit, die ich mit ihm verbrachte, habe ich ihn als sehr guten Menschen kennengelernt. Ich fühlte mich reich beschenkt in dieser Zeit, verstehen Sie.«
Margaret verstand es nicht, aber offenbar gab es nichts mehr zu sagen, deshalb ging sie weiter. Ihre Augen brannten vor nicht vergossenen Tränen, ihre Muskeln schmerzten vor Erschöpfung. Margaret kam ans Grab und blickte in die Gesichter von Fremden und sah – keine Fremden, sondern Freunde, von denen sie nicht gewußt hatte, daß sie sie besaß. Das gab ihr die Kraft, durchzuhalten, als der terranische Kaplan in seiner grauen Klerikerkluft – ein nüchterner Ton zwischen dem Grün und Blau der Darkovaner – die rituellen Worte zu lesen begann. Ivor war kein Anhänger von einer der vielen Religionen Terras gewesen – falls er an etwas glaubte, dann war es die Musik –, deshalb blieben die Worte unpersönlich und fast ohne Eindruck zu hinterlassen.
Die Träger ließen den Sarg in die Erde hinab, und der Kaplan las aus dem Buch, eine alte, abgenutzte Ausgabe, und wahrscheinlich wertvoll. Die Worte waren so abgenutzt wie das Buch, uralt und formelhaft, und sie hörten sich für die Darkovaner vermutlich ebenso sinnlos an wie für Margaret. Als der Kaplan geendet hatte, beugte er sich vor, warf eine Handvoll Erde auf das Grab und zog sich dann zurück. Er hatte seine Pflicht erfüllt.
Margaret trat ans offene Grab, bückte sich und hob einen Klumpen Erde auf. Kaum hatte sie ihn in der Hand, spürte sie ein beunruhigendes Kribbeln, als könnte die Erde selbst sprechen. Sie war einen Augenblick unfähig, sich zu bewegen, das Gefühl der warmen Erde in ihrer Hand war, als fließe Darkover selbst durch ihre Adern. Dann ließ sie den Brocken auf den Sarg hinunterfallen und wurde still.
Sie blieb wie angewurzelt stehen, bis eine Frau vortrat. Ihr Haar war dunkel, ihre Haut blaß, und sie war blau gekleidet. Sie hob die Arme und begann mit einem kräftigen Sopran zu singen, der zwischen den Grabsteinen und Bäumen schallte. Es war eine klagende Melodie, herzerweichend in ihrer Schönheit und Reinheit. Die Worte handelten von Frühlingen, die Ivor nie mehr sehen würde, Essen, das er nie mehr kosten, und Blumen, die er nie mehr riechen würde. Alle Sinne wurden gefeiert, und Margaret schluchzte erschüttert und hemmungslos.
Als die unbekannte Frau zu Ende gesungen hatte, trat sie zur Seite, und ein großer Mann nahm ihren Platz ein. Margaret erkannte seine Stimme als die des Mannes, der Everard an der Spitze der Zunft nachfolgen würde. Er sang ein wunderschönes Lied in einer alten Form des Darkovanischen, und Margaret hatte Mühe, den Worten zu folgen. Die warme Kraft seines Baritons erfüllte sie mit einem Gefühl der Erleichterung, und sie stellte fest, daß sie zu weinen aufhören konnte, und schweigend zuhörte. Sie wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht, die plötzliche Ruhe umgab sie so unerwartet, daß sie kaum wußte, wie sie sich verhalten sollte.
Zuletzt nahm Margaret Ivors altehrwürdige Gitarre aus dem Kasten, stimmte sie sorgfältig und strich über die Saiten. Sie sang mit heiserer Stimme, aber als sie sich warm gespielt hatte, verlor sie sich in der Musik, zupfte Melodien, die der Professor besonders geliebt hatte, alte terranische Lieder und Trinklieder von der Universität. Sie sang Liebeslieder von einem Dutzend Welten, und als sie müde wurde, schloß sie mit einem Klagelied, das so alt war, daß niemand mehr wußte, woher es stammte. Es handelte von einem tapferen und furchtlosen Helden, der vor seiner Zeit gefallen war.
Als Margaret aufblickte, sah sie, daß ihre Musik die kleine Trauergemeinde bewegt hatte; die Leute weinten oder hielten ihre Tränen zurück. Sie ließ die Gitarre sinken und verneigte sich. Es war vorbei.
Everard berührte sie am Arm. »Kommen Sie. Gehen wir heim.«
Heim? Wo war ihr Zuhause? Wo gehörte sie hin? Das Gefühl des Verlusts brach wieder über sie herein und mit ihm der bohrende Kopfschmerz. »Ich danke Ihnen für alles, Meister Everard. Sie waren sehr freundlich. Aber ich würde gern noch eine Weile hier bei Ivor sitzen. Dann komme ich zurück zum Haus. Wären Sie wohl so nett, Ivors Gitarre mitzunehmen?«
»Natürlich, aber kommen Sie auch bestimmt allein zurecht?« »O ja. Ich kenne den Weg inzwischen ganz genau.«
»Davon bin ich überzeugt. Sie sind eine sehr bemerkenswerte Frau, Marguerida Alton.« Mit diesen Worten verließ er sie.