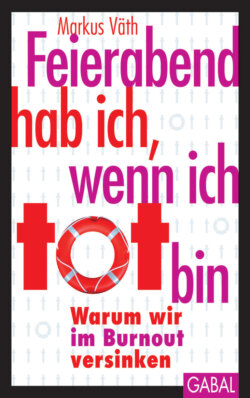Читать книгу Feierabend hab ich, wenn ich tot bin - Markus Väth - Страница 10
Der moralische Blackout
ОглавлениеNeben der Überhöhung der Arbeit und der Gefahr des Erfolgswahns gibt es eine dritte Kraft, die Burnout als kollektivem Phänomen in der Gesellschaft den Boden bereitet: der Verlust ethischer Institutionen und das Austrocknen ehemals vermittelter allgemeingültiger Werte.
Von alters her gab es in allen Kulturen Institutionen, die gesellschaftliche Werte beziehungsweise Moral vermittelten: bei den Germanen den Thing, die Versammlung der Ältesten, bei den sogenannten Naturvölkern Medizinmänner und Stammesälteste. Im heutigen Deutschland könnte man noch den Ethikrat der Bundesregierung nennen (allerdings scheinen dessen Debatten und Entscheidungen eher abstrakt und sind für eine individuelle moralische Stilbildung eher ungeeignet). Über alle Zeiten und Zonen hinweg bildete sich allerorten ein in der jeweiligen Gesellschaft gültiger moralischer Kompass heraus, an dem der Einzelne sich orientieren konnte.
Wir erleben eine Erosion moralischer Autoritäten.
In unseren Breiten haben grundsätzlich einige Institutionen das Potenzial, in einer gesellschaftlichen Dimension ethische Richtlinien zu entwickeln und als Standard zu etablieren: die Kirchen, die Familie als Schutz und Stütze, die Politik, Wirtschaftsführer, sogar stilprägende Einzelpersonen. Von allen diesen Institutionen ist heute nicht eine übrig geblieben, die in einer gesellschaftlichen Debatte über Werte oder Phänomene, die alle Menschen betreffen, für den Großteil ebendieser Menschen sprechen könnte. Dies zeigt beispielsweise die Debatte um eine Schrumpfung der sogenannten Volksparteien, die inzwischen von so wenigen Menschen gewählt werden, dass selbst parteiintern die Bezeichnung »Volkspartei« diskutiert wird.
Warum ist das so? Als Beispiel für die moralische Erosion möchte ich auf drei der obigen Gruppen eingehen: die Kirchen, die Politik und das wirtschaftliche Establishment:
Die Kirchen
Sie sind im Moment auf dem Tiefpunkt ihrer moralischen Glaubwürdigkeit angelangt. Pädophile Priester – katholisch wie evangelisch –, die sich an Knaben vergehen, Bischöfe, die solche Fälle vertuschen, eine unzeitgemäße Kommunikation, die weite Teile der Bevölkerung nicht mehr erreicht – das sind die Höhepunkte einer Negativ-Karriere, die die Kirchen nachhaltig diskreditiert haben. Neuesten Zählungen des Statistischen Bundesamtes zufolge hat in Deutschland die Zahl der amtlichen Atheisten, auf deren Lohnsteuerkarte unter »Religionszugehörigkeit« eine Leerstelle prangt (28 Millionen), erstmals die der Katholiken (25 Millionen) und die der evangelischen Christen (25 Millionen, ohne Freikirchen) überholt.
Natürlich sagt das nichts über einen »Atheismus des Herzens« aus. Immerhin können auch wahre Atheisten aus den christlichen Zehn Geboten eine Soziallehre ziehen, die an Eleganz und Universalität schwer zu überbieten ist.11 »Du sollst nicht töten« oder »Du sollst nicht lügen« stellen Basisforderungen einer menschlichen Gemeinschaft dar, die auch ein Pfeife rauchender, taz lesender Sartre-Fan bejahen dürfte. Selbst innerhalb der christlichen Kirchen gibt es Strömungen, die Jesus nicht als Gottes Sohn, sondern als genialen Menschen und Begründer einer durchschlagenden Soziallehre betrachten. In diesem Sinne bildet das Christentum auch für Nichtchristen im Konzentrat der Zehn Gebote einen derart grundlegenden Ethik- und Moralkodex ab, in dem sich wahrscheinlich sehr viele Menschen wiederfinden.
Die Kirchen haben sich aus der öffentlichen Debatte zurückgezogen.
Es ist daher geradezu ein PR-GAU, dass es beide großen christlichen Kirchen (die griechisch-orthodoxe nicht mitgerechnet, die in unseren Breiten keine nennenswerte Rolle spielt) nicht geschafft haben, trotz dieser konzeptionellen Steilvorlage wenigstens punktuell eine ethische Diskussion zu entfachen und so als wichtige Stichwortgeber und moralische Instanzen im Gespräch zu bleiben: Wo sind die Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz oder des Evangelischen Kirchenrats, wenn es um Integration geht, um die Sarrazin-Debatte? Wo ist die klare, intellektuelle Kirchenstimme, die sich des Themas »Arbeit und Glück« unter christlichen Vorzeichen annimmt? Durchweg Fehlanzeige. Dagegen ist die Gründung der ersten kirchlichen Unternehmensberatung schon ein positives Zeichen. Man wolle, auch als Gegenbewegung zur Gier der Finanzkrise, wieder Werte in die Wirtschaft einbringen und die »Sinnfrage« stellen, so der verantwortliche Generalvikar Clemens Stroppel.12 Man wünscht sich mehr solcher Alternativen der Verzahnung von Kirche mit Wirtschaft und Politik. Die Minimalerwartung wäre ein fruchtbarer Dialog, ein Sich-Reiben an gegensätzlichen Weltsichten und Prioritäten.
Doch solche Initiativen sind selten. Die Kirchen haben mit ihrer halb altertümlichen, halb geheimen Kommunikationspolitik vor allem eines erreicht – den Rückzug vom Tisch der gesellschaftlichen Teilhabe. Die Kirchen haben sich aus der öffentlichen Debatte zurückgezogen. Und nicht nur das: Inzwischen verkaufen sie auch ihr ureigenstes Territorium an den Höchstbietenden, wie beispielsweise in Düsseldorf.13 Nur der Papst ruft manchmal hörbar, doch wenig dialogbereit aus Rom herüber. Ein Umstand, der mehr zum allgemeinen Verdruss beiträgt als diesen beseitigt.
Die Politik
Der Vertrauensindex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) bringt das Trauerspiel an den Tag: Nur noch 13 Prozent der europäischen Bevölkerung vertrauen ihren Politikern.14 Vergleichbar schlechte Werte erreichen nur noch Werbeleute und Manager. Das ist umso besorgniserregender, als diese drei Gruppen – Politiker, Manager und Werber – jede auf ihre Art einen bedeutenden Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Debatte haben.
Politiker sollten die großen demokratischen Linien ziehen und Stichwortgeber sein in aktuellen Fragen, sei es zur Arbeit, zur Verteidigung oder zur Strategie für einen gesunden Haushalt. Politiker sind im besten Fall Staatsmänner oder -frauen mit sichtbaren Überzeugungen und einem ethischen Grundverständnis, das diesen Namen verdient. Einem Willy Brandt, einem Helmut Schmidt, sogar einem Helmut Kohl in Zeiten der Wiedervereinigung gelang es, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Der vielleicht letzte Politiker dieses Formats war der bayerische Landespolitiker Sepp Daxenberger, der Mitte 2010 im Alter von nur 48 Jahren an Krebs starb. Über alle politischen Lager hinweg wurde sein Tod betrauert. Daxenberger verkörperte wie kein Zweiter eine gelungene Mischung aus klarer Sprache, Prinzipien, Authentizität und rauem Charme.
Doch die Zeiten der Personalisierung durch Profil neigen sich dem Ende zu. Politiker erhalten im günstigen Fall den Status eines Popstars, dessen Halbwertszeit abläuft, wenn die Druckerpressen kalt werden. Daran änderten auch die Fotos nichts, die Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg vor Dinosaurier-Kulisse aufnehmen ließ. Was will er nur damit sagen? Ich fress’ euch alle? Oder: Ich überleb’ euch alle, bis mich ein Meteorit oder die eigene Dissertation hinwegrafft? Immerhin waren zu Guttenbergs Fototermine, ob auf Fels mit Ehefrau oder in einer Militärmaschine – schneidig in der Mitte stehend, die Untergebenen in Tarnjacke zu ihm aufblickend –, heroische Versuche eines visuellen Statements der Stärke. Ihr seid das Meer, ich der Leuchtturm. Für die profillose Politikerlandschaft war Guttenberg damit zunächst ein Glücksfall, denn die Mehrheit seiner Arbeitskollegen atmet nur die dunkle Kellerluft des unsichtbaren politischen Betriebs. Doch leider hat auch er sich nun – wie weiland Ikarus – durch Überheblichkeit und Selbstüberschätzung ins Aus geschossen. Und wie so oft war nicht der eigentliche Fehler die Ursache für den Untergang, sondern der Umgang damit. Denn genau die wachsweiche Prinzipienlosigkeit und das scheibchenweise Herausrücken mit der Wahrheit haben die Bürger wieder einmal in ihrem Vorurteil von der »Arroganz der Mächtigen« überzeugt.
Quote ist King, auch in der Politik.
In der Regel haftet der Politikerszene etwas Krämerhaftes an. Für einen Autobahnbau hier oder ein Milliönchen da scheinen Prinzipien oder Wahlversprechen schnell über Bord geworfen. Quote ist King, auch in der Politik. Darum wird der Politiker oft zum Häschen mit den großen Ohren, das angestrengt den neuesten Beliebtheitsumfragen wie der allwöchentlichen »Treppe« des Magazins SPIEGEL lauscht. Wittert es einen Abstieg, wird es Zeit, zum nächsten Mikrofon zu hoppeln und sich wieder ins Gespräch zu bringen.
Insgesamt vermissen die Menschen in der Politik Persönlichkeiten, zu denen sie aufblicken können. Menschen, die stark sind auch gegen Widerstand. Die für etwas stehen und dadurch so glaubhaft sind, dass von ihnen Werte abgeschaut werden können: Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Ehre, Respekt. Eben das Gegenteil einer als rücksichtslos erlebten Arbeitswelt, in der jeder nur für sich kämpft, Intrigen spinnt und Kollegen oder Kunden über den Tisch zieht.
Die Manager
Als dritte Bevölkerungsgruppe, die ihrem gesellschaftlichen Auftrag nicht nachkommt, sind leider auch die Manager und Führungskräfte von Unternehmen zu nennen. Vom kleinen Mittelständler bis zum Weltkonzern. Zugegeben: Führungskräfte haben heute einen schwierigen Job. Immer komplexeren Anforderungen steht eine ungenügende Vorbereitung gegenüber. Auf der Grundlage einer »Wirtschaft mit menschlichem Antlitz« sollen sie Umsatz erzielen und gleichzeitig für ihre Mitarbeiter sorgen. Eine herausfordernde Mission, der sich einige Dinge in den Weg stellen.
Manager haben heute oft nicht mehr das Gefühl, gestalten zu können.
Manager haben heute oft nicht mehr das Gefühl, gestalten zu können. Sie werden zerrieben zwischen den Ansprüchen verschiedener Stakeholder: Mitarbeiter, der eigene Chef, das Topmanagement, Kunden, Lieferanten, Presse, Politiker und der ganz normale Nachbarsbürger, der ihn auf der Straße trifft. Sie alle haben Vorstellungen vom und Ansprüche an das Wirken eines Managers. Eben, wie er seinen Job zu erledigen hat. Und diese Ansprüche sind durch die Finanzkrise nochmals gesteigert worden. »Gierige« Manager stehen nun generell unter Beobachtung und Rechtfertigungszwang. Als unrühmliche Platzhalter sind hier Josef Ackermann, seines Zeichens der Chef der Deutschen Bank, mit seinem Victory-Zeichen und Klaus Zumwinkel, der uneinsichtige Post-Chef, mit seinem Schloss in Italien ins kollektive Gedächtnis eingegangen. So sehen sich Manager heute eingekeilt zwischen schlechter Presse, immer neuen gesetzlichen Regelungen, einem größer werdenden persönlichen Haftungsrisiko und erhöhten Ansprüchen von Mitarbeitern, Kunden und Öffentlichkeit. Dass hier manche Führungskraft zumindest innerlich hinschmeißt, ist verständlich. So wird man eben nicht zur Kreativkanone, sondern nur zum Zustandsverwalter, der die eigene Lähmung damit rechtfertigt, wenigstens nichts falsch zu machen.
In einer eher untypischen Management-Literatur findet man hierzu einen interessanten »Business Case«: in der Bibel. Das Matthäus-Evangelium beschreibt das Gleichnis von den Talenten, einer damaligen Geldeinheit (Mt 25,14–30): Ein reicher Mann ging auf Reisen und gab seinem ersten Diener fünf, seinem zweiten Diener drei und dem letzten Diener ein Talent. Sie sollten das Beste aus diesen Geldbeträgen herausschlagen, während ihr Herr auf Reisen war. Die ersten beiden Diener wirtschafteten gut und verdoppelten ihre Geldsummen. Der dritte Diener jedoch vergrub das Geld aus Angst, es falsch einzusetzen und zu verlieren. Dementsprechend bestraft wird dieser Diener nach der Rückkehr des Herrn. Lieber hätte der Diener aktiv sein und etwas riskieren sollen – auch unter der Gefahr des Verlusts.
Das biblische Gleichnis von den Talenten ist typisch für viele Führungskräfte. Dabei sind sie weder dumm noch faul, sondern schlicht von immer komplexeren Führungsaufgaben überfordert. Das merken natürlich nicht zuletzt die Mitarbeiter. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise trauten 40 Prozent der Arbeitnehmer ihren Chefs kein entsprechendes Krisenmanagement zu.15 Eine Einschätzung, die sicher nicht nur unter dem Eindruck der Krise entstand und damit sozusagen vom Himmel fiel.
Profil und eigene Meinung leisten sich viele Führungskräfte nicht mehr.
Manager sollen unterschiedliche, konkurrierende Ansprüche verschiedener Gruppen befriedigen: Aufsichtsräte, Führungskräfte, Mitarbeiter, Betriebsrat, Kunden, Aktionäre, Presse. Das setzt Entscheidungen voraus, zu denen man stehen muss, die Entwicklung eines individuellen Profils. Mit Ecken und Kanten und nicht stromlinienförmig auf die Karriere ausgerichtet. Profil und eigene Meinung jedoch leisten sich viele Führungskräfte nicht mehr und ziehen sich in einen Egozentrismus zurück. Eine eigene Meinung ist aber wichtig, um die Leuchtturmfunktion auszuüben, die zumindest im oberen Management erwartet werden darf. In diesem Sinne haben Manager durchaus Vorbildfunktion, weil sie einem so wichtigen Bereich der Gesellschaft – Wirtschaft und Arbeit – vorstehen. Daraus kann und darf sie niemand entlassen.
Der Philosoph Karl Popper analysierte die Atomisierung der Moral und die Anfälligkeit der Moderne für Heilslehren verschiedenster Art auf hellsichtige Weise: »Bertrand Russell […] schreibt, dass […] wir uns intellektuell zu schnell entwickelt haben und moralisch zu langsam und, als wir die Kernphysik entdeckten, nicht zur rechten Zeit die nötigen moralischen Prinzipien verwirklichten. Mit anderen Worten: Nach Russell sind wir zu gescheit, aber moralisch sind wir zu schlecht. […] Ich glaube das genaue Gegenteil. Ich glaube, dass wir zu gut sind und zu dumm. Wir werden leicht von Theorien beeindruckt, die direkt oder indirekt an unsere Moral appellieren, und wir stehen diesen Theorien nicht ausreichend kritisch gegenüber; wir sind ihnen intellektuell nicht gewachsen und werden ihre gutwilligen […] Opfer.«16
Wendet man diesen Gedanken auf die Felder der Politik, der Wirtschaft und der Religion an, so kann man durchaus entsprechende Parallelen in unserer Gesellschaft entdecken. So zum Beispiel:
den »Glaubenskrieg« um den angeblichen oder tatsächlichen Klimawandel,
die größtenteils subjektive und oft bar jeder Sachkenntnis geführte Debatte um Sexualstraftäter oder auch
die Stigmatisierung der Raucher als Verletzer der grassierenden »Gesundheitsreligion«.
Popper redet keinem Zynismus das Wort. Er stellt fest, dass die großen moralischen Leuchtfeuer in unserer Gesellschaft erloschen sind und Tausenden von kleinen Taschenlampen Platz gemacht haben. Damit geht eine größere individuelle Entscheidungsmacht, aber auch ein größeres Frustpotenzial für den Einzelnen einher.
Bis hierher lässt sich festhalten, dass sich die alltägliche Überforderung des Einzelnen jenseits individueller Umstände aus drei großen gesellschaftlichen Strömungen speist:
1. Arbeit als übergroßer Teil des Selbstwerts. Zum einen wurde die eigene Rolle als arbeitender Mensch in der westlichen Gesellschaft zum übermächtigen Anteil des Selbstkonzepts, von dem Status, Wohlbefinden und individueller Lebenssinn abhängen. Das Ergebnis ist eine Dichotomie der Werte: Menschen mit Arbeit fühlen sich wertvoll, Menschen ohne Arbeit leiden unter ihrer vermeintlichen Wertlosigkeit und unter fehlender Anerkennung durch die Gesellschaft.
2. Erfolg als Richtschnur aller Lebensbereiche. Das Streben nach Erfolg ist als Quasireligion weitgehend akzeptiert. Das eigene Leben wird gegen Vergleichspersonen und -gruppen »gebenchmarkt«. Man verfällt in einen nie endenden Optimierungswahn seiner selbst, der Karriere, der Partnerschaft, seiner Kinder. Wie eine Welle erfasst der Zwang zum Erfolg alle Lebensbereiche: Arbeit sowieso, aber auch Gesundheit, Fitness, Erziehung, Freizeitgestaltung etc.
3. Atomisierung der Moral. Da übergeordnete Strukturen wie Religion, Politik und Wirtschaft in ihrer Meinungsführerschaft versagen, bildet man aus dem Setzkasten der ethischen Orientierung einfach sein eigenes moralisches Weltbild. Ein bisschen Christ, ein bisschen Salon-Kommunismus, ein bisschen Selbsterfahrungskurs mit Darmspülung. Das ist bedeutsam und bedrohlich zugleich: Wenn ich mein moralischer »Master of the universe« bin und allein die Regeln aufstelle, bewahrt mich bei einem Absturz nichts vor der eigenen Niederlage. Ohne ein Korsett aus flankierenden Grundwerten und Grenzen überschreite ich diese – weil ich sie nicht mehr wahrnehme.
Wie eine Welle erfasst der Zwang zum Erfolg alle Lebensbereiche.
Genau das ist Burnout – eine bis zur Selbstauflösung reichende Überschreitung von Grenzen, die wiederum man erst im Nachhinein erkennen kann. Wie eine Brille, die einem von der Nase gefallen ist und die man erst nach dem Stolpern wieder aufsetzt. Warum man jedoch stolpert, wie die Brille eigentlich aussieht und wer einem am effektivsten hilft beim Aufrappeln – darüber streiten sich die Geister.