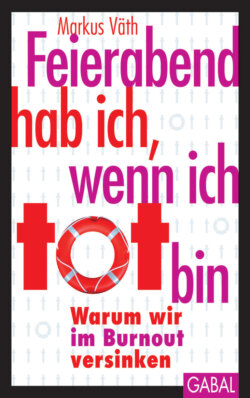Читать книгу Feierabend hab ich, wenn ich tot bin - Markus Väth - Страница 8
Missverständnis Arbeitsgesellschaft
ОглавлениеEs gibt eine hübsche, sehr bekannte Werbung für einen Tampon. »Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse«, flötet die gutaussehende Schauspielerin und lässt den Rollladen hinter der Präsentationswand herunter. Ein durch mannigfaltigen Kabarettgebrauch mittlerweile ebenso viel zitierter wie legendärer Satz.
In gewisser Weise geht es, provokativ formuliert, der westlichen Arbeitsgesellschaft wie der Menstruation: Sie ist eine Tatsache, einen Großteil der Bevölkerung betrifft sie – und ihre Geschichte ist eine voller Missverständnisse. Diese Missverständnisse haben zu einer neuen, modernen Sichtweise von Arbeit geführt, die sich, kurz gefasst, auf die Gleichung bringen lässt: Arbeit = Sinn.
Früher arbeitete man, weil man musste. Nicht, um sich zu verwirklichen.
Dass die individuelle Arbeit ein sinnstiftendes und damit die Existenz des Einzelnen entscheidend prägendes Moment sein sollte, ist ein relativ junges Phänomen der letzten 100 Jahre. Früher arbeitete man, weil man musste. Nicht, um sich zu verwirklichen. Im griechischen Altertum galt Arbeit als Strafe der Götter. Die Griechen strebten nach einem Ideal aus Grundbesitz, Wohlstand und Tugenden. Arbeit wurde nur im sportlichen und militärischen Bereich geleistet und war im Übrigen Sache der Sklaven. Die Griechen nahmen mit ihrer Teilung der arbeitenden Sklavenbevölkerung von der der Muße frönenden Bürgerschicht die Entwicklung der europäischen Ständegesellschaft vorweg. Auch in der Sprache drückt sich der historische Zwangscharakter von Arbeit aus: Die Franzosen verwenden für »Arbeit« das Wort »travail«, das sich vom lateinischen »tripalus« ableitet – dem »Dreipfahl«, einer Vorrichtung, mit der man widerspenstige Pferde bändigte.2
Noch im 17. Jahrhundert dozierte der englische Philosoph John Locke: Arbeit nur um der Arbeit willen ist gegen die menschliche Natur. Arbeit muss getan werden, um Essen auf dem Tisch zu haben, für Geld, für Kleidung und ein Heim. Arbeit hieß seinerzeit, mit der Sonne aufzustehen, sein Tagwerk zu verrichten und abends müde auf den Strohsack oder das Bett zu fallen. Ohne Perspektive, Karriereplanung oder Rentenabsicherung. Allein die Adligen konnten aus diesem Mechanismus ausbrechen: Sie mussten gar nicht arbeiten, sondern konnten sich der Kunst, der Wissenschaft oder der Religion widmen. Schnöde Arbeit verwirrte den Geist und hielt einen ab von der Betrachtung der schönen Künste, den Studien der Mathematik und den diplomatischen Verpflichtungen. Arbeit bedeutete in der Regel Knochenarbeit und war ein Garant für körperliche Schäden, frühes Altern und einen stillen Tod. Bauern und Handwerker konnten ein Lied davon singen.
Mit der Aufklärung setzte sich ein bislang unbekanntes Phänomen durch und eroberte langsam, aber sicher die Arbeitswelt: das Büro. Der Autor Hajo Eickhoff pointiert scharf, dass im 17. und 18. Jahrhundert »Beamte, mathematisch versierte Kaufleute und Versicherungsexperten, Geistesarbeiter und Kanzleiarbeiter erst zu Büromenschen erzogen werden [mussten]. Denn nicht nur der Mensch ordnet das Büro, sondern das Büro zwingt den Menschen in eine neue Ordnung des Denkens, Fühlens und Verhaltens.« Und weiter: »Eine Begleiterscheinung der Aufklärung ist eine gewisse Verdunkelung und Begrenzung des Menschen, denn Büroarbeit ist Verlust an Licht und an Beweglichkeit. Im Büro ist das Tageslicht vermindert, die frische Luft reduziert, ein strenges Einhalten von Zeit erforderlich und vielfach Bewegung und Beweglichkeit eingeschränkt.«3
Das Büro hat die Arbeitswelt verändert.
Wie erfreulich. So manche Bankfiliale oder Amtsstube verströmt heute noch den Charme eines möblierten, dunklen Erdlochs, aus dem Freude, Sonnenlicht und Kreativität als verbannt erscheinen. Laut Eickhoffs Betrachtungen randalierten damals tatsächlich einige Adlige mit Waffengewalt, weil sie ihren Alltag nicht einem stereotypen Büroablauf unterwerfen wollten. Es wäre wahrhaft ein Schauspiel, flögen heute Schreibtische durch Fenster, geworfen von adrett gekleideten Büromenschen mit Zornesröte im Gesicht.
Noch bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, nach zwei Weltkriegen und einer Gesellschaft im Schockzustand, war Arbeit ein notwendiges Übel, dem man aus Geldgründen nachging. Legal oder auf dem Schwarzmarkt. Auch die Möglichkeit der Berufswahl war eher gering ausgeprägt. Bauern vererbten ihre Höfe an den Sohn, Handwerksbetriebe gingen an die Kinder über. Ebenso größere Firmen, bei denen man, zum Beispiel bei den Unternehmerfamilien Quandt oder Merck, die Grundlagen und Verläufe der Deutschland AG nachzeichnen konnte. Ein weiteres Gesicht der Arbeitslandschaft waren die »Trümmerfrauen«, die nach 1945 zum Symbol des deutschen Wiederaufbaus wurden. Sie versinnbildlichten harte Arbeit, ohne viel zu fragen, eine aus Leid geborene Schaffenskraft, die sich zu Recht als historische Leistung quasi in den genetischen Code der deutschen Nachkriegsgesellschaft eingeprägt hat.
Erst mit den 68ern und ihrer pädagogischen, intellektuellen und sexuellen Revolution stellte man auch im Bereich der eigenen Arbeitsleistung die Frage nach dem Warum. Eine Verbreiterung der Bildungswege, das dreigliedrige Schulsystem und die zunehmende Definition der eigenen Persönlichkeit durch Arbeit wurden zum Bestandteil des kollektiven Unterbewusstseins nach dem Wirtschaftswunder. Bis in die heutige, schnelllebige Zeit der Job rotation hinein gehört das »Du kannst tun, was du willst«-Mantra zum Selbstkonzept vieler qualifizierter Fachkräfte und Wissensarbeiter. Oder, wie es mein damaliger Studienberater beim Arbeitsamt ausdrückte: »Psychologe? Warum nicht? Wenn schon arbeitslos, dann doch wenigstens in einem Beruf, der Ihnen Spaß macht.« Ich muss zugeben, dass mich diese Begegnung in meinem Verhältnis zur staatlich regulierten Arbeitsvermittlung einigermaßen geprägt hat.
Während der letzten 60 Jahre hat die Bedeutung der Arbeit für das eigene Selbstbild einen enormen Wandel durchlaufen: Man arbeitet nicht mehr (nur) um des Geldes willen, weil man den Betrieb geerbt hat oder weil man einfach nichts anderes machen konnte, als Schornsteinfeger in Obertraubling zu werden. Der Beruf als solcher ist zu einer, wenn nicht gar der entscheidenden Stütze des Selbstkonzepts geworden. Die eigene Arbeitsleistung ist heutzutage Ausweis einer individuellen Sinnstiftung und damit umfangreicher Teil der eigenen Identität.
Heute bilden die 20- bis 30-Jährigen den genauen Gegenpol zu ihrer Eltern- und Großelterngeneration, die nach dem Zweiten Weltkrieg Tritt fassen mussten. Ging es in den späten 1940er- und frühen 1950er-Jahren vor allem darum, auf dem Schwarzmarkt zu handeln, jeden Job anzunehmen und irgendwie durchzukommen, hat die heutige junge Generation vor allem das Süßwarenladen-Problem: Es gibt so viele Möglichkeiten der Berufswahl, dass wir überwältigt sind und gar nicht wissen, wohin wir zuerst greifen sollen. Weil wir heute so frei wählen können, sind wir für unsere Wahl und deren Ergebnis umso mehr verantwortlich. Darum tun wir alles, was möglich ist – und im Burnout auch darüber hinaus –, um uns und der Welt zu bestätigen, dass unsere Wahl richtig war und wir die Meister unseres Lebens sind. Und weil im Süßwarenladen von Beruf und Karriere sehr viel von unserer Wahl abhängt, überwältigt uns das Angebot bis zur Frustration. Aus Angst, im Leben gleich zu Beginn einen falschen Pfad einzuschlagen, geraten auf diese Weise junge Leute neuerdings in eine Art Schockstarre.
Der Beruf ist zu der entscheidenden Stütze des Selbstkonzepts geworden.
Die junge Journalistin Nina Pauer liefert dazu eine hellsichtige Analyse. »Was uns umtreibt, ist die schizophrene Panik davor, unser Leben falsch zu leben«, schreibt sie. Die heutige Generation der 25- bis 35-Jährigen sei besessen von der Angst, im Leben etwas zu verpassen. Gleichzeitig fürchte sie, sich nirgendwo wirklich zu verwurzeln und damit eine Verpflichtung über ein rasches Dahingleiten im Strom des Lebens hinaus einzugehen. Man binde sich nicht mehr an eine Stadt, einen Partner, einen Verein, eine Kirche. Man unterliege der zwanghaften Vorstellung, ständig mobil sein zu müssen, seine Zelte abbrechen zu können, sich aufzumachen zu einer besseren, passenderen, einträglicheren Lebensperspektive. Pauer nennt das die Jagd nach der »richtigen Version unserer selbst«. Der Segen unseres multioptionalen Lebens sei gleichzeitig dessen Fluch: Alles ist möglich.4
Grundsätzlich ist es zwar nicht schlecht, wenn die Arbeit zum »Glück spendenden Grund« des eigenen Lebens wird, wie Viktor Frankl, Psychotherapeut und Begründer der Logotherapie schreibt. Doch Frankl, der große Denker und Verfechter eines sinnerfüllten Lebens, erkannte genauso die Gefahr, die einer entgrenzten Sinnsuche innewohnt. Im Gegensatz zum Tier, dozierte er, gebe es beim Menschen keinen ursprünglichen Instinkt, der ihm sage, was er tun müsse. Und in unseren modernen Zeiten, in denen sich traditionelle Rollenbilder und soziale Verbindungen zunehmend auflösen, habe er auch keine Vorgabe aus Tradition oder Familie mehr, was er tun solle. Als Ergebnis versage der heutige Mensch darin, zu wissen, was er grundsätzlich wolle.5
In der Konsumwelt findet man ein ähnliches Phänomen: Die Konsumforschung hat herausgefunden, dass der Kunde zwar grundsätzlich Wahlfreiheit will, jedoch ebenso schnell überfordert ist, wenn zu viel Auswahl herrscht. In Studien der Textilindustrie wurde gezeigt, dass Frauen beispielweise maximal acht Hosen miteinander vergleichen können. Bringt der Verkäufer mehr, schlägt die Kauflust in Frust um. Die Wahl scheint nicht mehr beherrschbar und mit angemessenen Mitteln in einer angemessenen Zeit zu bewältigen. Schon die Stellung der Kleiderständer und -tische in einem Kaufhaus kann Frust auslösen, wenn der Kunde vom Angebot visuell überwältigt wird.
In der Arbeitswelt kann sich ebenfalls ein solcher Frust bilden, allerdings in Zeitlupe. Ich beschäftige mich so lange mit Ausbildungswegen und Karrieremöglichkeiten, bis ich mich im Angebot des Aus- und Weiterbildungsdschungels verloren habe. Denn woher will ich wissen, ob der Ausbildungsweg tatsächlich meinen Talenten entspricht? Ob ich es schaffen werde? Halte ich mich für fähig, auch schwierige Situationen zu meistern und unvorhergesehene Probleme zu lösen?
Im Übrigen erkennt man anhand solcher Überlegungen den Unterschied zwischen Optimismus und Selbstvertrauen. Optimismus ist die einfache Hoffnung, es werde schon alles gut. Selbstvertrauen ist die aus der eigenen Erfahrung gewonnene Überzeugung, Probleme angehen und überwinden zu können. Das ist ein enormer Unterschied – nämlich der zwischen Erfolg und bloßem Glück. Niemand hat diesen Gedanken so perfekt verkörpert und transportiert wie der US-Präsident Barack Obama mit seinem Slogan »Yes, we can!« – auf der ganzen Welt längst ein geflügeltes Wort.
Ein solches Selbstvertrauen brauchen wir auch im Hinblick auf unsere Berufswahl. Im Großen und Ganzen jedoch scheint der moderne Mensch Mühe zu haben, seinen ganz speziellen Berufs- und Karriereweg unter den vielen Angeboten zu wählen. Hat er ihn aber erst einmal gefunden, wird er zu einem wichtigen Teil seines Selbstbilds, zu einem sinnstiftenden Korsett, das den Einzelnen durch den Alltag trägt. Management-Coach Maren Fischer-Epe benutzt hierzu das Bild der fünf Säulen der Identität: Arbeit und Leistung, soziales Netz, Körper, materielle Sicherheit, Normen und Werte.6
Der Bereich »Arbeit und Leistung« lässt bei den meisten Menschen keinen Raum für anderes mehr.
Der Bereich »Arbeit und Leistung« spielt bei den meisten Menschen eine so große Rolle, dass dadurch andere Bereiche zu kurz kommen. Wer kennt nicht den Manager, der seine Frau nur alle zwei Wochen sieht, oder die Führungskraft, die über schwerwiegende körperliche Symptome der Überarbeitung klagt. Entsprechend durchschlagend ist hier das Ergebnis eines Burnout. Wie wir später noch sehen werden, kann ein Burnout den eigenen Selbstwert als Arbeitskraft empfindlich stören. Obwohl (oder gerade weil) man also noch in Lohn und Brot steht, brennt man aus. In den Kategorien von Fischer-Epe gesprochen, wächst der Bereich »Arbeit und Leistung« zu einem sogenannten Roten Riesen heran. Rote Riesen heißen in der Astronomie alternde Sonnen, die kurz vor der Explosion stehen. Und ähnlich wie bei Sternen passiert bei Burnout-Betroffenen das, was passieren muss: Sie implodieren und fallen aus dem System heraus.
Noch düsterer sieht es aus, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren. Fischer-Epe beobachtet in ihren Studien, wie Führungskräfte durch Arbeitslosigkeit in eine ungewöhnlich große Krise gestoßen werden, die »in ihrem Ausmaß oft nur aus der besonderen Bedeutung dieses Themas für das Selbstwertgefühl« nachzuvollziehen ist.7 Das gilt beileibe nicht nur für Manager und Führungskräfte. Nimmt man Menschen ihre Arbeit als tragende Säule ihrer Identität, wirft man sie zurück auf grundlegende Fragen: Was macht mich eigentlich als Person aus, auch ohne gut bezahlten Job? Bin ich überhaupt noch etwas wert? Verändert sich mein Verhältnis zu meiner Familie, meinem Partner? Viele Arbeitnehmer haben sich diesen Fragen bislang nicht gestellt; als entsprechend belastend werden sie nun erlebt. Bislang war fast jede Situation durch Selbstdefinitionen wie »hart arbeitend«, »Ernährer«, »sozialer Status« geerdet. Im Burnout fällt dieses Korsett weg und man muss zu einem Selbstverständnis jenseits der Arbeitsrolle finden.
Was macht mich als Person aus? Bin ich noch etwas wert?
Als Teil der westlichen Wohlstandsgesellschaft war ich darum verblüfft, als ich 2003 auf einer Reise durch Australien mit der Kultur der Aborigines in Kontakt kam. Die Ureinwohner Australiens kannten bis vor Kurzem das westliche Arbeitskonzept überhaupt nicht. Im Norden des Kontinents, in Darwin, unterhielt ich mich mit einem Veranstalter von Outback-Safaris, der mir diese Mentalität schilderte. Man versuche, die Aborigines in Jobs zu vermitteln – als Angestellte einer Wäscherei, als Touristenführer, Verkäufer etc. »Es funktioniert nicht«, berichtete der Reiseleiter. »Sie begreifen nicht, dass sie dableiben müssen. Wenn sie den Ruf des Walkabout [die Aufforderung, an einer Stammesversammlung teilzunehmen] hören, lassen sie einfach alles stehen und liegen und verschwinden in den Busch. Das Konzept ›Arbeit gegen Geld‹ ist ihnen völlig fremd.«
Es ist erfrischend und erhellend, hautnah eine völlig andere Einstellung zum Thema »Arbeit und Geld« zu erfahren. Geld als symbolisches Tauschmittel für Arbeitsleistung, Erfolg und materiellen Konsum kommt im kulturellen Koordinatensystem der Aborigines nicht vor. Die Ureinwohner Australiens haben seit über 40 000 Jahren ein sehr entspanntes Verhältnis zu dem für sie nebensächlichen Thema »Arbeit« – ganz anders als wir in der westlichen Welt, die wir die Arbeit an sich auf einen Altar heben und aufgrund des mit Arbeit verdienten Geldes lächerliche »Mein Haus, mein Boot, mein Auto«-Vergleiche veranstalten.
Können wir im Gesellschaftsspiel um Karriere, Geld und erkauftes Glück keine neuen Karten mehr zücken, wird es für manche eng. Besonders Männer trifft beispielsweise eine Entlassung in ihrer Rolle als Ernährer, Versorger und Beschützer der Familie hart. Im modernen männlichen Selbstkonzept hat sich das frühzeitliche Beschützen vor dem Säbelzahntiger in die eher materielle Fürsorge für die Familie verwandelt. Entlässt man den modernen Mann, schlägt man ihm die Keule aus der Hand und verstößt ihn aus dem Stamm, in dem er nun mal keine sinnvolle Funktion mehr hat. Es gibt arbeitslose Männer, die ihren Frauen noch monatelang eine heile Arbeitswelt vorspielen: Sie gehen morgens aus dem Haus und tun so, als gingen sie zur Arbeit. Dabei verschwinden sie im Café um die Ecke und tauchen erst abends wieder auf, möglicherweise noch mit erfundenen Geschichten aus dem Kollegenkreis. Daran erkennt man, wie groß das Leid der aus der Gruppe der arbeitenden Bevölkerung Ausgestoßenen ist.
Hast du Arbeit, bist du etwas wert. Wenn nicht, dann nicht.
Burnout, Entlassung und Arbeitslosigkeit sind die neuralgischen Punkte einer Gesellschaft, die Arbeit zu ihrem Daseinszweck erhöht. Hast du Arbeit und leistest du was, bist du was wert. Wenn nicht, dann nicht. Kein Wunder, dass in Deutschland alles, was mit Arbeit zu tun hat, in teilweise hysterisch-neurotischen Tönen diskutiert wird: Hartz IV, Mindestlöhne, Reichensteuer, Managerbezüge. Weil Arbeit praktisch bei jedem Menschen identitätsstiftend und gleichzeitig ein durch Entlassungsdrohung und Burnout potenziell hoch angstbesetztes Thema ist, können wir als Gesellschaft darüber auch nicht ruhig und sachlich diskutieren.
Im Endeffekt leben wir im Spannungsfeld von Arbeit als Lebensinhalt und deren ständiger Bedrohung durch persönliche Sinnkrisen, wirtschaftliche Krisen und Entlassung. Besserung ist erst in Sicht, wenn wir lernen, die Bedeutung der Arbeit für uns selbst und unser geistiges Wohlbefinden deutlich zu reduzieren. Dadurch würden wir mehr für die Prävention von Burnout tun als mit allen gut gemeinten Zeitmanagement-Seminaren zusammen.