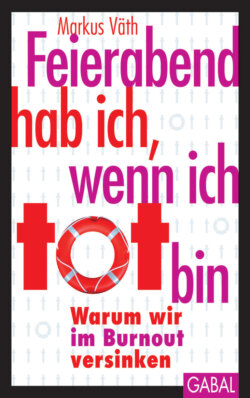Читать книгу Feierabend hab ich, wenn ich tot bin - Markus Väth - Страница 9
Kollektiver Erfolgsgeilheitswahn
ОглавлениеMit 21 Jahren wurde bei Theresa Häuser Hochbegabung diagnostiziert. Sie hatte sich aus Neugier durch ganze Batterien von Intelligenz- und Persönlichkeitstests gewühlt und mehr über sich herausgefunden, als sie wissen wollte.
Was für andere wie ein Sechser im Lotto klingt, war für sie eine enorme Belastung. Natürlich ist es schön, als Hochbegabter Dinge schnell zu begreifen, zu analysieren und auf vielen Gebieten Wissen anzuhäufen. Die Kehrseite der Medaille besteht für die meisten Hochbegabten darin, partout nicht herauszufinden, welchen beruflichen Weg sie denn nun einschlagen sollen. Weil sie bis zu einem mehr als ansprechenden Niveau die meisten Fächer und Gebiete einfach sehr schnell lernen.
Als sie mit Mitte 30 zu mir ins Coaching kam, meinte sie einmal: »Mathematik ist mein schlechtestes Gebiet. Trotzdem hätte ich immer noch Mathematik studieren können. Aber hätte es mich glücklich gemacht?« Solche »Hätte, könnte, würde«-Debatten sind typisch für Hochbegabte. Theresa Häuser hatte schlussendlich nicht Mathematik studiert. Heute hat sie aus der Not eine Tugend gemacht, indem sie auf eine Stromlinienkarriere verzichtete. Sie war bei mehreren Firmen beschäftigt, wechselte einmal die Branche und ist heute, mit knapp 38 Jahren, erfolgreich als Beraterin selbstständig.
Zu meinen Klienten gehören auch Hochbegabte wie Frau Häuser, deren Lebenslauf sich wie aus einem Karrieretraum-Poesiealbum liest, die aber kreuzunglücklich sind. Sie könnten viele Positionen erfolgreich ausfüllen und zweifeln trotzdem stark an sich. Ein ausgeprägtes Jobhopping ist die Folge. Weil sie sich nicht an Feedback von außen orientieren können (weil sie einfach viele Dinge sehr schnell begreifen und beherrschen), müssen sie sich allein auf ihren inneren Kompass verlassen, der ihnen sagen soll, welchen Berufsweg sie nun einschlagen. Und das gestaltet sich meist schwierig. Nach außen erfolgreich, fragen sie sich manchmal ihr Leben lang: War diese Wahl richtig? Oder hätte ich mein Potenzial noch besser nutzen sollen? Wenn ich mit Hochbegabten arbeite, gebe ich ihnen meist einen Satz der Journalistin Mary Schmich mit auf den Weg: »Einige der interessanten Menschen, die ich kenne, wissen mit 22 noch nicht, was sie werden wollen. Und einige der interessantesten wissen es mit 40 auch noch nicht.«8
Die bonbonfarbene Lüge unserer Spaß- und Erfolgsgesellschaft lautet: Du kannst alles schaffen!
Man muss nicht hochbegabt sein, um an seiner Berufswahl zu zweifeln. Auch »ganz normale« Menschen spüren manchmal einen leisen Zweifel, eine Sehnsucht, wie es wohl wäre, wenn sie ihr Leben anders gelebt hätten. Dieser Zweifel wird besonders der heutigen jungen Generation eingepflanzt, egal wie begabt sie ist. Es ist die bonbonfarbene Lüge unserer Spaß- und Erfolgsgesellschaft: »Du kannst alles schaffen!«
Diese Lüge lässt sich mit Blick auf den Unterschied zwischen den Botschaften der Medien und den Nachwuchssorgen von Unternehmen allerdings schnell entlarven. Eine nicht unerhebliche Anzahl junger Menschen unter 20 Jahren glaubt inzwischen ernsthaft, das Berufsleben gleiche einer Castingshow: sich einmal präsentieren, sich seine fünf Minuten Ruhm abholen und dann davon zehren. Dass zu einem Beruf Durchhaltevermögen, Kreativität, soziale Intelligenz und nicht zuletzt eine gehörige Portion Bildung gehören, ignorieren sie. Auf der anderen Seite stehen vor allem mittelständische Unternehmen, die händeringend Nachwuchs suchen. Es würden sich entweder gar keine jungen Leute melden oder nur solche, die zu ungebildet sind, klagen viele Arbeitgeber. Hier eine kleine Anekdotensammlung:
Ein Handwerksmeister erwähnte einmal, dass er bei Auszubildenden inzwischen Dinge wie den mathematischen Dreisatz gar nicht mehr voraussetze. »Hauptsache, der Betreffende kann einigermaßen Deutsch und weiß, wie man die Hand gibt«, lautet sein resigniertes Fazit.
Ein Gymnasiallehrer (!) berichtete mir, seine Schüler würden Begriffe wie »addieren« und »subtrahieren« nicht mehr verstehen. Er sehe sich genötigt, auf die Behelfswörter »hinzunehmen« und »abziehen« auszuweichen.
Ein weiterer Gymnasiallehrer berichtete mir von der Beschwerde eines Schülers. Der Lehrer hatte ihm im Fach Deutsch ein Wort als falsch angestrichen. Doch dieses Wort, so der (deutschstämmige) Schüler, sei nicht »in den 1000 Wörtern Grundwortschatz enthalten«, die er wissen müsse. Und wir reden hier nicht von einer Brennpunkt-Hauptschule, sondern von einem ländlichen Gymnasium, wo angeblich »die Welt noch in Ordnung ist«.
Erfolg und (mediale) Aufmerksamkeit sind die neuen Währungen unserer Gesellschaft. Das bekommen junge Menschen heutzutage von Kindesbeinen an eingetrichtert. Und wieso sollten sie auch daran zweifeln? Ihre Eltern leben ihnen doch das entsprechende Weltbild vor.
Erfolg und (mediale) Aufmerksamkeit sind die neuen Währungen unserer Gesellschaft.
Sichtbarer beruflicher Erfolg ist so ziemlich das Einzige, wodurch wir uns noch unterscheiden. Familie? Fehlanzeige. Die Großfamilie ist tot, die Zahl der Singlehaushalte nimmt zu. 40 Prozent aller Paare, die zusammenleben, wollen nicht heiraten. Es könnte ja was Besseres nachkommen. Religiöse Identität? Gibt’s nicht mehr. Die Mehrheit der Menschen findet ihren Weg in die Kirchen gar nicht mehr beziehungsweise erst bei erneutem Ausbrechen einer Finanzkrise. Wenn’s dick kommt, kriecht man eben doch gern bei Mutti unter. Sozialer Kitt wie Vereine, Verbände oder Ähnliches? Alle diese freiwilligen Institutionen ächzen unter massivem Mitgliederschwund. Einzige Ausnahme sind Fitnessclubs, weil Menschen dort ihre Selbstoptimierung in einem anderen Bereich als dem der Arbeit ausleben und vorantreiben können.
Die jungen Leute merken das alles und richten sich entsprechend aus. Ein Bekannter von mir arbeitet mit Hauptschülern. Er versucht ihnen beizubringen, dass sie für ihren Lebens- und Berufsweg hart arbeiten müssen. Meist ohne Erfolg. Einer der Hauptschüler antwortete auf die Frage, was er denn werden wolle: »Geschäftsführer!« Und er wolle »einen Porsche fahren«. Wie er das denn bezahlen wolle? »Keine Ahnung. Werd’ ich halt Fußballspieler.« Und wenn das nicht klappt? »Scheißegal. Hartz ich eben.«
Immer öfter erleben all die Sozialarbeiter, Lehrer, Jugendbetreuer auf der einen Seite eine Realitätsblindheit bis zum Psychosenverdacht und andererseits eine Gier nach Status und Erfolg – die wir als Gesellschaft den Jugendlichen einpflanzen. Durch Werbung, Materialismus und eine »Du kannst alles schaffen«-Mentalität. Deshalb lassen sich junge Leute, die nicht mal im Ansatz singen können, von Dieter Bohlen in einer Weise demütigen, für die man in einem gestandenen Sadomaso-Studio eine Menge Geld hinlegen müsste. Sogar die so »Erfolgreichen« gehen vielleicht durch eine Saison, werden mit Knebelverträgen ausgepresst und dann gegen den nächsten Trottel ausgewechselt.
Wir sind kollektiv erfolgsgeil.
Diese Art von »Erfolg« ist fragwürdig genug. Doch als Schattenseite einer solchen Entwicklung ist man nicht nur für seinen Erfolg, sondern auch für seinen Misserfolg verantwortlich. Wo Klassen- und Standesbeschränkungen fehlen, wo man in einem weiten Feld und nicht mehr in einem begrenzten Parcours laufen muss, wo keine Kirche und kein soziales Netz mehr Schutz bieten, trifft einen die Wucht des eigenen beruflichen Versagens umso härter. Dieses Versagen muss nicht unbedingt Arbeitslosigkeit bedeuten. Man kann auch erfolglos und unglücklich sein, während man noch Arbeit hat. Gerade Burnout-Betroffene sind sehr gut darin, in ihrem Job Erfolgsziele so zu definieren, dass sie sie gerade nicht erreichen. So »motivieren« sie sich durch ihre Niederlage zu noch größerer Anstrengung.
Egal ob Burnout oder nicht, egal ob Unternehmensberater oder Bandarbeiter: Wir sind zum beruflichen Erfolg verdammt. Das System lässt keinen Spielraum mehr. Deshalb sind wir kollektiv erfolgsgeil. Wie eine Monstranz tragen wir unseren Erfolg vor uns her; er ist Zuckerbrot und Peitsche zugleich, gibt uns Motivation und droht uns gleichzeitig mit gesellschaftlicher und menschlicher Entwertung. Wir müssen gebraucht werden, die Gesellschaft muss unsere Arbeitskraft wollen, sonst zerschellt unser Schiff des Selbstvertrauens an der Klippe des eigenen Versagens.
Das ist auch der Grund, warum viele Langzeitarbeitslose nicht mehr vermittelbar sind. Bis auf wenige Ausnahmen, die sich einen Kern Selbstachtung bewahrt haben, ist besagtes Schiff zerschellt und unwiederbringlich gesunken. Der einzelne Arbeitslose hat in einer Zeit, die Arbeit als Lebensmittelpunkt begreift, seine Existenzberechtigung quasi an der Garderobe abgegeben. Nicht, dass ihm das jemand vorwerfen oder es so formulieren würde. Die Gesellschaft und deren kollektives Bewusstsein bringen ihn dazu, so zu denken. Eine für den Einzelnen dramatische, manipulatorische Meisterleistung.
Wir markieren unser Revier mit den Dingen, die uns die Werbeindustrie als erstrebenswert vorgaukelt.
Mit solchen Überlegungen beschäftigt sich der Arbeitnehmer, der gerade auf seiner Karrierewelle surft oder zumindest noch einen Job hat, nicht. Für ihn geht es vielmehr um die Sicherung des Erfolgs und seine Übersetzung in materielle Zeichen. Das Revier muss markiert werden, am besten mit den Dingen, die uns die Werbeindustrie als erstrebenswert vorgaukelt. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Autos, Reisen, Möbel, Kleidung, Uhren. Ein schöner Spruch lautet: »Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen.« Neueste Zahlen des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) zeigen, dass 2009 allein im deutschen Fernsehen 3,7 Millionen Werbespots gesendet wurden.9 Das sind pro Tag knapp 10 137 und pro Stunde etwa 422. Die deutsche Werbebranche insgesamt machte 2009 einen Umsatz von fast 29 Milliarden Euro. Und diese Zahl beinhaltet bereits einen Rückgang des Umsatzes um 6 Prozent im Vergleich zum Jahr 2008.
Diese Werbung nennt Oliviero Toscani, der Macher hinter den umstrittenen Benetton-Werbekampagnen (in denen schon mal blutverschmierte Hemden mit Einschusslöchern gezeigt werden), schlicht »Verbrechen gegen die Intelligenz«, ein »künstliches und abgeschmacktes Reich, das uns seit bald dreißig Jahren verblödet«. In seinem furiosen Manifest gegen die herkömmliche Werbung rechnet Toscani ab: »Für Zehntausende von Dollar wird ein Supermodel in Szene gesetzt, um frischverliebten Friseusen ohne das nötige Kleingeld und schwärmerischen Sekretärinnen auf der ganzen Welt Parfums zu verkaufen. Sie alle werden heißgemacht auf einen unerreichbaren bürgerlichen Traum. Die Werbung verkauft keine Produkte oder Ideen, sondern ein verfälschtes und hypnotisierendes Glücksmodell. […] Man muss die breite Öffentlichkeit mit einem Lebensmodell blenden, dessen gesellschaftliches Ansehen es verlangt, dass man Garderobe, Möbel, Fernseher, Auto, Haushaltsgeräte, Kinderspielzeug, einfach sämtliche Gebrauchsgegenstände so oft wie möglich erneuert. […] Diese groben Vereinfachungen werden bis zum Erbrechen wiederholt.«10
Werbung soll zum Kaufen verführen. Produkte sollen mit Wohlgefühl assoziiert werden, mit Status, Exklusivität, sichtbarem Erfolg. Vielleicht glauben wir, dass ein solches Zeigen von Erfolg sexy ist. Was jedoch garantiert nicht sexy ist: den anderen mit der Nase auf die Spur des angeblichen eigenen Erfolgs stoßen zu wollen. Zur idealen Plattform für derart ichbezogene Inszenierungen haben sich soziale Netzwerke wie XING, Twitter oder Facebook entwickelt. Dort präsentieren sich manche »Jäger des verlorenen Erfolgs« mit einer Penetranz, als gäbe es kein Morgen.
Da faselt zum Beispiel eine Dame von der untergründigen Psychologie des Erfolgs – die sie natürlich exklusiv entdeckt hat – und vermarktet so ihr entsprechendes Buch. Sie lasse sich natürlich jederzeit zu einer Kontaktaufnahme herab, doch jetzt segle sie erst mal kreuz und quer durch Südostasien. Danach jedoch könne man sie gerne kontaktieren. Den Betrachtern ihres geblähten Segels will sie mit solch zartem Hinweis und der Subtilität eines Elefanten im Porzellanladen vor allem eines signalisieren: Schaut mal, wie schön, sexy und erfolgreich ich bin. Oder kürzer: Macht’s gut, ihr Luschen.
Ähnliche Augenzucken verursachende Klowand-Graffiti bei Twitter: »Wie Sie mit XING und Facebook ihre Karriere vorantreiben #Selbstmarketing #reputation«, »›Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.‹ Thomas Edison«, »Wir zeigen Ihnen Wege zu Ihrem Erfolg, die tatsächlich funktionieren!« und ähnliche Sprüche. Man kann solch schräge Selbstdarstellungsshows, wie sie mittlerweile in sozialen Netzwerken Alltag sind, für die Auswüchse einiger stilloser Freaks halten. Ich glaube jedoch, sie sind nur die sichtbare Spitze eines Sehnsuchts-Eisbergs, endlich allen zu zeigen (und zu erzählen), wie toll man durchstartet. Wir sind besoffen vom Lockmittel Erfolg, das vom Fernseher zuerst ins Hirn und von da ins Herz sickert und wie Efeu andere Lebensmotivationen erstickt. Deshalb schnappen wir gierig nach der Luft der Personality-Shows, wollen teilhaben an der Welt der Promis und schönen Menschen, von denen wir glauben, dass sie es »geschafft haben«.
Wir sind besoffen vom Erfolg!
Inzwischen muss alles und jeder erfolgreich sein: man selbst sowieso, das Unternehmen, demnächst auch der Besuch der Katze auf dem eigenen Klosett. Vieles dreht sich nur noch um Selbstdarstellung, um Durchsetzung und Erfolg. Dafür nimmt man sogar größte Opfer in Kauf. Ein Freund von mir, der in München wohnt, erzählte mir kürzlich von dem Phänomen No rent, but car. Weil sich Münchner mit einem Durchschnittsgehalt ihre Wohnung nicht mehr leisten können, geben sie diese auf und investieren ihr Geld in ein Auto, das richtig was hermacht – BMW, Audi, Mercedes oder Porsche. Jede Nacht schlafen sie im Auto. Morgens machen sie sich dann zurecht und fahren zum Geschäftstermin, als ob nichts wäre. Einige halten eine solche Maskerade Monate, manchmal Jahre durch. Gibt es ein verzweifelteres Beispiel für unsere panikartige Angst, unseren gesellschaftlichen Status zu verlieren und zu »versagen«?
Das permanente Lechzen nach Erfolg saugt uns aus.
Was aber ist, wenn ich lieber zufrieden oder einsam oder Mönch wäre? Wenn ich nicht (nur) erfolgreich sein will? Das permanente Lechzen nach Erfolg saugt uns aus. Erfolg ist die Droge, auf die in unserer ökonomisierten Welt jeder anspringt. Bist du nicht »erfolgreich«, hast du nichts, bist du nichts, und das alles ist deine Schuld. Deswegen wollen viele so verzweifelt erfolgreich sein. Manche schaffen es, andere nicht. Bei den Schreihälsen jedoch, die uns ihren angeblichen Erfolg bei XING und Twitter um die Ohren hauen, fällt mir vor allem der alte Spruch ein: Hunde, die bellen, beißen nicht.
Aber ist Erfolg immer negativ zu sehen? Immerhin bestehen unser Leben und Lernen zu einem nicht unerheblichen Teil aus Trial and error, also dem Lernen aus Versuch und Irrtum. Was nichts anderes heißt, als dass wir »erfolgreiche« Handlungen wiederholen und »erfolglose« Handlungen sein lassen. Wie lösen wir den Widerspruch auf, dass Menschen zu allen Zeiten aus Erfolg und Misserfolg lernen (müssen), ohne dass sie sich gleichzeitig in unrealistische Ansprüche und naive Erfolgskriterien verstricken?
Für den Anfang wären wir gut beraten, das Wort »Erfolg« auf seine Grundbedeutung zurückzuführen, und diese ist: neutral. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion, ein Feedback. Wenn ich einen Apfel fallen lasse, zieht ihn die Gravitation nach unten. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist eine schlichte Konsequenz, es »erfolgt« zwangsläufig. Beim Apfel-Beispiel fragt sich wahrscheinlich niemand, ob der Apfel nun »Erfolg hat«, weil er auf die Erde fällt. Er tut es einfach. Ohne Bewertung, ohne Ärger, ohne Euphorie.
Erfolg ist etwas Individuelles und muss individuell bewertet werden.
Anders bei uns Menschen. Stellen Sie sich einen Projektleiter vor, der aufgrund guter Leistung befördert wird. Wir sind so konditioniert, dass wir dieses Ereignis sofort als »gut«, als positiv, bewerten: »Wow, super, endlich hat sich die Anstrengung gelohnt! Glückwunsch!« Auf eine Aktion (gute Arbeit, erfolgreiche Projekte) folgt eine Reaktion (Beförderung, mehr Geld). Und wir haben als Kollektiv gelernt, dass so etwas gut ist, also ein Erfolg im umgangssprachlichen Sinn. Wenn nun der Projektleiter durch die Beförderung von Stuttgart nach Hamburg ziehen muss und dadurch seine Frau und seine zwei kleinen Kinder nur noch an den Wochenenden sieht, trübt sich das Bild schon ein. Aus dem Erfolg wird ein Erfolg mit Fragezeichen. Wenn wir uns nun weiter vorstellen, dass die Stelle in Hamburg sich als sehr stressig herausstellt, mit nervigen Kollegen und undankbaren Aufgaben, müssen wir uns vollends fragen, ob in diesem Fall der Begriff »Erfolg« noch angemessen ist.
Was bedeutet das? Erfolg ist etwas Individuelles und erfordert darum auch eine individuelle Bewertung. Insofern wäre es ein guter Anfang, wenn Menschen erst einmal für sich Erfolg definieren würden, ohne die Einflüsterung der Medien oder die Angstmache durch die Politik. Dazu benötigen wir eine gewisse Souveränität. Nur als souveräne Wesen, die ihre Werte, ihr Können, ihre Ziele sowie ihre Stärken und Schwächen kennen, sind wir in der Lage, über Ereignisse in unserem Leben zu urteilen: Ist beispielsweise eine Beförderung nach Betrachtung aller Fakten tatsächlich ein Erfolg? Oder eher ein neutrales Ereignis, vielleicht gar ein Misserfolg? Wenn wir die Reflexionsfähigkeit, die Souveränität und den Willen haben, unseren eigenen Erfolgsweg zu gehen, kann Erfolg etwas sehr Beglückendes sein.
Doch weder billige Marktschreier noch durch die Gesellschaft transportierte Stereotype bringen uns hier weiter. Erst wenn wir unseren eigenen Erfolgsweg gefunden haben, bekommt Erfolg den rechten Platz in unserem Leben, wird zu einem Baustein nicht nur einer wie auch immer gearteten »Karriere«, sondern tatsächlich zum Sinnbestandteil unserer Existenz – was uns letztendlich auch vor einer überzogenen Erfolgsgeilheit bewahrt. Denn das rechte Maß ist wichtig im Leben – nicht nur im Beruf.