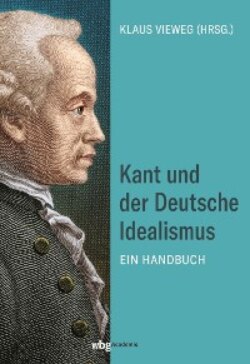Читать книгу Kant und der deutsche Idealismus - Markus Gabriel - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX. Wirkt eine Kausalität hinter unserem Rücken? Fortschrittsdenken und Geschichtsphilosophie
ОглавлениеDass diese Möglichkeit auf einen geschichtlichen Fortschritt hoffen lässt, hat Kant an vielen Stellen seiner Geschichtsphilosophie deutlich gemacht. Allerdings verführen diese Passagen mitunter dazu, ihm einen – für die Aufklärung typischen – Optimismus und naiven Fortschrittsglauben zu unterstellen. In der Tat trifft man in den entsprechenden Schriften (wie etwa in „Vom ewigen Frieden“80 oder „Idee in weltbürgerlicher Absicht“81) immer wieder auf Formulierungen, in denen die Entwicklung der menschlichen Geschichte als ein zielgerichteter Prozess erscheint, der sich ganz ohne unser Zutun, gleichsam von der Natur gesteuert in Gang setzt, wobei der Ausdruck „Natur“ synonym mit „Vorsehung“ und „Vernunft“ erscheint.82 Doch auch diese teleologischen Aussagen müssen vor dem Hintergrund der kritischen Bestimmung des Kausalitätsbegriffs verstanden und rekonstruiert werden. Schon die Kritik der Urteilskraft hat teleologische Urteile jedweder Art, ganz im Unterschied zu der Auffassung vieler zeitgenössischer Theorien, in ihrer Geltung eingeschränkt und sie auf das nur subjektiv gültige (d.h. für alle menschlichen Subjekte, deren vernünftiges „Bedürfnis“ auf systematische Einheit der Erklärungen geht) Prinzip der reflektierenden Urteilskraft zurückgeführt. Damit sind teleologische Urteile insgesamt, aber auch solche, die geschichtliche Zusammenhänge behaupten, Reflexionsergebnisse und nicht etwa Aussagen über objektive Ursache-Wirkungsbeziehungen oder eine im buchstäblichen Sinne teleologisch eingerichtete Natur.
Allerdings spricht Kant etwa im ersten Zusatz der sog. Friedensschrift erstaunlicherweise davon, dass die Gewähr oder Garantie für eine Entwicklung unserer Gesellschaften hin zum ewigen Frieden in dem Mechanismus der Natur liege – und nicht etwa in der moralischen Haltung oder Entwicklung der Menschen. Die damit verbundene Rede von der „großen Künstlerin Natur“ und die immer wiederkehrende Wendung, wonach die „Natur“ aktiv etwas „wolle“ und sogar „eigene“ (nämlich Natur-)Zwecke verfolge, scheint die kritische Bestimmung des teleologischen Urteils zu unterlaufen. Oft kann es so scheinen, als komme hier ein eher naives teleologisches Naturverständnis zum Ausdruck, in dem die „Natur“ oder – das wäre ein weiterer Schritt – ihr Schöpfer jeweils zu einer Handlungsmacht aufgebaut würden. Tatsächlich aber stehen Kants anschließende Bemerkungen der Möglichkeit, die betreffenden Passagen auf diese Weise auszulegen, in der Regel entgegen. Zum einen betont Kant immer wieder: Es ist der Mechanismus der Natur, der für uns irritierende, weil unwahrscheinliche, aber dem Menschen nützliche Phänomene hervorbringt, und nicht etwa die teleologisch organisierte Natur. Aber wir wissen uns die jeweiligen Phänomene nicht anders begreiflich zu machen, als dass wir der Natur einen Zweck unterlegen. Die fraglichen Phänomene sind solche der „äußeren Zweckmäßigkeit“, wie etwa das Treibholz, das die Menschen an den Eisküsten mit Brennstoff versorgt, oder die bevölkerungspolitisch nützlichen, ja sogar kultivierenden Effekte des Krieges, wie Kant vor dem Hintergrund der Kriege, die er kannte, noch sagen konnte. Doch wenn wir uns solche Phänomene auf eine teleologische Weise „begreiflich“ machen, dann müssen wir uns immer darüber im Klaren bleiben, dass es sich um Erklärungen handelt, die wir auf der Grundlage einer Analogie zum menschlichen Handeln gewinnen. Diese Analogie wird dadurch in Gang gesetzt, dass wir uns als Grund der Naturkausalität einen Zweck „hinzudenken“. Die Ergebnisse zu dieser Art der Erklärung haben nicht den Status von Erfahrungen oder objektiven Erkenntnissen. Sie lassen uns aber – das wäre auch ihre erkenntnisbezogene Funktion – einen Zusammenhang erkennen, der zwischen dem Mechanismus der Natur und unserem praktischen Handeln besteht und den wir gerade für die Realisierung unserer moralischen Pflicht und unserer moralischen Zwecke nutzen können. Entsprechend leitet Kant dann auch vom Naturzweck über zum moralischen Endzweck. Die Beispiele wenden sich nun auch entsprechend weg von bloß nützlichen Naturphänomenen hin zu solchen Wirkungen der Natur, die auf uns einen Zwang ausüben, der unser Handeln zur Verwirklichung moralischer Verpflichtungen leitet, anregt, unterstützt – eine Art „moralisches Nudging“ durch die Natur. Egoistisch motiviertes Handeln wird auf diese Weise – mit Hegel müsste man sagen: „hinter unserem Rücken“ – in Strukturen verwandelt, die ihrerseits dann positive moralische (im ethischen und juridischen Sinne) Effekte haben. In der Kritik der Urteilskraft wird behauptet, dass dieser Überlegung Notwendigkeit zukomme: Denn auch die indirekten Faktoren bei der Verwirklichung moralischer Zwecke in Betracht zu ziehen, ja sie zu erkennen und zu nutzen, ist etwas, das (wie in der KrV auch in der KdU) im Rahmen der „moralischen Teleologie“ gefordert wird. Die moralische Teleologie bestimmt ja nicht, welche Zwecke wir uns setzen sollen, sondern sie befasst sich mit dem Verhältnis unserer moralischen Zwecksetzungen zu der Welt, in der wir diese Zwecke verwirklichen sollen, und sucht nach produktiven, zweckmäßigen Beziehungen, die sich zwischen der Naturkausalität und unseren praktischen Vorhaben herstellen lassen. In praktischer Hinsicht sind wir dazu genötigt, den Mechanismus der Natur unseren moralischen Zweckgedanken zu unterwerfen und die Natur, respektive ihren Mechanismus als ein Instrument zur Realisierung unserer Zweckbestimmung nicht nur zu beurteilen, sondern ihn auch entsprechend zu gebrauchen und zu gestalten. Die moralische Überlegung reicht so durchaus noch weiter als nur bis zur kritischen Prüfung von Maximen. Unter einer geschichtsphilosophischen Perspektive weitet sie den Blick und thematisiert auch die indirekten Einflüsse – der Natur und ihrer Kausalität – auf unser Handeln und die moralische Entwicklung der Menschheit.
Wenn man diese Überlegungen noch einmal zurückbezieht auf die oben erwähnte „Garantie“, die Kant der Kausalität der Natur zuspricht, so wird klar, was er damit meinte: Die Kausalität der Natur, die sich in unseren Handlungen in der Form von egoistischem Verhalten Bahn bricht, die aber auch in entzweienden Phänomenen wie dem Krieg und der Verschiedenheit der Sprachen und Religionen bzw. Glaubensarten auftritt, kann in unserem kollektiven Handeln eine durchaus produktive Dialektik in Gang setzen. Wir werden durch solche Phänomene jeweils in zwingende Situationen getrieben, in denen wir uns dann mit Vereinbarungen, Organisationen, Abkommen und vor allem: mit der Entwicklung von Rechtsstrukturen behelfen müssen. Auf lange Sicht werden uns solche Wirkungen der Natur aber auch die Handlungen, die wir dann innerhalb dieser Strukturen vollziehen, in einem ethischen Sinne besser machen können. Die Natur garantiert „durch den Mechanism der menschlichen Neigungen selbst den ewigen Frieden; freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ist, die Zukunft desselben (theoretisch) zu weissagen“.83 Die Rede von der Garantie ist nur aus einer praktischen Perspektive angemessen und zeigt nur Möglichkeiten auf, die sich auch nur im Rahmen praktischer Verhältnisse eröffnen und nutzen lassen. Unter dieser Perspektive offenbart uns – so könnte man es formulieren – die Dialektik der permanenten Dynamisierung der menschlichen Verhältnisse, dass sogar scheinbar entgegenstehende Phänomene für die Verwirklichung unserer moralischen Zwecke genutzt werden können.
Allerdings – und das ist der Unterschied zu einer naiven, unkritischen Teleologie, muss ein moralisches Element in diesen Prozess eingespielt werden – und das ist der zumindest in vielfältigen Preisungen durch Politiker und darin „zumindest dem Worte nach“ präsente Rechtsbegriff. Wenn sich der Staat und die Politik auf ihn in einer affirmativen Weise – und sei es noch so oberflächlich und äußerlich – verpflichtet geben (und welcher Staat möchte nicht das Recht auf seiner Seite haben?), so steht damit zugleich ein anerkannter normativer Bezugspunkt für alle emanzipatorischen Kräfte zur Verfügung. Der aber kann nun – und damit kommt der Gedanke der Publizität wieder in den Blick – auch in praktischer Hinsicht weiter konkretisiert und in seine Konsequenzen entwickelt werden. Was vielleicht nur als abstrakte Idee zu ideologischen Zwecken im Munde geführt wurde, wandelt sich auf diese Weise zu einem Werkzeug des moralischen Fortschritts und der Aufklärung (im kantischen) Sinne.
Kants Lehre von der „reflektierenden Urteilskraft“ bestimmt nicht nur den epistemologischen Status des Fortschreitens zum Ewigen Frieden und erhellt die oben zitierte Wendung von der „großen Künstlerin Natur“, sondern eröffnet auch eine Alternative zu der scheinbar alternativlosen Wahl zwischen einer „ernüchterten, realistischen Geschichtsschreibung“84 und einem zu positiven, optimistischen bzw. idealistischen Weltbild85, wie sie gegenwärtig immer noch die Geschichtsphilosophie prägen.
Denn in Kants Geschichtsphilosophie geht es um die Frage, wie wir mit dieser Wahl umgehen können und wie wir dabei unser Selbstverständnis als autonome und freie Wesen (sei es als Individuen, sei es als Gesellschaft) mit den „ernüchternden“ Erfahrungen so vermitteln können, dass der – systematisch höchst unbefriedigende – Widerspruch zwischen ihnen überwunden werden kann. Wenn wir konsequent an unserem praktischen Selbstverständnis festhielten und den damit verbundenen moralischen Forderungen zu entsprechen suchten, müssten wir uns, die Natur und die Welt so denken, als sei sie so eingerichtet, dass wir unsere Freiheit und die damit verbundenen moralischen Forderungen in ihr verwirklichen können. Nur unter der Annahme dieser Weltsicht können wir davon ausgehen, dass wir durch unser vernünftiges Handeln stabile Verfahren etablieren und weiter ausarbeiten können, durch die unsere Welt und unsere gesellschaftlichen Lebensbedingungen schrittweise ebenfalls vernünftiger werden und sich stetig verbessern. Diese Weltsicht ist keine Zustandsbeschreibung der tatsächlichen Verhältnisse und wird auch nicht aus Beobachtungen gewonnen, die auf der Grundlage des Kausalitätsprinzips verbunden werden, weshalb sie auch nicht der Geschichtsschreibung zugeschlagen werden kann. Sie beruht zwar auf Tatsachen, nämlich den real erscheinenden tatsächlichen Wirkungen menschlichen Handelns. Aber sie ist gleichwohl eine Interpretation dieser Tatsachen unter einer leitenden, nämlich moralischen Fragestellung und Zwecksetzung: unter der Frage, inwiefern diese Tatsachen als Zeichen der Annäherung an das Ideal der gesellschaftlichen Freiheit und des Weltfriedens gedeutet werden können.
Ideen, Ideale und Zwecke sind selbst nicht als Tatsachen gegeben oder „in der Welt“ beobachtbar, sondern werden von uns gedacht und sollen, wenn es sich um moralisch geforderte Zwecke handelt, in der Welt von uns verwirklicht werden. Wir müssen daher, wenn wir „moralisch consequent denken“86 wollen, uns auch um die konkreten Anwendungsbedingungen dieser Zwecke kümmern und die Realverhältnisse gegebenenfalls entsprechend modifizieren, sodass wir unsere Zwecke auch in dieser Welt realisieren können. Dazu können wir uns auch der Zwecksynthesen der reflektierenden Urteilskraft bedienen, die uns eine die Moral fördernde Sicht auf die menschliche Geschichte als einer Geschichte des Fortschritts eröffnet. Unter dieser Sicht erscheinen uns unsere emanzipatorischen Anstrengungen als aussichtsreich, weil sie uns auf die verschiedensten Zweckbeziehungen in der Welt, auf die Schönheit und die Zweckmäßigkeit der Natur, aber eben auch auf Errungenschaften moralischen Fortschritts in der menschlichen Historie hinweisen und sie uns verständlich machen. Solche Ereignisse können wir als bestätigende Hinweise dafür nehmen (in der Friedensschrift sagt Kant, dass sie „hervorleuchten“), dass wir auch mit unseren politischen Zwecken und den entsprechenden Anstrengungen (den unter diesen Zwecken geführten sozialen und politischen Kämpfen) „in die Welt passen“ und unsere moralischen Ideen in ihr verwirklichen können. Wir sollten uns dabei aber immer bewusst bleiben, dass alle diese Hinweise „in pragmatischer Absicht“ gegeben werden und selbst keine Beschreibungen sind. Aber wenn man tatsächlich den Fortschritt von Aufklärung und Frieden als einen erstrebenswerten Zweck anerkennt und als Ziel des eigenen Handelns angenommen hat, dann muss man – wenn man konsequent denkt – eben auch einsehen, dass es geboten ist, die zur Verwirklichung des angenommenen Zwecks erforderlichen Mittel ebenfalls zu wollen; anderenfalls nämlich müsste man den Zweck aufgeben; denn das Festhalten an diesem Zweck bei völliger Untätigkeit, auch die notwendigen Mittel zu erarbeiten, wäre irrational.
In der Tat kann man sagen: Wir benötigen eine „erzählbare Geschichte von kollektiven Erfolgen und Misserfolgen“87 auf dem Weg des Fortschritts hin zu einer aufgeklärten Gesellschaft. Sie aber ist ein Produkt der reflektierenden Urteilskraft, eine bloße pragmatische Hypothese. Die entscheidende Forderung, mit der Kant aber auch noch den Ansprüchen der gegenwärtigen Geschichtsphilosophie entspricht, lautet: Wenn wir uns von dieser Geschichte des Fortschritts in unseren politischen Entscheidungen leiten lassen, dann müssen wir gleichwohl retrospektiv die gesellschaftlichen Ereignisse in nüchterner, realistischer Geschichtsschreibung auf beschreibbare Realitäten hin prüfen. Die teleologische Beurteilung und die wissenschaftlich beschreibende Kausalerklärung würden dann, genauso wie es Kant für das Verhältnis von teleologischem Urteil und Erklärung auf der Grundlage der Naturkausalität für die Naturwissenschaft fordert, kritisch ineinandergreifen und produktiv zusammenarbeiten. Damit wäre auch in der Geschichtsphilosophie ein Übergang möglich zwischen den sich scheinbar einander ausschließenden Alternativen ernüchternder und damit vielleicht auch realistischer Geschichtsschreibung einerseits und „idealistischen“, im Sinne von allzu optimistischen Narrationen andererseits. Wir brauchen – das wäre die Einsicht Kants – beide Sichtweisen, wenn wir die Idee einer aufgeklärten Gesellschaft als normativen Bezugspunkt nicht aufgeben, sondern ihr durch prozedurale Konzeptionen – zum Beispiel in der Ausweitung des von Kant so genannten „öffentlichen Vernunftgebrauchs“ – zur Wirklichkeit verhelfen wollen. Der Friede übrigens ist, wie Kant an einer Stelle der Friedensschrift ganz lakonisch bemerkt (und was Pazifist:innen etwas irritieren mag), eine Nebenfolge, die sich einstellt, wenn der Forderung nach Publizität konsequent entsprochen wird.88