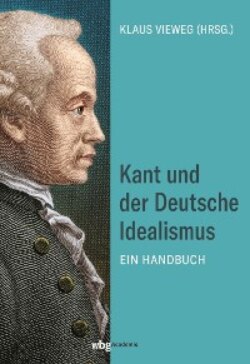Читать книгу Kant und der deutsche Idealismus - Markus Gabriel - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. Die Erweckung durch Hume und die Lösung des Antinomienproblems
ОглавлениеEs war allerdings, wie Kant in verschiedenen Selbstzeugnissen betont, offensichtlich die Lektüre von Humes Treatise of Human Nature von 1739/174047 und dort vor allem die ausführliche antimetaphysische Darstellung des Satzes vom Grund, die Kant zu einem fundamentalen und eigenständigen Entwicklungsschritt und zur Entwicklung der Transzendentalphilosophie anregte.48 An verschiedenen Stellen seiner Schriften streicht Kant die Bedeutung Humes für seine, wie er es später formuliert, „Erweckung“ aus dem „dogmatischen Schlummer“ und die Auflösung seiner Verbundenheit mit der Schulphilosophie hervor.
Hume nämlich, so betont Kant, hatte das Antinomienproblem, aber eben auch die Beschäftigung mit dem Satz vom Grund, mit besonderem Scharfsinn in den Blick genommen und dadurch sein eigenes Denken in eine ganz neue Richtung geleitet.49 Nach Kants Bekunden waren es vor allem folgende Einsichten Humes, die Kant weiterbrachten: Hume streicht heraus, dass das menschliche Gemüt nach Ursachen für jede Erscheinung verlangt und dazu versucht, Wirkungen auf Ursachen zurückzuführen; so gesehen kann also der Satz vom Grund ganz zu Recht ein Prinzip des Verstandes genannt werden. Aber, so hat Hume auch betont, die Menschen begnügen sich bei dieser Suche nach Ursachen nicht mit der Erkenntnis der unmittelbaren Ursachen. Sie hören „mit dem Nachdenken und Nachforschen“ nicht eher auf, „als bis sie zum ursprünglichen letzten Grunde gekommen sind“.50 Dabei schreiten sie, wie Hume deutlich macht, immer weiter fort in der Suche nach Ursachen, um schließlich zum Unbedingten, zu einer letzten Ursache, nämlich Gott, zu gelangen und in dieser letzten Ursache, die selbst nicht verursacht und damit unbedingt ist, alle bis dahin erkannten Ursachen zusammenzufassen. Doch auch wenn diese Suche nach einer unbedingten Ursache das Ziel all unseres Nachdenkens darstellt, so ist dieses Ziel selbst, wie Hume am Ende der Argumentation herausstreicht, doch nicht erreichbar. Die für Kant so produktive Einsicht Humes lag in der skeptischen Haltung gegenüber dem universalen Anspruch, den die traditionelle Metaphysik mit dem Satz vom Grund verbunden hatte und in der folgenden Erkenntnis: Das Prinzip, der Satz vom Grund, nach dem wir bei dieser Ursachensuche verfahren, ist gar kein objektives Prinzip, nach dem die Welt selbst „funktioniert“ oder aufgebaut ist. Es ist eines, das in „uns selbst liegt und nichts als eine Bestimmung unserer Seele ist“.51 Es war diese Einsicht in den subjektiven Charakter des vorgeblich universellen Satzes vom Grund, die Kant überzeugte. Und besonders produktiv erschien ihm noch viel mehr eine damit verbundene Folge: dass nämlich jedes konkrete Ursache-Wirkungsverhältnis, das wir unter der Voraussetzung dieses Satzes erkennen, nicht in den Dingen selbst liegen könne, sondern auf eine synthetische Leistung des erkennenden Subjekts selbst zurückzuführen sei. Der Satz vom Grund muss also, so lautet Kants Neubestimmung dieses Prinzips, als ein Gesetz verstanden werden, das gerade keine Aussage über die kausale Beziehung des Daseins zwischen den Dingen erlaubt. Auf seiner Grundlage können wir nur zu Erkenntnissen gelangen, wie die Dinge uns – unter den Bedingungen und Formen unserer Art und Weise zu erkennen – in Raum und Zeit erscheinen. Daher ist es nötig, den Satz vom Grund in seiner Gültigkeit auf Gegenstände unserer Erfahrung einzuschränken. Als Forderung „[e]in jeder Satz muß einen Grund haben“, meint Kant, bringe der Satz vom Grund durchaus ein logisches, formales Prinzip zum Ausdruck, aber er sei eben auch nur als ein solches dann auch allgemein wahr. Dieses logische Prinzip müsse man nämlich deutlich unterscheiden von dem Satz: „Ein jedes Ding muß seinen Grund haben“. Dieser Satz hat aber nicht nur Sätze (wie das logische Prinzip) zum Gegenstand hat, sondern Gegenstände der Erfahrung. In dieser Verwendung formuliert der Satz vom Grund dann die Bedingung, dass Dinge der Erfahrung, also Erscheinungen, in der Folge der Zeit einander bestimmen und dass eine bestimmte Erscheinung die Ursache (der bestimmende Grund in der Zeit) einer bestimmten anderen sei. Kant dringt damit auf eine klare Unterscheidung der logischen Bedeutung des Satzes vom Grund von der zweiten, transzendentalen Verwendung, die eine Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung explizit macht. Diese transzendentale Verwendung des Satzes vom Grund bezieht sich auf die Ursache-Wirkung-Relation von Gegenständen der Erfahrung und wird daher angemessener als das Prinzip der Veränderung (das Kausalprinzip) bezeichnet. Das Kausalprinzip aber ist, anders als der Satz vom Grund, in seiner Geltung auf Erscheinungen begrenzt. Die Dinge als Erscheinungen aber treten immer in Raum und Zeit auf und stehen unter diesen Formen der Anschauung, die ebenfalls nicht selbst Erfahrung (also den Sinnen entsprungen) sind, sondern als Bedingungen der Möglichkeit – wie das Kausalprinzip – Besonderheiten unseres Erkenntnisvermögens darstellen. Raum und Zeit sind dabei „nichts wirkliches“, sondern präformieren vielmehr alle Gegenstände möglicher Erfahrung. Diese sind also immer Erscheinungen und müssen von Dingen an sich, wie sie unabhängig von den Bedingungen unserer Erkenntnis gedacht, aber eben nicht von uns erkannt werden können, unterschieden werden. Der „alte“ Satz vom Grund kann daher nicht mehr zur objektiven Bestimmung aller Gegenstände herangezogen werden, insbesondere kann er nicht zur objektiven Bestimmung oder zum Beweis der Existenz der obersten oder letzten Ursache aller Ursachen („Gott“) dienen. Wohl aber drückt sich in ihm die wissenschaftstheoretisch unerlässliche Forderung aus, dass ein jedes Urteil begründet sein muss und jedes in Raum und Zeit erscheinende Ding eine in Raum und Zeit erscheinende Ursache haben muss.52 Die darin liegende Transformation des „alten“ Satzes vom Grund ist entsprechend bedeutsam und folgenreich, da er nun nicht mehr eingesetzt werden kann, wie in der Schulphilosophie üblich war, um eine Brücke zur Erkenntnis des Unbedingten oder Notwendigen zu schlagen und damit das Dasein Gottes zu beweisen. Diese ganze Tradition hatte auf der Basis des Satzes vom Grund die Annahme eines Schöpfergottes als eines letzten Grundes für das Dasein der Dinge in der Welt als notwendig und damit wahr zu erweisen. Doch nach der kritischen Revision dieses Prinzips konnte der Satz vom Grund legitimerweise eben nur noch auf die Erkenntnis von Gegenständen unter Zeitbedingungen (Erscheinungen) angewendet werden, nicht aber auf notwendiges Dasein, wie es Gott als höchstem und letztem Grund alles Dasein zugeschrieben werden müsste.
Kant übernahm mit dieser Neubestimmung des Satzes vom Grund aber nicht Humes weitergehende Folgerungen, dass der Satz vom Grund bzw. das Kausalitätsprinzip aus der Erfahrung zu gewinnen seien. Und er schloss auch nicht, wie Hume, aus der Subjektivität dieses Prinzips, dass deshalb die kausale Verknüpfung zwischen Dingen bloßer Schein und somit auch gar keine Metaphysik mehr möglich sei. Im Gegenteil, Humes Einsicht in die Subjektivität und erkenntnisleitende Funktion des Kausalprinzips eröffnete ihm mit der grundlegenden Unterscheidung zwischen Erscheinungen (phaenomena) und Dingen an sich (noumena) ein begriffliches Instrumentarium, das er zur Sicherung der Erfahrungserkenntnis einsetzen und darüber hinaus auch zur Lösung des Antinomienproblems nutzen konnte, um dadurch die Metaphysik sogar auf einen neuen, soliden Boden zu stellen.
In der Kritik der reinen Vernunft findet sich im Rahmen der „Logik des Scheins“ Kants Auseinandersetzung und seine Lösung von vier prominenten Antinomien, in die die Erkenntnis des Kosmos oder der Welt in Raum und Zeit unter rationalistischen und empiristischen Perspektiven gerät, darüber hinaus seine Auflösung des von ihm so genannten „Paralogismus“, d.h. des Fehlschlusses von der Einheit der Seele auf ihre Unsterblichkeit, und die Widerlegung der Beweise der Existenz Gottes mit Hilfe der theoretischen Vernunft. Im Folgenden wird nur auf die dritte der kosmologischen Antinomien, die Antinomie der Freiheit,53 und die vierte, die „Antinomie das notwendige Wesen betreffend“,54 Bezug genommen, um an ihnen die weiteren Folgen von Kants Transformation des Satzes vom Grund zu verdeutlichen. Die dritte Antinomie beginnt mit der These: „Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesammt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzunehmen nothwendig“,55 wohingegen die entsprechende Antithese behauptet: „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur“.56 Die vierte Antinomie stellt sich ein zwischen dem Satz „Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Theil, oder ihre Ursache ein schlechthin nothwendiges Wesen ist.“ und dem Satz: „Es existirt überall kein schlechthin nothwendiges Wesen weder in der Welt, noch außer der Welt als ihre Ursache“.57
Gemeinsam liegt, wie Kant deutlich macht, beiden Antinomien ein fehlerhafter Schluss zugrunde, dem das traditionelle Verständnis des Satzes vom Grund Vorschub leistet. Wenn die Vernunft versucht, das Bedingte auf das Unbedingte zurückzuführen, dann zieht sie folgenden, problematischen Schluss: „Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben: nun sind uns Gegenstände der Sinne als bedingt gegeben“,58 folglich ist uns auch die vollständige Reihe ihrer Bedingungen gegeben. Damit aber hält sie ihre subjektiven Grundsätze der Erkenntnis irrtümlich für objektive Bestimmungen der Welt und der Dinge in ihr. Vor dem Hintergrund der transzendentalphilosophischen Differenzierung von Erscheinungen und Dingen-an-sich aber wird deutlich, dass beide Sätze – der, dass eine „Causalität durch Freiheit zu Erklärung“ der Erscheinungen der Welt „anzunehmen nothwendig“ ist, und der, dass „keine Freiheit (ist)“ – nur zum Schein als wahr erwiesen werden können. Denn dass sie beide wirklich wahr seien, ist nicht möglich, da sie einander widersprechen, d.h. in einem antinomischen Verhältnis zueinander stehen, sodass der Satz vom Widerspruch fordert, dass mindestens einer von beiden Sätzen falsch sein muss. Wenn man jedoch versteht, dass die Sätze sich nicht auf die Dinge an sich beziehen können, sondern nur auf Erscheinungen, lässt sich die Antinomie auflösen. Es wird dann klar, dass der zweite Satz nur auf Erscheinungen bezogen sein darf, aber dabei implizit unterstellt, dass er über Dinge an sich urteilt. Die Freiheit ist dann nur deshalb ausgeschlossen, da sie intellektuell ist und selbst nicht sinnlich erscheint. Der erste Satz dagegen enthält eine „Maxime“, die „nicht einfach“59 ist (im Unterschied zu der des Empirismus): In ihm werden die Dinge bereits korrekt als Erscheinungen, und nicht als Dinge an sich betrachtet, insofern also nur dem Naturgesetz der Kausalität unterworfen. Aber die zur Erklärung des Handelns notwendig anzunehmende Freiheit beinhaltet auch ein intellektuelles, nicht-sinnliches Element, nämlich die „Idee“ der Freiheit. Diese aber besitzt denselben Status wie die Dinge an sich, die ebenfalls anzunehmen notwendig sind, da es ja auch etwas geben muss, „was da erscheint“.60 Von dieser Idee der Freiheit zu behaupten, sie existiere nicht, wäre nur richtig, wenn man sie als eine sinnlich erscheinende Ursache verstünde. Die Möglichkeit, die Freiheit als Ursache für spontanes Handeln zu denken, kann dadurch aber nicht ausgeschlossen werden. Sofern es andere gute Gründe gibt, diese „Idee“ anzunehmen, dürfen diese Gründe uns auch wirklich veranlassen, an der Annahme von Freiheit festzuhalten. Unter Berücksichtigung der Unterscheidung von Ding-an-sich und Erscheinung können somit beide Sätze wahr sein, obwohl sie einander widersprechen, wenn diese Unterscheidung nicht berücksichtigt wird. In analoger Weise stellt sich der Widerstreit bei der vierten Antinomie dar, die die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit des notwendigen Wesens betrifft. Und ebenso lässt sich die Antinomie auch auflösen, indem man wieder die Unterscheidung von Ding-an-sich und Erscheinung zur Klärung heranzieht. Es wird dann deutlich, dass die Möglichkeit der Idee eines notwendigen Wesens durch die theoretische Vernunft, die ein Dasein an die Bedingung der Sinnlichkeit knüpft, nicht ausgeschlossen werden kann.
Unter der Perspektive des Empirismus, der nur Erscheinungen zulässt, kann es keine erste intellektuelle „Ursache“ geben, weder eine solche, die angenommen wird, um eine spontane Handlung, die nicht naturgesetzlich verursacht ist, für möglich zu halten (eine Handlung aus Freiheit, die besonders für unsere Praxis wichtig ist), noch eine solche, die, ebenfalls außer der Reihe der naturgesetzlichen Ursache-Wirkungsketten, durch ihr Handeln die Welt in ihr Dasein gebracht hat (die Erschaffung der Welt durch den „Vernunftbegriff von Gott“, so Kants Ausdruck in KrV, B 713). Eine erste Ursache kann dagegen gedacht, wenn auch nicht (unter dem Kausalitätsprinzip) erkannt werden, da sie ja als erste Ursache gerade nicht naturgesetzlich verursacht sein darf. Und der auf diese Weise gedachte „Gegenstand“ in der Idee, dessen sinnliche Existenz nicht beweisbar, wenn auch nicht unmöglich ist, ist gleichwohl auch nicht etwa überflüssig. Seine Annahme hat für die Praxis des menschlichen Handelns fundamentale Bedeutung.